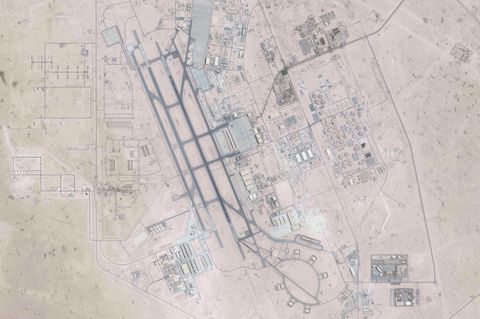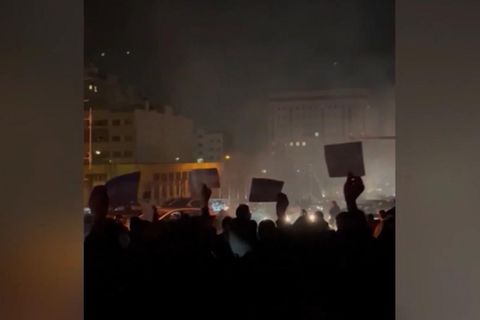Teheran und Washington spielen nun Ping-Pong - ein gefährliches Atom-Ping-Pong. Kaum hat der Enthüllungsjournalist Seymour Hersh im renommierten Magazin "New Yorker" behauptet, dass das Weiße Haus mit einen atomaren Schlag gegen Irans Nuklear-Anlagen kokettiert, plustert sich Präsident Mahmud Ahmadinedschad in Teheran erneut auf und erklärt sein Land zur Atommacht. In Natanz seien die Iraner nun in der Lage Uran anzureichern, protzt er - freilich nur für friedliche Zwecke. Prompt kommt die Antwort aus den USA: Mit diesem Verhalten fordere der Iran die Welt heraus, heißt es. Ping. Pong. Ping. Pong.
Eskalation jenseits der Fakten
Gefährlich an diesem Hin und Her ist, dass der rhetorische Konflikt zwischen dem Iran und dem Westen ungeachtet der Fakten eskaliert. Die Fakten, die reale Bedrohung durch Teheran, lassen den Beteiligten mehr Zeit für Dialog als es die immer rasantere rhetorische Eskalation glauben macht.
Sicher, die Tiraden des iranischen Präsidenten, die immer wieder kehrenden Provokationen, sie sind unerträglich. Es ist unerträglich, dass er alles daran setzt, Iran als mächtiger und gefährlicher darzustellen als es tatsächlich ist. Denn selbst wenn die iranischen Nuklearforscher in Natanz in der Lage sein sollten, Uran so anzureichern, dass damit ein Atomkraftwerk betrieben werden kann: Das bedeutet noch lange nicht, dass sie atomwaffenfähiges Material produzieren können - ganz abgesehen von den Kapazitäten möglicher Trägerraketen. Iran wäre sicher ein Stück des Weges vorangekommen. Sein vermeintliches Ziel aber - die Fähigkeit, Atombomben herzustellen - hätte das Land noch lange nicht erreicht.
Über die Motivation Ahmadinedschads mag man viel rätseln. Vielleicht geht es ihm schlicht um innenpolitische Machtsicherung. Angesichts eines gemeinsamen Gegners - dem Westen, im Kampf für die Urananreicherung - dem als nationales Symbol verstandenen Anrecht, scharen sich, so die Kalkulation, auch die Iraner um ihren Staatschef. Das stärkt seine Position - "they rally around the flag".
Vielleicht geht es Ahmadinedschad aber auch um mehr. Vielleicht will er den Westen zu Zugeständnissen zwingen - die Europäer zu wirtschaftlichen Konzessionen, die Amerikaner zum Dialog. Vielleicht ist das das Ziel: Iran als Weltmacht auf Augenhöhe mit dem Westen zu etablieren, als Taktgeber der internationalen Politik.
Ahmadinedschad verschätzt sich
Die Wünsche Teherans sind nicht allesamt Unfug. Im Gegenteil. Auch im Westen herrscht noch zu viel Unwissen über die Befindlichkeiten und keineswegs immer kriegerischen Bedürfnisse der Iraner, ihr Bedürfnis nach internationaler Anerkennung. Das Problem ist nur, dass Ahmadinedschad mit seiner Strategie genau diesen legitimen Ansprüchen schadet, von ihnen ablenkt. Noch mehr: Mit seiner Strategie, so es denn eine ist, verschätzt er sich gewaltig. Reizt er Washington weiter, wird er nicht Zugeständnisse erhalten, sondern Prügel.
Mit seinen Provokationen macht er es der US-Regierung fast unmöglich, diplomatisch auf den Iran zuzugehen. Spätestens seit März dieses Jahres gibt es Anzeichen dafür, dass die USA sich mit Teheran diplomatisch über den Irak austauschen könnten. Die Beschränkung der Gespräche auf den Irak wäre zwar ein wenig künstlich, wenn man sich gleichzeitig wegen des Atomprogramms in den Haaren hat. Aber es wäre immerhin der zarte Beginn vertrauensbildender Maßnahmen, die auch Reformer in Teheran befürworten: Seit der Besetzung der iranischen Botschaft in Teheran im Jahr 1979 unterhalten die USA und der Iran keine diplomatischen Beziehungen.
Ahmadinedschads Rhetorik macht es der US-Regierung nun fast unmöglich, die bilateralen Gespräche tatsächlich aufzunehmen. Weshalb sollte Washington einen Rabauken, der intern angeblich mit Hitler verglichen wird (Hersh), auch noch belohnen?
Unterstützung für die Falken
Viel schwerer wiegt allerdings, dass Ahmadinedschad mit seiner Rhetorik die Kriegstreiber im Weißen Haus begünstigt. Wenn Hersh die Stimmung in der Regierungszentrale in Washington auch nur annähernd richtig beschreibt, so sind dort erstaunlich wenige Lehren aus dem Irak-Krieg gezogen worden. Dann gibt es dort weiter eine mächtige Fraktion, die sich auf einer von Fakten weitgehend unbeeinflussten Mission sieht, die sogar Atombomben einsetzen würde, obwohl ranghohe Militärs eindeutig davon abraten.
Ahmadinedschad unterschätzt, dass seine wahnwitzigen Äußerungen jene in Washington begünstigen, die sich ebenfalls von den gemeinen Maßstäben der Vernunft verabschiedet haben. Die sich nicht scheuen, aus dem Ping-Pong-Spiel schnell einen Krieg zu machen. Auf einer hochkarätig besetzten Iran-Konferenz in Berlin sagte ein US-Militärexperte vor wenigen Wochen, er glaube, dass das Weiße Haus sich innerhalb von sechs bis neun Monaten auf eine Iran-Strategie festlegen werde. Ahmadinedschads Protzereien stützen derzeit zweifellos die Falken in der Bush-Regierung.
Das erste Opfer ist der mäßigende Multilateralismus
Wird dieses gefährliche Ping-Pong-Spiel fortgesetzt, ist das erste Opfer dieser heraufziehenden militärischen Auseinandersetzung ohnehin der mäßigende Multilateralismus. Am 29. März hat der Uno-Sicherheitsrat dem Iran in einer Erklärung vier Wochen Zeit gegeben, um zu belegen, dass er sein Atomprogramm mit friedlichen Absichten verfolgt.
Deshalb soll die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) alle Anlagen vollständig und jederzeit kontrollieren dürfen. Entscheidend ist dabei die Iran-Visite von IAEA-Chef Mohammed El Baradei in dieser Woche. Wird dieser unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt, kann er dem Sicherheitsrat Ende April nur davon berichten, dass Teheran seine Vorgaben nicht erfüllt.
Zwar tüftelt die Europäische Union emsig an einer Sanktionsliste. Aber mit den Iran-Freunden China und Russland als Vetomächten dürfte diese Liste keine Chance haben, im Sicherheitsrat beschlossen zu werden. Auch das könnte es den Falken in der US-Regierung leichter machen, einen Alleingang zu rechtfertigen, à la:"So, Freunde. Jetzt aber Schluss mit lustig. Wir haben es über die Uno probiert. Jetzt provoziert der Iran fröhlich weiter, und der Sicherheitsrat blockiert sich selbst. Dann müssen wir es eben wieder selber machen." Pong.
Ein alternatives Szenario
Noch ist es allerdings nicht so weit. Auch ein anderes Szenario ist, zumindest theoretisch, denkbar. Demnach könnte die gestrige Ankündigung Ahmadinedschads letzte, bewusste Provokation gewesen sein, eine Botschaft an das eigene Volk: Ja, wir haben es geschafft! Wir sind Atommacht - trotz allen internationalen Widerstands!
El Baradei dürfte alle Anlagen vollständig ansehen, und Teheran würde auch unangekündigte Inspektionen der IAEA-Experten gestatten. Der IAEA-Chef könnte dem Sicherheitsrat Bericht erstatten und Vollzug melden.
Das Gremium würde dann die EU-3 - Frankreich, Großbritannien und Deutschland - damit beauftragen, wieder mit Iran zu verhandeln. Gleichzeitig würden bilaterale Verhandlungen zwischen den USA und Iran beginnen, zunächst beschränkt auf das Thema Irak. Das gefährliche Atom-Ping-Pong wäre beendet, der mäßigende Multilateralismus würde zunächst eine neue Chance erhalten.
Eine solche Entwicklung wäre gut, eine Wende in dem Konflikt würde sie allemal bedeuten. Es darf allerdings bezweifelt werden, dass Ahmadinedschad zu so einer positiven Überraschung bereit ist. Ping.