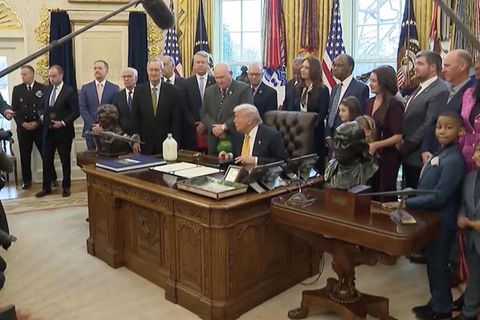Auf die Frage, was schön sei, antwortete Bertolt Brecht einst: "Schön ist es, wenn man Schwierigkeiten löst." Schön war es, Schwierigkeiten nach dem Mauerdurchbruch gemeinsam zu lösen. Wir hatten nach 40 Jahren Teilungsstrafe, schmerzhafter Trennung und Auseinanderentwicklung großes Glück. Wer sich an das erinnert, was hinter uns liegt, dem muss nicht bange werden vor dem, was vor uns liegt. Welch ein Tempo nach lähmenden Jahren der Stagnation. Wer demonstriert bekommen möchte, was Farbe aus ergrautem Land machen konnte, was "blühende Landschaft" heißt, wenn verfallende Städte ihr Gesicht zurückbekommen, wenn Renaturierung devastierter Areale erfolgt, der fahre in den Osten. Welche Leistung des vereinten Deutschlands nach Anschluss der bankrotten DDR an die prosperierende BRD, nach Übernahme in den Geltungsbereich des Grundgesetzes! "Blüh im Glanze dieses Glückes."
Dann kann und muss von Fehlern und Versäumnissen geredet werden. So wurde Artikel 146 des Grundgesetzes nicht erfüllt, ein gemeinsamer identitätsstiftender Einigungsakt verpasst. Das Prinzip "Rückgabe vor Entschädigung" machte viel böses Blut. Fehlende fördernde Übergangsregelungen für die Ostwirtschaft führten diese gänzlich in den Ruin. Nach 40 plus 20 Jahren kommt zu gegenläufig falschem Gesamturteil, wer Vorteile des Lebens in der DDR mit Nachteilen seit der Vereinigung oder Nachteile der DDR-Zeit mit Vorteilen heute vergleicht. Alles muss gleichzeitig auf die Waage. Dann wird es sehr differenziert, Niederlagen und Erfolge.
Wir Deutschen sind Nutznießer geduldiger Entspannungspolitik geworden. Mit "Wandel durch Annäherung" und "Gemeinsamer Sicherheit" wurden wir von der größten Militärkonzentration der Welt mit bedrohlicher gegenseitiger Vernichtungskapazität bei kürzesten Vorwarnzeiten befreit. Es ging nicht bloß um Mauer, Stacheldraht und Stasi; es ging auch um Waffen, Ideologien und Einflusssphären.
Das Bleiben als Drohung
Man wird noch lange streiten, wie es letztlich dazu kam, ob es das ökonomische Desaster war, an dem wir im geeinten Land länger zu tragen haben, ob es der moralisch-politische Ausverkauf war oder ob Polen und polnischer Papst alles ins Rollen gebracht haben. Ob es Gorbatschows gescheiterter Versuch war, Sozialismus und Demokratie zusammenzubringen, ob es das Ausbluten des Landes nach dem Stacheldrahtschnitt im Mai 1989 in Ungarn war oder ob es der unerwartet massenhafte Widerstandswille des Volkes war, der das Eingreifen der Sicherheitsorgane verhinderte. "Wir sind das Volk!" und "Keine Gewalt" hallte es seit dem 11. September 89 durchs Land. Rufe "Wir bleiben hier!" übertönten vorheriges "Wir wollen raus!".
Friedrich Schorlemmer...
...ist Theologe, Bürgerrechtler und Mitglied der SPD. Er wurde 1944 als Pfarrerssohn in Wittenberg an der Elbe geboren und arbeitete von 1980 an als evangelischer Pfarrer in der DDR. 1988 machte er auf sich aufmerksam, als er zur Demokratisierung der DDR aufrief. Er wurde zu einem der wichtigsten DDR-Bürgerrechtler und war Mitbegründer der Partei "Demokratischer Aufbruch".
Die Ankündigung, hier zu bleiben, war als Drohung für die Mächtigen gedacht, nicht als Zustimmung zum System! Ein inzwischen weithin unterschätzender Faktor für die innere Erosion des Systems und den gewaltig-gewaltlosen Umbruch wurde die Entschlossenheit von sogenannten Bürgerrechtlern, die im Verbund mit der (meist evangelischen) Kirche den Aufbegehrenden kurzzeitig Mut und Stimme zu geben vermochten. In die Ideologie des Marxismus-Leninismus eingepferchte DDR-Bürger besiegten tief sitzende Ängste und befreiten sich aus 40jähriger geistig-politischer Schizophrenie. "Macht das Tor auf!" Gewaltig - gewaltlos ging das vor sich und führte aus eigener Kraft in die Demokratie. Wann gab es das in deutscher Geschichte? Es zählt ferner zu den Glücksfällen unserer Geschichte, dass mit der Einheit Deutschlands auch die Zweiteilung der Welt aufgehört hat.
Eine beispiellose Transformationsleistung wurde vollbracht, doch lediglich als nachholende Modernisierung; der Paradigmenwechsel zu einer Moderne unter Nachhaltigkeitskriterien steht aus. Dabei leben wir in Deutschland auf einer Insel des Glücks. Unsere Probleme sind - gemessen an den Problemen der meisten anderen Länder - klein. Neue Herausforderungen überlagern die alten: wie trotz internationaler Kapitalverflechtung noch etwas von demokratischer Mitgestaltung in einem Sozialstaat zu retten ist; wie wirksame gemein verträgliche Regeln des Kapital- und Finanzverkehrs aufgestellt werden, statt weiter hemmungslos globale Liberalisierung und Deregulierung zuzulassen. Keiner will zurück zum Staatskapitalismus unter der Überschrift "Sozialismus". Fatal aber wirkt Privatisierung all dessen, was unter öffentlichen Gütern sowie unter Daseins-Vorsorge zu fassen ist. Weder Marxismus noch Marktismus. Es gilt, das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Gerechtigkeit zu halten, auf dass sich Spaltung zwischen Arm und Reich, Jung und Alt, Ost und West nicht vertieft.
Es steht 2010 besser als gedacht, schlechter als erhofft
Die BRD hatte den freiheitlichen Staat so gestalten können, dass sie selbst im Sozialen der DDR überlegen war. Im geeinten Deutschland wird die Demokratie zustimmungsfähig und lebendig bleiben, wenn es gelingt, die Erfolg versprechende Entfaltung des Einzelnen mit dem Auffangen der Bedürftigen zu verbinden - auch in einer globalisierten Welt, wo Gewinn anfängt, das Kriterium allen Handelns zu werden. Wo schneller Gewinn alles ist, werden alle bald Verlierer werden. Wohin maßloses Renditestreben ohne Regeln führt, ist seit 2008 spürbar.
Es steht 2010 besser als gedacht, schlechter als erhofft. Wir sind ein Land, aber weiter unterschiedlich geprägt, der Kultur wechselseitiger Anerkennung bedürftig. Die plötzlich gegebene Reformchance wurde kaum genutzt, weil der Westen sich durch die Implosion des Ostens bestätigt sah; die kommunistische Herrschaft ist überwunden, ein Feindbild geblieben. Mit Inbrunst wird auf den toten Drachen geschlagen, noch und noch.
Es war nicht falsch, die willkürliche Teilung als Folge für den Zivilisationsbruch zu verstehen, an dem wir bis heute kauen, das Tagebuch von Rudolf Höß und das Anne Franks, Jorge Semprun und Imre Kertecz lesend. Der Wettstreit zwischen Ost und West, wer denn nun das "eigentliche Deutschland" verkörpere, wer die Lehren aus der Geschichte gezogen habe, zog sich durch die 40 Jahre. Kalter Krieg konnte mit Overkill-Kapazität täglich zu einem heißen werden. Redliche Erinnerung tut not. Um den kalten Krieg der Erinnerungen zu beenden, muss die Deutungshoheit von West über Ost aufhören. Das behindert Verstehen, schadet innerer Einheit.
40 Jahre wird es dauern
Mit der Erinnerung wird weiter Geschichtspolitik betrieben, bis mit der Formel "Unrechtsstaat" womöglich alles Leben in der DDR bis '89 erledigt ist. Welches Bild vom Leben in der DDR wird etwa in der emotional aufgeladenen Horrorklamotte "Die Frau vom Checkpoint Charlie" suggeriert: Zu Diffamierung statt zu Differenzierung kommt es, wenn darin unter anderem ein Bild des Rechtsanwalts Wolfgang Vogel gezeichnet wird, das ihn zum Stasi-Handlanger macht. Was uns helfen würde, sind Filme wie "Goodbye Lenin" oder "Heimweh nach drüben". Sie ermöglichen uns, das Schwere lachend hinter uns zu lassen. Sie wirken heilend, Verwundungen nicht verschweigend.
Es ist - neben den zwischenmenschlichen Kontakten - die Literatur, die uns zusammenhielt und zusammenbringt. Wir gehören als Deutsche zusammen durch Geschichte, Symbolorte und Musik, durch Wissenschaft, Philosophie, technisches Können und unseren eigentümlichen Fleiß, durch unsere sprichwörtliche Gründlichkeit. Aber eben nicht mehr durch Untertanentreue. Verantwortung für das zwischen 1933 und 1945 Angerichtete tragen wir gemeinsam. Willy Brandt hatte von Deutschland als "Verantwortungs- und Kulturgemeinschaft" gesprochen. Tiefenwirkung hatte die Sprache, hatten die Wortkünstler, das Kabarett und die Theaterbühnen. Es war und blieb die Sprache, die durch Martin Luther verbindend geformt wurde, durch Grimms Märchen, durch Goethes, Heines und Eichendorffs Gedichte, durch die Romane Fontanes und Manns, die Dramen Schillers, Büchners und Brechts. Ostliteratur. Westliteratur.
40 Jahre wird's dauern, bis sich alles verwachsen hat. Wie wäre es, wir ließen in den nächsten 20 Jahren identitätsstiftend mehr die Kulturnation aufblühen, erinnerten uns der Texte eines Bert Brecht: "Anmut sparet nicht noch Mühe/Leidenschaft nicht, noch Verstand, /daß ein gutes Deutschland blühe,/ wie ein andres gutes Land."