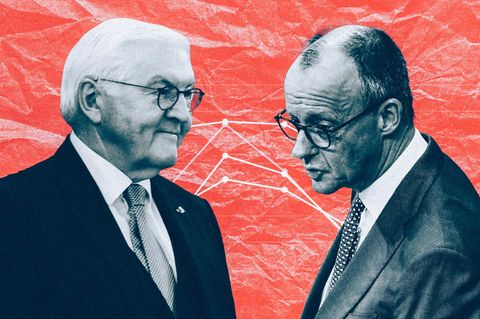Was viele im politischen Berlin und darüber hinaus schon geahnt haben, scheint jetzt amtlich: Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) führt die Alternative für Deutschland (AfD) als Verdachtsfall in Sachen Rechtsextremismus.
Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Medien – zuerst hatte der "Spiegel" berichtet – und Nachrichtenagenturen hat der Chef des Inlandsgeheimdienstes, Thomas Haldenwang, die Landesämter über die Entscheidung seiner Behörde informiert. Offiziell wollte sich das BfV auf Anfrage nicht dazu äußern.

Verfassungsschutz kann verdeckt arbeiten
Durch Einstufung der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ändert sich im Jahr der Bundestagswahl der Umgang des BfV mit der Partei, die die größte Oppositionsfraktion im Parlament stellt. Bisher galt sie intern als sogenannter Prüffall. Damit konnte der Geheimdienst Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen, zum Beispiel aus Zeitungsberichten oder Reden, über die AfD zusammentragen und so klären, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Partei verfassungsfeindlichen Bestrebungen nachgeht.
Mit der Einstufung als Verdachtsfall ist die nächste Stufe erreicht. Das BfV darf sich damit jetzt nicht nur aus offen zugänglichen Quellen bedienen, sondern auch mit nachrichtendienstlichen Methoden Informationen über die AfD sammeln. "Gegenüber konspirativen Methoden versagen diese schlichten Mittel der Nachrichtengewinnung: Spione veröffentlichen keine Programme und verteilen keine Flugblätter, nicht alle Terroristen verfassen nach der Tat Selbstbezichtigungsschreiben, und schon gar nicht nennen sie ihre wahren Namen", begründet das BfV grundsätzlich die Anwendung von Geheimdienstmethoden.
Das Verfassungsschutzgesetz führt auf, welche nachrichtendienstlichen Mittel unter anderem angewendet werden dürfen:
- Verarbeitung personenbezogener Daten:
- Einsatz von Vertrauensleuten und Gewährspersonen ("V-Leute")
- Observationen
- Bild- und Tonaufzeichnungen
- Verwendung von Tarnpapieren oder Tarnkennzeichen
Kurz: Mit der Einstufung als rechtsextremistischen Verdachtsfall kann das BfV auch verdeckt Informationen sammeln, um der AfD verfassungsfeindliche Bestrebungen nachweisen zu können.
Es gibt allerdings Einschränkungen: Die Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel komme "erst dann in Betracht, wenn alle anderen Mittel der Nachrichtenbeschaffung erschöpft sind", so das BfV. "In keinem Fall darf der Verfassungsschutz den Kernbereich eines Persönlichkeitsrechts, zu dem insbesondere die Intimsphäre gehört, verletzen."
Ausgenommen von der Beobachtung durch den Verfassungsschutz sind vorerst AfD-Abgeordnete des Deutschen Bundestags, des Europaparlaments und der Länderparlamente und Kandidierende für die in diesem Jahr stattfindenden Wahlen. Dazu habe sich der Geheimdienst vor dem Landgericht Köln verpflichtet, meldete der "Spiegel". Dort geht die AfD juristisch gegen das Vorgehen der Behörde vor.
AfD in mehrfacher Hinsicht vor Problem
Agenten oder Agentinnen könnten sich nun also das Vertrauen von AfDlern oder AfDlerinnen erschleichen, Telefongespräche zwischen Funktionärinnen oder Funktionären abhören oder Parteimitglieder und -mitgliederinnen observieren. Alles mit dem Ziel, "Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, gerichtet sind", zu erkennen, also zum Beispiel gegen die Menschenrechte oder die Gewaltenteilung.
Die Einstufung als Verdachtsfall kann für die AfD gleich in mehrfacher Hinsicht zum gewaltigen Problem werden. So gilt diese Bewertung insbesondere für Beamtinnen und Beamten und andere Staatsbedienstete in Reihen der AfD als problematisch. Wer auf der einen Seite einen Eid auf das Grundgesetz geschworen hat, kann sich nicht auf der anderen Seite in einer Partei engagieren, die möglicherweise genau dieses bekämpft – es könnten dienstrechtliche Konsequenzen folgen.
Auf bürgerliche und konservative Wählergruppen könnte die Einstufung zudem eine abschreckende Wirkung haben. Sie könnten davon Abstand nehmen, einer Partei, die den Ruch des Rechtsextremismus umgibt, ihre Stimme zu geben.
Letztlich könnte die nachrichtendienstliche Informationssammlung sogar dazu führen, dass die AfD als Ganzes oder Teilgliederungen verboten werden, sollte deutlich werden, dass sie verfassungswidrig ist. Dies ist in der Geschichte der Bundesrepublik bisher zweimal geschehen: 1952 bei der Sozialistischen Reichspartei und 1956 bei der Kommunistischen Partei Deutschlands. Zwei Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme NPD waren dagegen gescheitert.
Grundlage für die Beobachtung der gesamten AfD ist Berichten zufolge ein rund 1000 Seiten langes Gutachten des Verfassungsschutzes. Dafür hatten die Juristen und Rechtsextremismus-Experten des Amts in den vergangenen zwei Jahren etliche Belege für mutmaßliche Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zusammengetragen.
Die Landesverbände der AfD in Sachsen, Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt werden bereits von den dortigen Verfassungsschutzämtern als Verdachtsfall geführt.
Quellen: Bundesamt für Verfassungsschutz, Verfassungsschutzgesetz, "Spiegel", Nachrichtenagenturen DPA und AFP