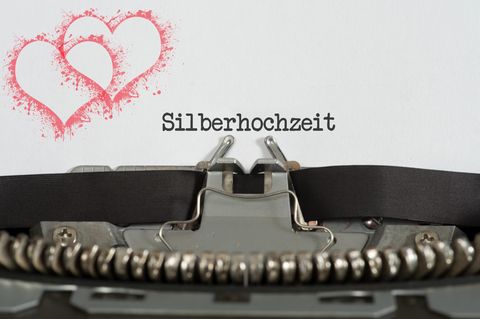Politisch motivierte Straftaten sind auf dem höchsten Stand seit Beginn der Zählungen im Jahr 2001: Eine vorläufige Statistik des Bundeskriminalamts zeigt, dass im vergangenen Jahr mehr als 47.300 Delikte gezählt wurden – ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Durch mögliche Nachmeldungen – die Regierung hatte die Daten am 5. Januar abgefragt – könnte die Zahl am Ende sogar noch höher ausfallen.
Auffällig dabei ist, dass immer weniger Straftaten zu einem politischen Spektrum zugeordnet werden können. Die sind nämlich ursächlich für den Anstieg der Delikte – eine Tendenz, die sich schon in der Statistik von 2020 zeigte. Mehr als 17.000 Straftaten waren im vergangenen Jahr für die Polizei ideologisch nicht zuzuordnen, darunter über 1000 Gewalttaten.
Ein häufiger Schauplatz von Kriminalität: Demonstrationen. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden spielt das aufgeheizte gesellschaftliche Klima in der Pandemie eine wesentliche Rolle für die zunehmenden Straftaten. Auch der Marburger Konfliktforscher Ulrich Wagner vermutet einen Effekt durch die Corona-Maßnahmen. "Vor der Pandemie ist die Anzahl politisch motivierter Straftaten eher gefallen, zeitgleich mit den Beschränkungen haben sie zugenommen. Zwingend einen Zusammenhang zu unterstellen ist schwierig, aber das ist schon auffällig – und auch psychologisch nachzuvollziehen", erklärt er gegenüber dem stern.
Coronavirus-Proteste: Warum Menschen dort Straftaten begehen
Denn hinter allen Modellen, die sich mit den Gründen für Radikalisierung beschäftigen, steht laut dem Forscher immer eines: Das Gefühl, auf anderem Wege nichts erreichen zu können. "Das deckt sich auch mit den Hintergründen vieler, die jetzt protestieren gehen", sagt Wagner anlässlich der Demonstrationen, bei denen einige Teilnehmer auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Das sei aber nicht der einzige Beweggrund derjenigen, die gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen: Zur Mobilisierung würden auch der Eindruck politischer Untätigkeit, große Medienaufmerksamkeit sowie soziale Netzwerke beitragen. Und noch eines sei nicht von der Hand zu weisen: dass Rechtsradikale die Proteste instrumentalisieren.
Wer an Demonstrationen teilnimmt, begeht natürlich nicht gleich eine Straftat. Was also veranlasst Einzelne, die vermeintlich keinem extremistischen Spektrum angehören, dazu sich zu radikalisieren und Gewalt anzuwenden? Ulrich Wagner sagt: "Oftmals entwickelt sich vor Ort eine Dynamik: Wenn einer anfängt gewalttätig gegenüber Ordnungskräften zu agieren, erzeugt das Nachahmungsverhalten." Und diese Gewalttätigkeit habe immer weiter zugenommen – ohne, dass die Demonstrationen zunehmend größer geworden sind.
Konfliktforscher fordert härteres Durchgreifen bei Demos
Um diejenigen, die sich radikalisieren, zu bändigen, plädiert Wagner für entschiedeneres politisches Handeln. "Viele beobachten eine Zögerlichkeit der Politik. Kritiker fühlen sich dadurch in ihrer eigenen Skepsis bestätigt", so der Konfliktforscher. Gleichzeitig sei es notwendig, dass Ordnungskräfte und die Gerichte härter durchgreifen. "Denn eine Komponente, die jemanden von Straftaten abhält, ist auch immer das Risiko, das man eingeht. Gewalt hat viel damit zu tun, dass der Eindruck da ist, die Strafverfolgung würde nicht funktionieren."
Würde das Ende der Pandemie auch das Ende der Proteste bedeuten? Nicht ganz, sagt Wagner – und schon gar nicht der politisch motivierten Gewalttaten. "Ich bin mir sicher, dass die Zahl der Corona-Demonstranten zum Ende der Pandemie zurückgehen wird. Gleichzeitig wird sicherlich eine kleine Gruppe bleiben, die dann auf ein anderes Thema aufspringt – zum Beispiel bei Klimaschutzmaßnahmen. Das muss aber nicht bedeuten, dass die Gewalttaten zurückgehen. Die könnten sich auch einfach verlagern, indem etwa mehr Politiker und Journalisten angegangen werden."
Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, zeigt sich angesichts der immer radikaleren Corona-Proteste besorgt. Mit Blick auf mögliche Spätfolgen hält er die Gefahr, "dass sich Menschen vom demokratischen Spektrum abwenden und parallel von Rechtsextremen geworben werden", für sehr groß. Um das zu verhindern, sei eine Debatte über die Vorteile der freiheitlichen Gesellschaftsordnung notwendig. Die Politik müsse dabei an der Spitze einer solchen Debatte stehen, "sie darf nicht ausgrenzen und verteufeln, sondern muss auch den Dialog mit Kritikern führen, die kann sich ihre Bevölkerung nicht aussuchen".