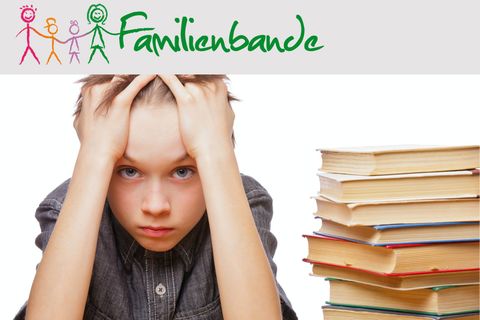Das Navi sagt links, der Fahrer will folgen. Aber die Frau im Fond des schwarzen 7er BMWs weiß es besser. Sie schnellt zwischen den Sitzen nach vorne. "Geradeaus, wir müssen hier geradeaus", sagt Sylvia Löhrmann, 53, Chefin der NRW-Grünen. Sie kennt die Gegend wie ihre Westentasche. Hinter den getönten Scheiben fliegt das Bergische Land vorbei, hier, zwischen Solingen und Wuppertal, liegt ihr Wahlkreis. Als der Fahrer endlich den richtigen Weg zum nächsten Ortstermin einschlägt, fällt Löhrmann zurück ins Leder. "Ich mag keine Navigationsgeräte. Nicht, weil ich als Grüne Technikfeind bin. Aber ich hasse es einfach, ausgeliefert zu sein."
Sylvia Löhrmann wird sich bald öfters ausgeliefert fühlen. Zumindest politisch. Gemeinsam mit der SPD werden die Grünen im bevölkerungsreichsten Bundesland eine Minderheitsregierung bilden. Für manche Gesetzesvorhaben reicht im Düsseldorfer Landtag die einfache Mehrheit, die ist den neuen Partnern sicher, sie haben zehn Stimmen Vorsprung vor Schwarz-Gelb. Doch für Größeres brauchen sie die Unterstützung der anderen Fraktionen: Stimmen der Linken, oder eben doch von CDU und FDP. Rot-Grün muss mit wechselnden Mehrheiten jonglieren, der politischen Gegner kann sich die Rosinen rauspicken. Ein instabiles Konstrukt, das schon bei den Haushaltsdebatten im Herbst zusammenbrechen kann. Hannelore Kraft, SPD-Landesvorsitzende und künftige Ministerpräsidentin, hat sich lange geziert. Sylvia Löhrmann, Grünen-Chefin, hat darauf gedrängt.
Ein Traum wird wahr
"Für uns galt: Kein Regieren um jeden Preis. Und ich persönlich hatte immer die Freiheit, Nein zu sagen", behauptet Löhrmann. Dabei war sie es, die auf einer Pressekonferenz vor einem "lähmenden Schaukampf" im Düsseldorfer Landtag warnte – nachdem Hannelore Kraft sich für den Verbleib in der Opposition ausgesprochen hatte. Die Botschaft kam an: Keine 24 Stunden später stürzte Kraft in Löhrmanns Büro, sie hatte sich plötzlich umentschieden. Wohl auch auf Druck der Parteispitze, SPD-Chef Sigmar Gabriel wollte das Minderheiten-Experiment unbedingt. Denn das neue Bündnis verschiebt die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat, schwarz-gelbe Gesetzesvorhaben können in der Länderkammer bald blockiert werden.
In NRW laufen jetzt die Koalitionsverhandlungen. Es gilt als sicher, dass Löhrmann Bildungsministerin wird. Sie selbst nennt das "eine glückliche Fügung", eine Riesenchance". Es ist wohl eher mehr: Die ehemalige Deutschlehrerin hat sich einen Traum erfüllt. Jetzt kann sie das Schulsystem vom Kopf auf die Füße stellen. Geht es nach ihrem Willen, sollen Gymnasiasten, Real- und Hauptschüler in NRW künftig unter einem Dach lernen, in "regionalen Gemeinschaftsschulen". Ein mutiges Vorhaben, das Eltern, Interessenverbände und bürgerliche Parteien mit dem Kampfbegriff "Einheitsschule" attackieren. Und ein ungewöhnliches Konzept für eine Frau, die stets von ihrer Zeit auf einer katholischen Schwesternschule, einem "Nonnenbunker", schwärmt.
"Viele Feministinnen waren auf solchen Schulen", erklärt Löhrmann. "Unsere Schulleiterin war eine Frau. Und so durfte ich immer wieder erleben, was Frauen in Führungspositionen erreichen können." Die Schulzeit auf dem Essener Mädchengymnasium "Beatae Mariae Virgines" habe auch "ein grünes Pflänzchen" in ihr wachsen lassen: "Mein Religionslehrer hat uns mal gefragt, ob der Schnelle Brüter denn im Sinne der Schöpfung sei. Das habe ich nie vergessen." Umweltschutz bedeute eben auch, die Schöpfung zu bewahren, sagt die robuste Frau mit der Kurzhaarfrisur.
Sie boxt sich bis zum Abi durch
Löhrmann ist ein Kind des Ruhrgebiets. Ihr Elternhaus steht im sozialen Brennpunkt Essen-Borbeck, in der Nähe eine Zinkhütte. "Je nachdem wie der Wind ging, war auf einmal bei uns im Garten die Wäsche schwarz gesprenkelt", sagt sie und lacht. Die Eltern sind stramm katholisch, der Vater ist Prokurist, CDU-Wähler und Sozi-Hasser. Die Mutter ist Hausfrau. Der Vater stirbt, als Sylvia zwölf ist. Von da an nimmt sie ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie entscheidet sich gegen eine Lehre und boxt sich bis zum Abitur durch – finanziert mit Schülerbafög. Diese Jahre erklären auch, warum sie heute so leidenschaftlich gegen Studiengebühren kämpft.
In Bochum studiert Löhrmann Deutsch und Englisch auf Lehramt, anschließend unterrichtet sie an einer Solinger Gesamtschule. Es sind die frühen 80er Jahre, eine spannende, politisierte Zeit. Die Grünen, neu und frisch, werden von einer Protestbewegung zur parlamentarischen Macht. Da marschiert Löhrmann längst auf Friedensdemos, skandiert gegen Aufrüstung und Atomkraft, und für mehr Frauenrechte. Kein Wunder, dass sie sich für grünes Führungspersonal begeistert: "Petra Kelly, das war eine faszinierende Frau. Wie sie die Männerbünde in der Politik aufbrach, das hat mir imponiert." Löhrmann will das auch, sie tritt 1985 in die Partei ein. Ihre Themen: Frauen und Bildung. Schon vier Jahre später sitzt sie im Solinger Stadtrat.
Löhrmann ist keine Salongrüne
Heute wird die Vize-Ministerpräsidentin in spe von Eltern umzingelt. Deren Kinder werden in der Solinger Kita "Pinocchio" betreut, die 25. Geburtstag feiert. Es gibt eine Tombola, gedeckten Apfelkuchen - und eine Menge Probleme. Mit dem Geld für die Erzieher und mit den weiterführenden Schulen, die sich für Behinderte häufig erst bei Klagedrohungen öffnen. Löhrmann hört geduldig zu, dann sagt sie: "Da machen wir was." Die Eltern sind zufrieden, sie kennen Löhrmann lange und setzen auf sie. "Für 'ne Stadt wie Solingen is' die Frau 'ne absolute Bereicherung", sagt ein stämmiger Vater mit Rot-Weiß-Essen-Krawatte um den Hals. "Die weiß nämlich, wie et is', von Pumpe zu Pumpe zu laufen." Übersetzt heißt das: Sie weiß, mit Widerständen klarzukommen.
Löhrmann sitzt auf einer Bierbank und beißt in eine Bratwurst. Sie wischt sich den Senf aus dem Mundwinkel und sagt: "Na klar ist die Minderheitsregierung eine Herausforderung." Doch sie kenne sich aus mit knappen Mehrheiten, bereits im Solinger Stadtrat musste sie mit einer Ein-Stimmen-Mehrheit gestalten. Jetzt soll das auch im Landtag gelingen. Wenn nicht mit der Linkspartei, dann eben mit der CDU. Was die Auseinandersetzung mit politischen Gegnern angeht, scheint das Stahlbad der Kommunalpolitik sie abgekühlt zu haben. Löhrmann kann und will sich arrangieren. Schwarz-Grün war für sie stets eine Option, auch die Ampel hält sie weiter für möglich. Selbst mit dem Grünenfresser Gerhard Papke, FDP-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, kann Löhrmann Scherze machen. Sie ist keine Salongrüne, die im ideologischen Wolkenkuckucksheim Manifeste verfasst.
Kohle verdreckt den "Green New Deal"
"Desto mehr man sich erhöht, desto eher stürzt man ab", glaubt Löhrmann. Genau das sei dem abgewählten CDU-Ministerpräsidenten zum Verhängnis geworden: "Jürgen Rüttgers wollte zu viele Rollen spielen. Er hat ein Bild von sich inszeniert, das nicht stimmte. Das konnte nicht gut gehen." Dennoch ruft sie ihn an, denn Rüttgers hat an diesem Tag Geburtstag.
In Zukunft regiert an Rhein und Ruhr eine feminine Doppelspitze. Mit Hannelore Kraft verbindet Löhrmann "keine dicke Frauenfreundschaft, aber große Wertschätzung." Denn: "Sie pflegt einen ganz anderen Politikstil als die alte NRW-SPD. Leute wie Wolfgang Clement waren ja eher verbohrte Ideologen." Seit dem Koalitionsgeschacher duzen sich Kraft und Löhrmann. Vielleicht ist das eine gute Basis für die anstrengenden Verhandlungen, denn SPD und Grüne liegen in wichtigen Punkten über Kreuz. Die NRW-Grünen wollen einen "Green New Deal", einen ökologischen Neustart auf allen Ebenen. SPD-Gewerkschafter wie Guntram Schneider wollen zumindest teilweise an der dreckigen Kohle festhalten. Bei Löhrmann, einer Grünen aus dem Pott, könnten die Sozis auf Verständnis stoßen. Das wiederum könnte Einspruch aus Berlin provozieren. Und schon würde die Pragmatikerin in einem ideologischen Graben feststecken.
Rot-Grün in NRW gilt als Testlauf für ein neues Bündnis im Bund. Auch hier gibt es ein Führungs-Tandem, allerdings kein weibliches: Sigmar Gabriel und Jürgen Trittin schmieden schon Pläne für den Fall, dass die schwarz-gelbe Chaostruppe vorzeitig scheitert. Aber auch wenn NRW unter der bundespolitischen Lupe liegt: In der grünen Parteispitze bleibt Löhrmann ein Rätsel – weil sie weder Fundi noch Realo ist. "Viele erstaunt immer noch, wie weit ich es ohne Flügelzugehörigkeit gebracht habe." Dann läuft sie rasch zu ihrer Limousine. In flachen, spitzen Schuhen mit Kroko-Muster*, aus denen weiße Söckchen blitzen.
Der dicke BMW ist Sylvia Löhrmann nicht ganz koscher. Aber so einen Dienstwagen müsse man "rein funktional" betrachten, sonst sei sie ja "viel lieber mit dem Zug unterwegs." Ihr Fahrer schiebt hinterher: "Ist ja nur ein kleiner Diesel. Und überlegen Sie mal, wie viele Familien dank diesem Auto essen können!" Wegen der Arbeitsplätze und so. Löhrmann tippt da schon wieder was in ihr Smartphone. Im Kopf ist sie bereits beim nächsten Termin. Es wartet ein Verein, der sich für Grundschulkinder einsetzt. Löhrmann wird sich alles anhören. Und dann etwas tun. Für die Kinder, für die Bildung. Mit jedem, der ihr helfen will. Grün hin oder her.