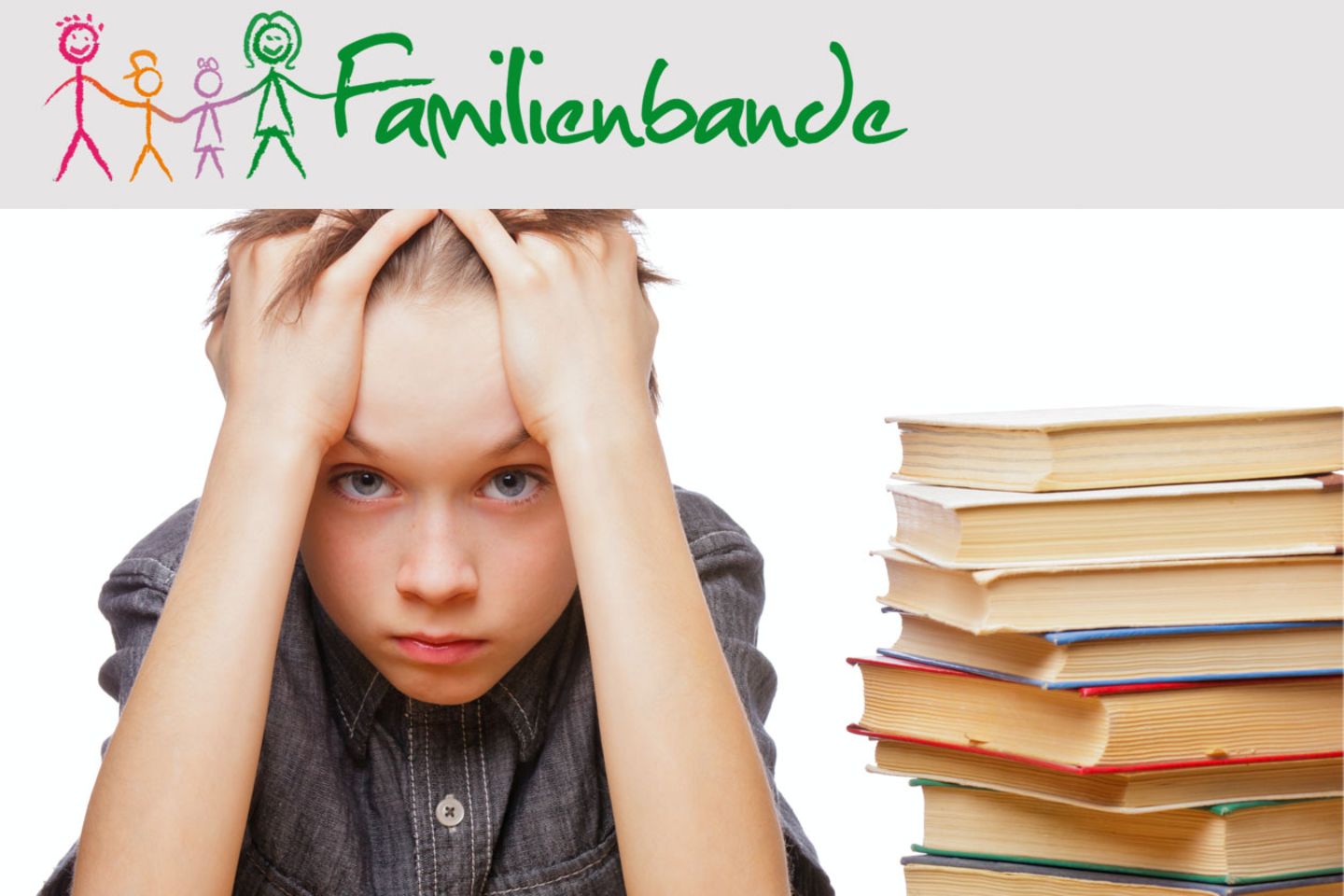Schule? Der Wahnsinn! Nehmen wir nur mal Emil, der in Wirklichkeit anders heißt. Emil ist elf Jahre alt und besucht in Berlin-Wilmersdorf die sechste Klasse. Er ist ein guter Schüler. Er hat bisher auch viel Glück gehabt mit seinen Lehrern, sie haben ihm seine Wissbegierde und den Spaß am Lernen nicht ausgetrieben. Das ist verdammt viel wert heutzutage und leider keine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem.
Emil geht in die Grundschule, die auch Vicco von Bülow besucht hat als Kind, später bekannt als Loriot. Es ist eine gute Schule, erst recht für Berliner Verhältnisse. Ähnlich absurd wie bei Loriot geht es aber auch dort zu. Futur zwei bei Sonnenaufgang. Dö dudl dö. Das ist nicht die Schuld der Schule. Es liegt an einer Krankheit, an der praktisch alle Bildungspolitiker aller Bundesländer aus allen Parteien leiden: chronische Reformitis im Endstadium. Das macht Schule zuweilen so unerträglich, für Lehrer, für Eltern und nicht zuletzt für die Kinder.
Willkommen im deutschen Schulsystem
Emil hat Saph hinter sich und JüL, Berliner Spezialitäten wie die sechsjährige Primarschule. Wir kommen noch drauf zurück. Auch auf MeNuK aus Baden-Württemberg. Jedes Land hat seine eigenen Experimente, bei denen Schüler als Versuchskarnickel missbraucht werden. Sind ja nur Kinder. Halten viel aus.
Im Sommer wird Emil aufs Gymnasium wechseln. Dann kommt G8. Vielleicht aber auch nicht. Wer auf der sicheren Seite sein will, soll an der Börse spekulieren, aber kein Kind ins deutsche Schulsystem stecken. Da ist nur sicher, dass nichts sicher ist. In Niedersachsen zum Beispiel krempeln sie gerade mal wieder alles um an den Gymnasien.
G8 und die Nebenwirkungen
Vor nicht einmal einem Jahrzehnt war das Turbo-Abi, in acht Jahren absolviert, das große Zauberding: rascher durch die Schule, fixer auf die Uni, früher auf den Arbeitsmarkt. Tolle Sache in Zeiten der Globalisierung und des internationalen Konkurrenzdrucks. Wollte jeder haben. G8 konnte gar nicht schnell genug durchgedrückt werden - mit allen Nebenwirkungen wie überfrachteten Lehrplänen, überforderten Lehrern, gestressten Schülern und genervten Eltern. Jetzt hat sich G8 einigermaßen eingespielt, aber in Hannover gibt es eine neue, rot-grüne Regierung, und es heißt: alles zurück. Reform retour. Aus acht mach neun. Beginn: nächstes Jahr. Zudem müssen die Schüler künftig nicht mehr so viele Kurse belegen und weniger Klausuren schreiben. Mehr Zeit, weniger Anforderungen. Schulpolitikerlogik.
Irre? Ja. Aber nur der Anfang. In Baden-Württemberg hat die rot-grüne Landesregierung 44 Modellgymnasien erlaubt, zu G9 zurückzukehren; diesen 44 Schulen rennen sie jetzt die Klassenzimmertüren ein. In Schleswig-Holstein konnten die Kommunen entscheiden, ob ihre Gymnasien in acht oder neun Jahren zum Abitur führen sollen. Hessen lässt den Schulen die Wahl. In Hamburg und Bayern wollen Eltern ihre Regierungen per Volksabstimmung zwingen, zu G9 zurückzukehren. Und in Nordrhein-Westfalen wünschen sich nach einer Umfrage des WDR 63 Prozent aller Bürger wieder das entschleunigte Abitur - Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) will nun prüfen, ob G8 noch "gesellschaftlicher Konsens" ist. Im Ernst.
Krieg ums Abitur
Nur im Osten herrscht Ruhe. Und in Rheinland-Pfalz, wo sie den Hype nicht mitgemacht haben; sehr gute Schüler können dort das Abi einfach etwas fixer bauen, der Rest bekommt achteinhalb Jahre Zeit. Eine pragmatische Lösung und deshalb eine große Ausnahme. Der gesunde Menschenverstand gehört nicht zu den Ratgebern, auf die Bildungspolitiker bevorzugt hören.
Aber Vorsicht, dieser Überblick über die Gefechtslage im Krieg um das Abitur zeigt den Stand von Anfang der Woche. Keine Garantie, dass sich daran nicht schon wieder etwas geändert hat. In der Schulpolitik wechseln die Verantwortlichen ihre Positionen derzeit schneller und häufiger als der HSV seine Trainer. Mit ähnlich überschaubarem Erfolg.
Hausaufgabenterror - Wenn Eltern Schulnoten aufpolieren
Noten sind zu wichtig, als das man sie den Kindern überlassen kann. Viele Eltern erledigen daher mit Eifer die Hausaufgaben ihrer Kinder. Auf der Strecke bleibt die Lust der Kinder am eigenständigen Lernen.
Willkommen in Absurdistan
Dabei sollte die Pisa-Studie, die zuerst 2001 Deutschland die Mittelmäßigkeit seines vermeintlich so großartigen Bildungssystems drastisch vorgeführt hatte, doch Konsequenzen haben. Das Durcheinander sollte aufgeräumt werden, weil jedes Bundesland seins machte und keiner mehr durchblicken kann bei 2500 Lehrplänen, rund 100 Schultypen, Sekundar-, Ober- und Stadtteilschulen, mal Noten, mal keine. Einheitliche Curricula, miteinander verabredete Bildungsstandards, ähnliche Systeme, gleichwertige Abschlussprüfungen: Nach Pisa sollte alles besser werden. Und nicht zuletzt auch einfacher, mit schulpflichtigen Kindern von einem Bundesland ins andere zu ziehen, ohne deswegen gleich in eine Lebenskrise zu stürzen. Das Vorhaben ist gründlich missraten. Momentan sind die deutschen Schulpolitiker wieder auf dem Weg zurück in die bildungspolitische Kleinstaaterei. G8, G9, G8,5. Rin in die Kartoffeln. Raus aus die Kartoffeln. Ohne erkennbar schlechtes Gewissen. Künftig könnte es für Gymnasiasten "schon schwierig werden, innerhalb Frankfurts die Schule zu wechseln", fürchtet Karin Hechler.
Frau Hechler ist eine erfahrene Pädagogin. 64 Jahre, Leiterin der Schillerschule in Frankfurt. Am Donnerstag voriger Woche sitzt sie mit zwei Kollegen abends auf einer Bühne in der Aula ihrer Schule, vor sich 200 Eltern, deren Kinder in die sechste oder siebte Klasse gehen. Die drei Lehrer wollen erklären, wie es weitergehen könnte für ihre Söhne und Töchter an der Schillerschule. So nämlich: Entweder es bleibt alles, wie es ist, aber ab der fünften Klasse gilt künftig wieder G 9. Oder die Klassen sechs und sieben wechseln ebenfalls komplett von G8 zu G9. Oder, und nun wird es kompliziert, die Eltern entscheiden sich nicht eindeutig; dann werden in den beiden Stufen Klassen eingerichtet, die entweder in acht oder in neun Jahren zum Abi führen. Sollte es so beschlossen werden, würde es 2019/20 wieder einen doppelten Abiturjahrgang geben, weil sich die schnellen Sechstklässler und die langsamen Siebtklässler in der Oberstufe treffen würden. In der Mittelstufe sei das kein Problem, versichert die Direktorin. In der Oberstufe "kann es aber passieren, dass wir dann nicht mehr alle Leistungskurse anbieten können".
Manche Eltern unten in der Aula schreiben eifrig mit, andere tuscheln: "Hast du das verstanden?" Schule? Wahnsinn. Willkommen in Absurdistan. Später stimmen die Eltern ab, geheim natürlich. Von den 77 Eltern der sechsten Klassen votieren 64 für G 9. In den siebten ist eine knappe Mehrheit für G8: 46 zu 42.
Es allen Recht machen geht nicht
Nein, es ist nicht leicht, eine Schule zu leiten, in der alle Eltern nur das Beste für ihr Kind wollen, das aber auf sehr unterschiedliche Weise. Auch das und die Angst der Politiker vor der Strafe erzürnter Eltern bei Wahlen trägt erheblich dazu bei, dass unser Schulsystem so ist, wie es ist. Allen Menschen Recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann - das alte deutsche Sprichwort trifft auf kaum einen anderen Bereich so gut zu wie auf die Schulpolitik.
Karin Hechler hat sich in den vergangenen Jahren übrigens, wie sie zugibt, "vom Saulus zum Paulus" gewandelt. Als das Turbo-Abi eingeführt wurde, war sie eine glühende Verfechterin von G8; sie meldete ihr Gymnasium sogar als Pilotschule an. Dann kam die Praxis, und die Pädagogin erlebte, wie der Druck auf die Kinder wuchs, wie wenig Freizeit und Freiraum ihnen blieb, wie der Schulstoff zusammengestrichen und zusammengepresst wurde. Das hatte sie nicht gewollt. Woran es bei G8 krankt, woran es den Schülern fehlt, kann die Schulleiterin in zwei Sätzen zusammenfassen: "Ich kann stopfen. Aber reifen lassen braucht Zeit."
Mit Mama oder Papa zur Uni
Emils Vater kann diesen Satz nur unterstreichen. Wenn alles normal läuft, wird sein Sohn in sechs Jahren Abitur machen. Er wird dann 17 Jahre alt sein, ziemlich genau zwei Jahre jünger, als sein Vater war, als der die Schule abschloss. Emil ist der Jüngste in seiner Klasse. In Berlin schulen sie die Kinder mit fünf Jahren ein. Abitur nannte man auch einmal Reifeprüfung. Der Abiturient Emil wird mit seinen 17 Jahren zwar studieren dürfen, aber nicht wählen, nur in Begleitung eines Erwachsenen ein Auto fahren, keine Verträge schließen. Zum Einschreiben an der Uni wird er seinen Vater oder seine Mutter mitbringen müssen, die müssen für ihn unterschreiben. Salome, dem Patenkind seiner Mutter, ist es im Herbst in Heidelberg genau so ergangen. Auch sie war noch nicht volljährig.
Wer einmal eine leidenschaftliche Tirade hören will darüber, was Schüler durch das abgezwackte Jahr alles verlieren, der muss nach Vilsbiburg in Bayern fahren zu Josef Kraus. Kraus ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, und anders als seine Frankfurter Kollegin Hechler von Anfang an gegen das, was die Zeitdiebe aus der Politik angerichtet haben. Man hat kaum G8 gesagt, da legt Kraus auch schon los. "Für 17-Jährige ist ein Jahr unheimlich viel Zeit, ein Zehntel ihres bewussten Lebens. Das ist eine Phase, wo wahnsinnig viel passiert, am Übergang von der Pubertät zum Erwachsensein. Dieses Jahr fehlt den G-8-Abiturienten einfach. Die sind eben nicht nur ein Jahr jünger, sondern auch ein Jahr weniger reif."
Das Problem mit G8 haben Eltern
Man müsse, sagt Kraus, in der Schule auch "übernützliche Dinge" lernen. "Wieso denn heute noch Faust und Shakespeare lesen?, das fragen inzwischen sogar Elternvertreter. Ja, wenn man eine völlig dekultivierte Schule will, dann schmeißt man das alles raus, das ist dann aber nicht mehr meine Vorstellung von umfassender Bildung."
Fack ju, Göte! Und diesen Meckbess gleich mit. Das Kuriose ist: Spricht man mit Schülern, scheinen die viel weniger Sehnsucht nach dem verschwundenen Schuljahr zu haben als ihre Eltern. Und auch deutlich weniger unter G8 zu leiden. Muße und Erfahrungen, die sie dadurch verlieren, holen sie sich auf anderem Wege zurück: Sie gehen nach dem Abi erst mal ins Ausland, machen Bundesfreiwilligendienst, jobben, faulenzen oder probieren mal einen Studiengang aus. Sie haben ja Zeit gewonnen. So unterlaufen sie die Idee, die hinter G8 stand: die langsamen Deutschen schneller ins Berufsleben und auf die Einzahlerseite der Sozialkassen zu bugsieren. Eine ganz normale Reaktion. Man hätte damit rechnen können.
Lehrinhalte statt Strukturen diskutieren
"Die Kinder fühlen sich wohl in der Schule, deutlich wohler als früher", sagt Manfred Prenzel. Der Professor leitet die deutsche Pisa-Studie. Die Gymnasien sind nicht schlechter geworden, obwohl heute zehn Prozent mehr Schüler Abitur machen als vor zehn Jahren, hat Prenzel festgestellt. Er rät deshalb zu mehr Gelassenheit in der Diskussion um das Turbo-Abi: "Statt wieder über die Schulstruktur zu diskutieren, sollten wir über die Lehrinhalte und die Qualität des Unterrichts streiten."
Tatsächlich ist G8, G9, G8,5 nur ein Problem von vielen, wenngleich derzeit das größte. Es gibt so viel mehr, was im Argen liegt, woran Eltern sich gewöhnt haben, gewöhnen mussten. Das fängt bei maroden Toiletten in baufälligen Schulgebäuden an, geht bei Putzaktionen in Klassenräumen weiter, die immer nur oberflächlich gesäubert werden können, weil das Budget für den Putztrupp nicht mehr hergibt, und es hört noch lange nicht auf bei 9,8 Kilo schweren Schulranzen (nachgewogen, echt!), die Fünftklässler Tag für Tag auf dem Buckel nach Hause schleppen, weil die Schulsachen nicht im Klassenzimmer deponiert werden können/dürfen/sollen (nicht Zutreffendes bitte streichen). Und da haben wir noch nicht von zu großen Klassen gesprochen, vom sich häufenden Unterrichtsausfall, den aus Kostengründen jahrelang nicht besetzten Rektorenstellen, einer Betreuung in hurtig gegründeten Ganztagsschulen, die eher Aufbewahrung genannt werden sollte, nicht von der trotz allen Herumdokterns an den Lehrmethoden weiterhin haarsträubenden Rechtschreibschwäche vieler Schüler und auch nicht von dem merkwürdigen Zufall, dass jeder Lehrer in seinem Fach in den letzten beiden Tagen vor den Ferien noch eine Arbeit schreiben lassen muss. So lernen Schüler wenigstens, wie wichtig es im Leben wäre, sich abzustimmen.
Die Idee vom Schulessen
Schule? Ist schließlich auch der alltägliche Wahnsinn im Kleinen. Die folgende Geschichte spielt in Hamburg, sie könnte aber ebenso gut in Berlin spielen, in Bochum, Buxtehude oder Berchtesgaden. Das Chaos ist überall. Also: Jonas ist 12, Siebtklässler an einem Gymnasium. Das unterhält seit Kurzem eine Kantine, in der die Schüler zu Mittag essen können. Eine gute Sache, wenn es immer öfter Unterricht bis in den Nachmittag hinein gibt. Das Essen liefert ein Caterer, der vom Elternrat liebevoll ausgesucht wurde: gesunde Kost und trotzdem nicht zu teuer. Damit er kalkulieren kann, müssen die Kinder das Essen allerdings einen Tag im Voraus aussuchen und bezahlen.
So weit die tolle Idee. Und jetzt zur Praxis. Wenn alle Kinder gleichzeitig zum Mittagessen kommen, ist die Kantine zu klein. Weil es aber feste Pausenzeiten gibt, spurten nun mal alle los, sobald es klingelt. Wer zu spät kommt, steht in einer endlosen Schlange, bekommt keinen Sitzplatz – und geht einfach wieder.
Ständig irgendwelche Probleme
Blöd außerdem, dass immer wieder mal Unterricht kurzfristig ausfällt und die Kinder nach Hause gehen - ohne das bezahlte gesunde warme Essen. Als Ersatz gibt es tags darauf ein Croissant oder einen Müsliriegel. Die Folge: Es bestellen immer weniger vor, der Umsatz des Caterers sinkt. Ändert sich nichts, ist er wieder weg. In mehreren Konferenzen arbeiteten Schulleitung und Elternrat an einer Lösung: Alle Eltern werden eindringlich gebeten, ihre Kinder doch bitte, bitte wieder mehr vorbestellen zu lassen.
Alles nicht wirklich schlimm. Nur eine kleine Widrigkeit im deutschen Schulalltag. Eine von vielen kleinen Widrigkeiten, die sich aber summieren. Ständig ist irgendetwas, ständig müssen sich Eltern von Schulkindern mit Problemen herumschlagen, die es eigentlich nicht geben dürfte und die bei vielen den Eindruck verfestigen: Scheiß Schule!
Wahnsinn, Widerstand oder Flucht
Und manche Entscheidung der Schulbehörden ist schlicht: unfassbar. Emils frühere Babysitterin ist inzwischen Lehrerin. Zum Referendariat musste sie nach Schleswig- Holstein, in Berlin gab es keine Stelle. Als Junglehrerin wurde sie dann mit Handkuss eingestellt - und in eine Schule mit 90 Prozent Migrantenanteil geschickt. Jetzt steht sie vor Pubertisten, die ihre Frage, wer denn schon mal freiwillig ein Buch zu Ende gelesen habe, mit Blicken beantworten, als hätte sie wissen wollen, wer hier gern Schweineschnitzel isst. Wir reden übrigens von einem Gymnasium. Eigentlich sollte man Bruce Willis in solche Klassen schicken. Die besten Pädagogen, die man finden kann. Keine Anfänger. Es ist schade um jeden Schüler, der wegen unfähiger oder überforderter Lehrer die Lust am Lernen verliert. Genauso ein Jammer ist es aber, wenn junge Lehrer zerschlissen und zermürbt werden, weil man sie an der falschen Stelle einsetzt, aus Gedankenlosigkeit oder Blindheit oder einer generellen LMAA-Haltung.
Das Schlimmste ist, man fühlt sich als Teilnehmer am immerwährenden deutschen Schulexperiment den großen Problemen und kleinen Widrigkeiten nahezu hilflos ausgeliefert. Die real existierende Schulmisere treibt inzwischen immer mehr Eltern in den Wahnsinn, in den Widerstand - siehe G8 - oder zur Flucht aus dem staatlichen Schulsystem in private oder halb private Schulen. Dabei galt es mal als die vornehmste und wichtigste Aufgabe des Staates, alles für die Zukunft der Kinder zu tun und sie bestmöglich auszubilden. Wenigstens gleiche Startchancen für alle zu bieten. Davon entfernen wir uns immer weiter. Dabei sollte Bildungspolitik eigentlich dazu beitragen, eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern - und nicht dazu, diese noch zu vergrößern.
Die Win-Win-Theorie
Wer im staatlichen System bleibt, muss jedenfalls eines sein: leidensfähig. Er braucht Geduld, Langmut, Improvisationstalent und die Fähigkeit, auch mal zu lachen, wenn es eigentlich zum Heulen ist. Anders ist es kaum auszuhalten. Nehmen wir die Sache mit JüL, dem Jahrgangsübergreifenden Lernen in der Saph, der Schulanfangsphase. Schulpolitiker schätzen Abkürzungen, die sich nur Insidern erschließen. Sie klingen außerdem schwer bedeutungsvoll. In der Praxis bedeu tet JüL, dass eine Klasse jeweils zur Hälfte aus Erst- und Zweitklässlern gebildet wird. Die Kleinen sollen sich an den Großen orientieren, diese umgekehrt ihr bereits erworbenes Wissen als kleine Hilfslehrer weitergeben und auf diese Weise selbst besser einüben. Win-Win, in der Theorie. Die Schule, die Emil in Berlin besuchte, zweifelte allerdings - mit einigem Recht - an der segensreichen Wirkung dieser Reform und führte sie erst ein, als die Schulverwaltung ihr keine Wahl mehr ließ. Da kam Emil ins zweite Schuljahr. Seine Klasse wurde geteilt und mit Erstklässlern aufgefüllt. Viel gelernt hat Emil in diesem Schuljahr nicht. Später sagte seine Lehrerin, die nicht für JüL ausgebildet war, die Zweitklässler hätten schon darunter gelitten, dass sie sich stark um die Erstklässler kümmern musste, aber Emil und die anderen seien ja glücklicherweise kluge Kinder, die würden das schnell nachholen. Win-Lose. Im dritten Schuljahr wurden die ursprünglichen Klassen wieder zusammengefügt. Kurz darauf haben sie JüL als Pflicht wieder abgeschafft. Es funzte nicht so richtig.
MeNuK oder Handarbeit und Werken? Was G8 im Großen, ist JüL im Kleinen. Überstürzt eingeführt, nicht ordentlich getestet, mit hohen Erwartungen überfrachtet, mit dicken Versprechungen verkauft - und krachend gescheitert. Eine typische deutsche Schulreformgeschichte. Auch hier gilt: Diese Geschichte spielt in Berlin, sie könnte aber auch in Bayern, Bremen - oder sogar in Baden-Württemberg spielen. In Baden-Württemberg gab es mal Musikunterricht an den Grundschulen. Und Kunst. Und Handarbeit und Werken. Und Sachunterricht. Das alles war irgendwann nicht mehr schick und wurde abgeschafft und ersetzt durch ein Fach namens - Obacht - MeNuK. Dahinter verbirgt sich Mensch, Natur und Kunst. Jetzt, nach zehn Jahren, schaffen sie das wieder ab, es wird ersetzt durch: Musik. Kunst. Handarbeit und Werken. Sachunterricht. Rin in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück.
Schule braucht Ruhe und Beständigkeit
Es gibt einen simplen Grund für diese Reformitis: Neben der Schulpolitik ist den Ländern kaum etwas geblieben, worüber sie frei entscheiden können. Deshalb toben sich die Landespolitiker auf diesem Feld so gern aus. Föderalismus bizarr.
Falls übrigens jemand einen Kultusminister kennt, der politisch richtig aufgestiegen und zum Beispiel Ministerpräsident geworden wäre – bitte melden. Schulpolitik ist zwar wichtig, genießt aber keinen guten Ruf. Daher will kaum jemand in den Bildungsausschuss. Dort landen oft diejenigen, die keinen Platz in den Gremien mit höherem Renommee ergattern konnten. Das muss nicht an ihrer Durchsetzungs- und sonstigen Fähigkeit liegen. Kann es aber. Eine plausible Erklärung für das Gestümpere wäre es zumindest.
Nein, früher war nicht alles besser. Und ja, Schule und Unterricht müssen mit der Zeit gehen, immer wieder verändert werden. Was aber spricht dagegen, mal Experten zu fragen, bevor man sich ans Reformieren macht? Beim Turbo-Abi passierte in dieser Hinsicht: so gut wie nichts. G8 sei ohne wissenschaftliche Vorkenntnisse eingeführt und "wenig systematisch begleitet" worden, sagt der Bildungsforscher Marko Neumann. Es sollte vor allem eins: schnell gehen. Genauso schnell und unüberlegt wird heute wieder ausgestiegen.
Schule? Der Wahnsinn! Dabei könnte es so einfach sein. Manfred Prenzel, Leiter der deutschen Pisa-Studie, kann in nur fünf Worten sagen, was unser Bildungssystem sofort verbessern würde: "Schule braucht Ruhe und Beständigkeit." Das ist ein schöner, klarer wahrer Satz. Er eignete sich gut für Strafarbeiten. Jeder einzelne Bildungspolitiker sollte ihn abschreiben müssen. 100 Mal. Jeden Tag. Schule braucht Ruhe und Beständigkeit. Schule braucht Ruhe und Beständigkeit. Schule braucht Ruhe und Beständigkeit. Schule braucht Ruhe … Vielleicht hülfe es ja was.