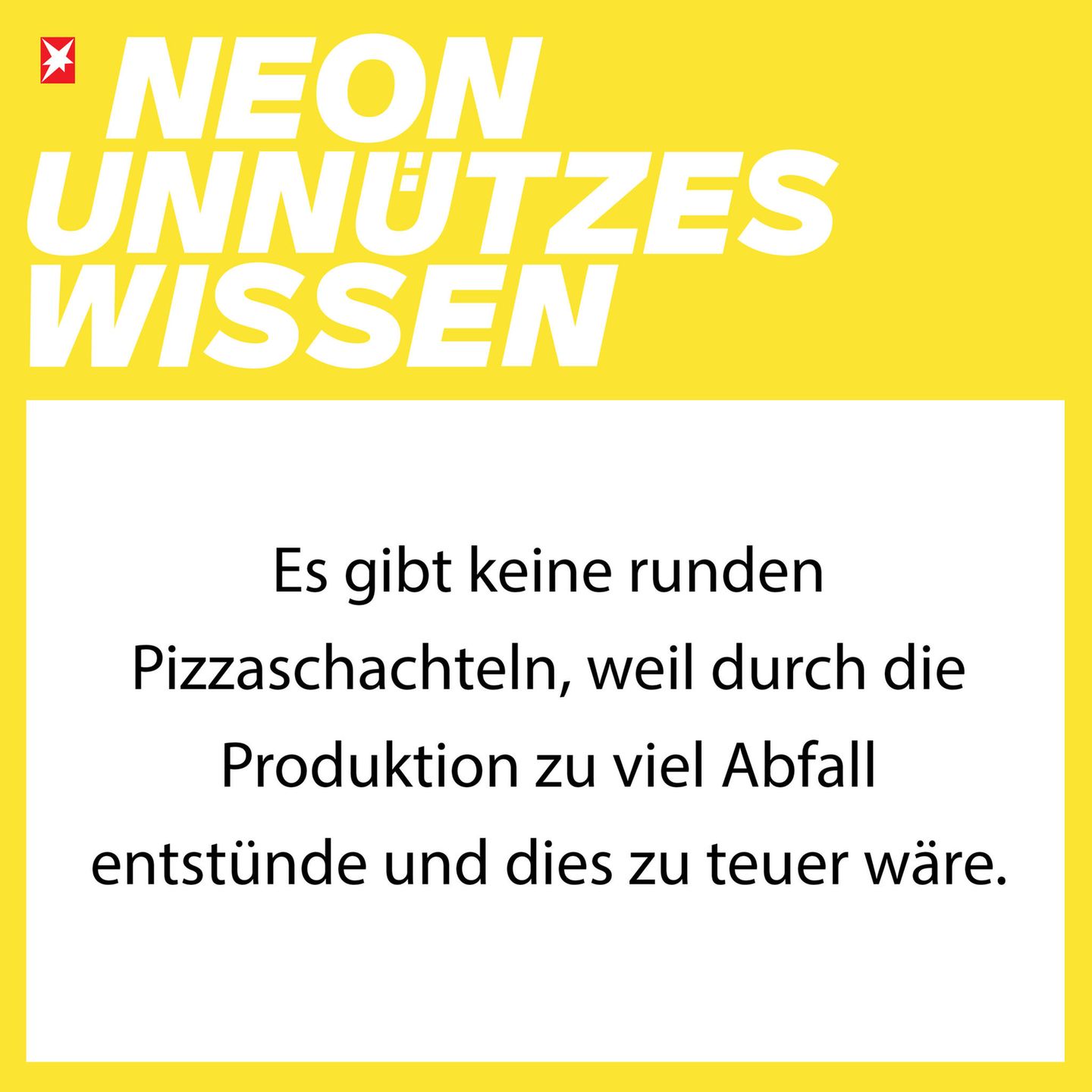Herr Buchholz, es heißt ja immer wieder, in der Textil-Verwertung herrsche Goldgräberstimmung. Weil die Altkleider-Berge einfach immer größer werden?
So einfach ist das leider nicht. Die Branche ist gerade total im Wandel und er hat erst begonnen. Das Geschäft wurde vor etwa 40 Jahren von Straßenhändlern gegründet - die haben sich anfangs sicher eine goldene Nase verdient. Seit einigen Jahren ist das aber anders.
Inwiefern?
Bis 2012 hat man die gesammelte Ware einfach sortiert und geliefert, die Qualität war eher zweitrangig. Die Nachfrage in Osteuropa, im Nahen Osten oder Afrika war viel höher als das Angebot. In Afrika zum Beispiel, unter der Sahel-Zone, sind nahezu 85 Prozent aller Textilien Gebraucht-Textilien. Jetzt gibt es mehr Altkleider auf dem Markt, das bedeutet viel mehr Auswahl.
Weil es durch die oft beschriebene Fast-Fashion-Industrie so viel mehr weggeworfene Kleider gibt?
Genau. Hinzu kommt aber, dass die Qualität der Ware insgesamt abgenommen hat. Die Sachen sind der Mode unterworfen und die wechselt schnell. Sie müssen heute nur ein-, vielleicht eineinhalb Jahre halten. Früher waren es eher fünf bis acht Jahre.
Was bedeutet das im Alltag für Sie?
Die qualitativ hochwertige Ware, das Creme-Produkt wie wir es nennen, ist seltener geworden. In den letzten zehn Jahren minus 30-40 Prozent. Das bedeutet für uns weniger Verkaufserlöse.
Heißt das, Sie leiden mehr unter dem Qualitätsverlust als dass Sie vom Wachsen der Kleider-Masse profitieren?
Ja, ein Großteil der Tätigkeiten muss bei uns von Hand geschehen. Dieses genaue Sortieren nach Qualität, nach modischem Wert, das kann keine Maschine. Es ist schwer ein Geschäft profitabel zu gestalten, das fast zu 100 Prozent Handarbeit "Made in Germany" ist. Viele unserer Wettbewerber, die in Deutschland sammeln, sortieren deshalb in Polen, Bulgarien und Rumänien. Aber nicht nur wegen der Kosten. Unsere Branche bekommt in Deutschland kaum neue Mitarbeiter. Der Sortierjob ist hart, nur wenige wollen ihn machen.
Firmen wie Soex stehen oft in der Kritik, weil sie mit aussortierten Kleidern Geschäfte machen...
Ja, nur warum eigentlich? Das wüsste ich wirklich gerne. Irgendjemand muss sich schließlich um die riesigen Abfall-Berge kümmern. Altglas-Entsorgern wird, soweit ich weiß, nicht vorgeworfen, dass sie ihren Lebensunterhalt mit der Verwertung abgegebener Flaschen verdienen. Oder Schrott- und Papierentsorgern.
Warum also der schlechtere Ruf der Textilverwerter?
Ich glaube, viele wissen nicht, dass wir als Textilverwertungs-Firma für alle Altkleider bezahlen. Wir mieten entweder Containerstellplätze und überweisen der Stadt dafür Geld. Oder wir kaufen dem Deutschen Roten Kreuz und anderen gemeinnützigen Organisationen die Ware ab, die sie nicht für ihre Kleiderkammern verwenden können und das Geld finanziert dann deren gemeinnützige Projekte.
Viele Menschen denken und wollen, dass die Kleider, die sie abgeben, an Bedürftige gehen.
Vor meiner Zeit im Geschäft war ich auch überzeugt, dass alles, was ich abgebe, die Bedürftigen um die Ecke bekommen. Tatsache ist aber, dass bei ihnen nur zwei bis drei Prozent landen, weil es einfach zu viele Alttextilien gibt. Diese zwei bis drei Prozent reichen aus, um jeden Bedürftigen in Deutschland zu versorgen. Und die restlichen Altkleider erfüllen einen weiteren guten Zweck. Für das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel ist die Altkleidersammlung eine wichtige Einnahmequelle, es sind durchaus zweistellige Millionenbeträge im Jahr, die Soex und andere Wettbewerber insgesamt überweisen.
Seit ein bis zwei Jahren ist immer wieder von Textil-Recycling die Rede. Lohnt sich das denn überhaupt?
Noch nicht! Aber das kommt, da bin ich ganz sicher. Es ist noch ein relativ neues Thema. Als ich 2014 hier anfing, hat darüber noch niemand gesprochen, es war nicht auf der Agenda. Aber in den letzten Jahren sind eben die Kleidermassen dramatisch gestiegen. Auch die Menschen in Ländern wie China, Brasilien, Indien konsumieren heute viel mehr Mode und wechseln alle paar Monate ihre Garderobe. Irgendwas müssen wir mit all den Kleidern doch machen.
Wie funktioniert das Recycling von Textilien denn im Moment?
Wir unterscheiden dabei zwischen Open Loop und Closed Loop. Open Loop heißt, wir versuchen alles, um den Artikel weiter verwenden zu können, nur eben nicht als Kleidungsstück, sondern zum Beispiel als Dämmstoff. Der Closed Loop ist natürlich der Idealfall. Das bedeutet, dass wir tatsächlich die Fasern in die Spinnereien zurückbringen und dass daraus wieder ein Kleidungsstück entstehen kann.
Wie viele Closed Loops gibt es denn bei Ihnen im Moment?
Das ist gerade noch sehr schwierig. Es gibt 100 verschiedene Kunstfasern, Baumwolle, Kaschmir-Anteile... Wenn sie fünf Kleidungsstücke nebeneinanderlegen hat keines dieselbe Material-Zusammenstellung. Aber damit wir reine Fasern zurückgewinnen, die man wieder verarbeiten kann, müssen wir alle Materialien trennen. Unsere Leute müssen die einzelnen Teile also genau prüfen und richtig einschätzen: Ist es ein Artikel aus reiner Baumwolle, enthält er 20 Prozent Kaschmir und so weiter. Das ist fast unmöglich. Wir haben in den letzten zwei Jahren jeweils etwa 2000 Tonnen an tatsächlichen Fasern zurückgeliefert an unsere Kunden, unter immensem Aufwand. Statistisch gesehen mussten wir für diese 2000 Tonnen über 100.000 Tonnen Material sammeln.
Das klingt ziemlich unprofitabel.
Ist es momentan auch noch. Wir arbeiten natürlich an Material-Erkennungssystemen, die sich in der Zukunft einsetzen lassen. Nur wenn es uns gelingt, maschinell große Mengen Material zu trennen, zu ordnen und zu sortieren, kann es sich lohnen. Sonst sind wir mit Recycling-Fasern gegen neue Kunstfasern und die Naturfasern nicht wettbewerbsfähig.
Sollten wir nicht einfach weniger konsumieren und weniger wegwerfen?
Klar, das wäre eine Lösung. Aber diese ganze Diskussion bringt doch nichts. Viele können es sich leisten, keine Fast Fashion zu kaufen. Andere aber nicht. Außerdem ist es noch nie gut gelungen, den Menschen vorzuschreiben, was sie wie und wo kaufen sollen. Es funktioniert nicht. Der Mensch möchte das kaufen, was er scheinbar braucht und worauf er Lust hat.
Die Politik muss das eben mit klaren Regeln einfordern.
Aber was soll sie denn für Regeln aufstellen? Bitte nur noch vier Kollektionen im Jahr herstellen? Das wird nicht funktionieren. Subventionen sind eine Möglichkeit. Da können wir von unseren Nachbarn lernen. In Frankreich gibt es Eco TLC. Jeder Textilhändler, der ein Produkt in den Laden bringt, zahlt eine Abgabe dafür. Das Geld fließt in eine Non-Profit-Organisation und die kümmert sich um die sachgerechte Weiterverwendung. So etwas kann die Politik fördern.
Aber dennoch dient die recycelte Faser wieder dazu, noch mehr Kleider herzustellen. Den Konsum bremst das nicht.
Nein, wie gesagt, der Mensch möchte kaufen, wenn er Lust hat und wir müssen uns konstruktive Lösungen überlegen. Und das Recycling ist eine davon. Es gibt eine Studie der Boston Consulting Group, die besagt: Wenn in den nächsten 15 Jahren die Kleiderproduktion weiter so wächst, wie in den letzten 15 Jahren, dann sind 2030 nicht mehr genug natürliche Rohstoffe vorhanden, um den Bedarf zu decken.
Das heißt, wir sind auf recycelte Materialien angewiesen?
Ja! Baumwolle, Kaschmir, da ist einfach irgendwann Ende. Recycling ist die Zukunft, davon bin ich übezeugt. Und deshalb investieren wir auch in die Entwicklung und Implementierung neuer Recyclingmethoden.