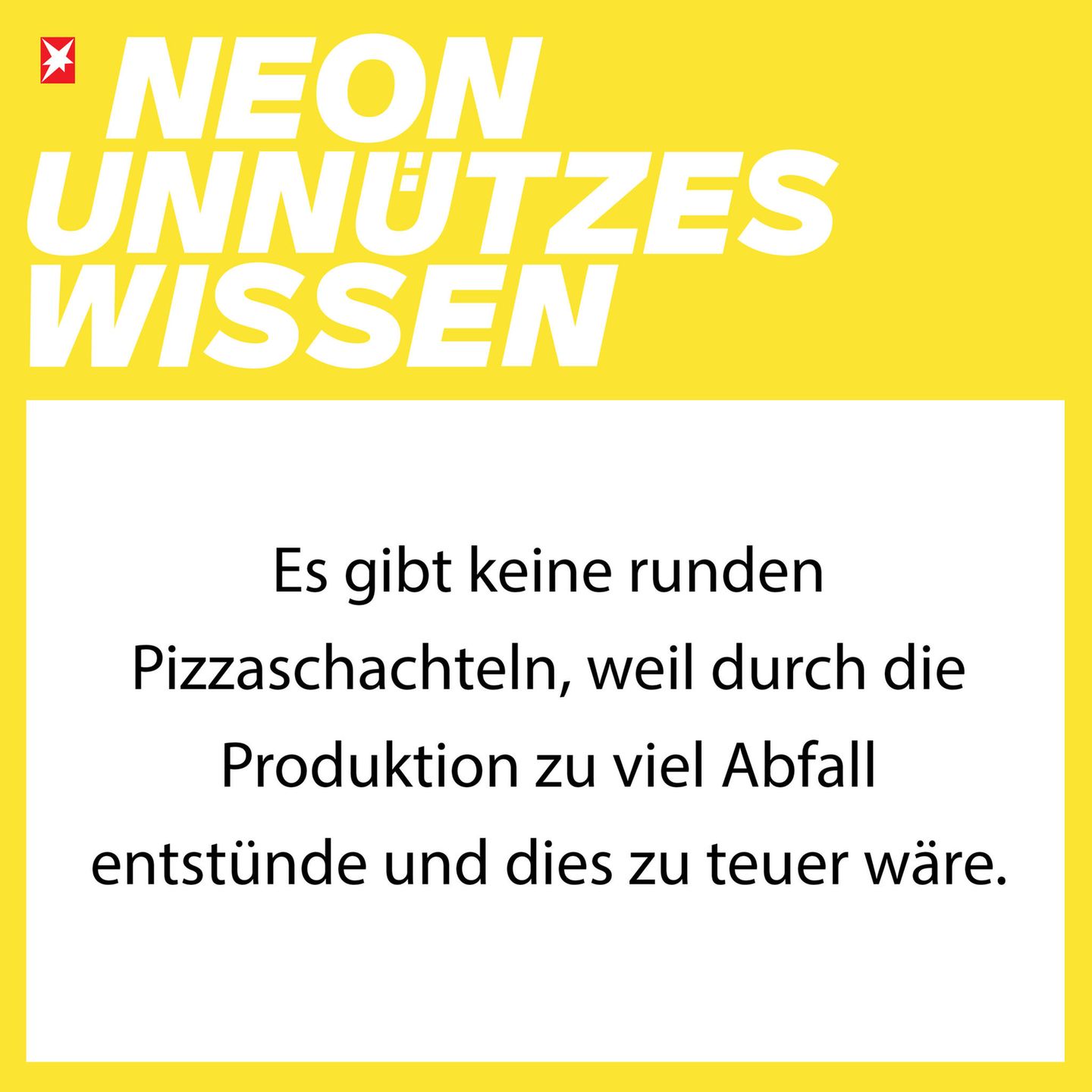Es gibt so viel zu fühlen bei einer Flasche. Da ist die Größe, das Material – ist sie aus Glas oder Kunststoff, hat sie dünne oder dicke Wände, und vor allem: welche Form? Uwe Tröger erkennt "seine Flaschen" sogar im Dunkeln. Die, mit denen sich Geld verdienen lässt, die dünnwandigen Einwegflaschen aus Plastik. Da sind bis zu 25 Cent pro Stück drin. "Das sind die wichtigsten, die heiligen Flaschen", sagt er.
Für die einen sind Flaschen Abfall. Weg damit, in den nächsten Mülleimer, am Flughafen etwa, bevor es durch die Sicherheitsschleuse geht und man ohnehin alle Flüssigkeiten abgeben muss. Für Uwe Tröger ist so eine Flasche Teil seines Einkommens. Der 50-Jährige arbeitet am Hamburger Airport für das Projekt "Spende dein Pfand" als Wertstoffbeauftragter, so heißt seine Position dort. Pfandsammler möchte er nicht genannt werden. "Das klingt ja so, als hätte ich keinen Job." Den hat er aber. Uwe Tröger ist fest angestellt, er bezieht Mindestlohn, sein Arbeitsvertrag ist unbefristet. Er lebt von dem, was andere Menschen wegwerfen: Plastikflaschen und Pfanddosen.

Das Projekt entstand aus einer Notlage
"Spende dein Pfand" startete im September 2015 in Zusammenarbeit mit dem Flughafen, dem Straßenmagazin "Hinz&Kunzt" und dem Grünen Punkt. Uwe Tröger war von Anfang an dabei. Das Prinzip ist einfach: Neun durchsichtige Plastiktonnen stehen vor den Sicherheitskontrollen des Flughafens. Passagiere können darin ihre Pfandflaschen entsorgen. Ist eine Tonne voll, kommt Tröger mit einer Sackkarre vorbei, aufladen, in ein Nebengebäude karren, sortieren. Das Einwegpfand packt er in große Säcke, die Mehrwegflaschen räumt er in Kästen. "Das ist dann ein bisschen so, als würde ich Fässer mit Geld durch die Gegend rollen."
Das Projekt entstand aus einer Notlage heraus: Gesucht wurde eine Lösung für die Pfandflut am Flughafen. Pro Tag reisen hier Zehntausende Passagiere ab und hinterlassen ihre Wasser- und Limoflaschen. Früher landeten die einfach im Restmüll, kamen in die Müllverbrennungsanlage, wurden verheizt. Nun finanziert der Pfanderlös dreieinhalb Arbeitsplätze – drei Pfandbeauftragte und eine studentische Hilfskraft. Allein im vergangenen Jahr sammelte das Team über eine halbe Million Flaschen, die jetzt auch nicht mehr die Abfalleimer verstopfen. Win-win, würde man in der Wirtschaft sagen.
Früher war Uwe Trögers Leben ein anderes. Da hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, er machte eine Lehre zum Fleischer, half bei Umzügen oder beim Messebau. Dann wurde er arbeitslos. Die Mitarbeiter im Jobcenter rieten ihm, die Erwerbsunfähigkeitsrente zu beantragen. Er sei aufgrund seiner psychischen Verfassung nicht mehr in der Lage zu arbeiten. "Das konnte ich widerlegen", sagt er und zeigt die Flughafenmitarbeiterkarte, die er an einem Band um den Hals trägt. "Jetzt haben sie mich hier an der Backe. Bis zur Rente."

Pfandsammeln ist Folge der Armut
Fragt man den zuständigen Projektverantwortlichen des Flughafens, Johannes Scharnberg, nach den Erfahrungen mit "Spende dein Pfand", spart dieser nicht mit Lob: "Die vier Mitarbeiter sind beliebt und aus unserer Airport-Family nicht mehr wegzudenken", sagt der Leiter des Geschäftsbereichs Aviation. "Auch bei Fragen nach Gates oder Terminals helfen sie unseren Passagieren immer gerne weiter."
Uwe Tröger kam sozusagen als Experte dazu. Er hat schon früher Pfandflaschen gesammelt – an den Landungsbrücken am Hamburger Hafen, einem Hotspot für Touristen. "Das ging zu der Zeit noch ganz gut", erinnert er sich. Mittlerweile seien aber viele Sammler unterwegs, das Geschäft lohne sich kaum noch.
Die Flut von Pfandsammlern sei ein Zeichen von Armut, sagt Stephan Karrenbauer, Sozialpädagoge beim Straßenmagazin "Hinz&Kunzt": "Man kann heute nicht mehr sagen: 'Das machen nur die Obdachlosen'", erklärt er, "Heute sammeln auch Rentner, Früh-Rentner oder Osteuropäer." Nicht bei allen stehe dabei der Geldaspekt im Vordergrund. "Einige sehnen sich auch nach einem geregelten Tagesablauf, nach einer sinnvollen Aufgabe. Einfach mal wieder unter Menschen zu kommen."
Uwe Tröger steht vor den Sicherheitskontrollen der Business-Lane. Geschäftsreisende können hier schneller einchecken, wenn sie es eilig haben. Manchmal, sagt Tröger, wundere er sich schon, was da alles in den Tonnen lande. Teure Gesichtscremes, verschlossene Cola-Dosen, sogar Essen. "Seit zwei Jahren verwende ich nur noch Markenkosmetik", sagt er und lacht, "James-Bond-Gesichtscreme und solche Späße."
15 Runden am Tag
Bis zu 15 Mal am Tag dreht er seine Runde durch den Airport, um den Füllstand der Tonnen zu überprüfen. Dabei kommt er durch ein Parkhaus, in dem die dunklen Limousinen und Geländewagen eines Autoverleihs glänzen. "Frisch gewaschen", sagt Tröger in Richtung eines BMW. Seine Tonnen reinigt er auch regelmäßig, poliert mit Glasreiniger solange, bis sie glänzen.
Neulich habe er im Fernsehen eine Dokumentation über Plastikmüll im Meer gesehen, erzählt er. Er sei zwar "kein Grüner", aber wie die Fische unter dem Ganzen litten, das tue ihm schon leid. "Ich hab dann sofort auf Stoffbeutel umgestellt", sagt er. Plastiktüten kämen ihm nicht mehr ins Haus.
Nach Dienstschluss steigt er in die S-Bahn. Er will noch etwas in der Innenstadt erledigen. Neben seinem Sitzplatz in der Bahn quillt der Mülleimer über, Uwe Tröger erspäht eine Metalldose, die er sorgsam herauszieht und in seinen Händen dreht. 25 Cent ist die wert. Vorsichtig drückt er dann die Beulen aus dem Metall und stellt die Dose auf den Boden. "Für die Pfandsammler."