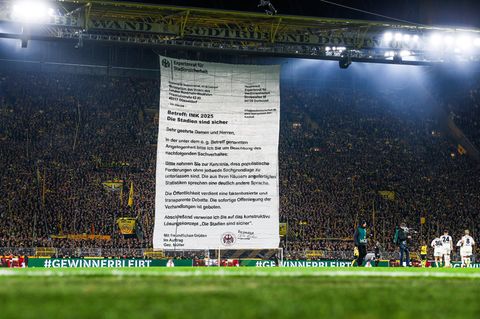Landgericht Bremen, Saal 231. Der Staatsanwalt hat gerade den Zeugen Masud* Miri ermahnt, im Prozess gegen seine Brüder Seif* und Hassan* die Wahrheit zu sagen, sonst gefährde er seine Bewährung. Da springt der 32-Jährige wütend auf. "Was hier passiert, ist doch Bullshit, einfach Kindergarten - mein Bruder bekommt Ärger für nichts", brüllt er. Masud Miri, als Gewalttäter in Bremen stadtbekannt, war mehrfach in Messerstechereien und Schießereien verwickelt. Sein Bruder Seif schnellt von der Anklagebank hoch und schreit: "Die Polizei ermittelt ja doch nur, was sie will." Als sich der Staatsanwalt einschaltet, fährt ihm Seif über den Mund: "Ich rede. Sie sind ruhig."
Der "Tatort"
10,18 Millionen Zuschauer sahen am Sonntagabend den Bremen-"Tatort", der von einer kriminellen Familie erzählt, die dem Bremer Miri-Clan ähnelt. Der stern hat 2011 über den Miri-Clan berichtet.
Kritik an dem Krimi kam vom Bremer Innenstaatsrat Holger Münch. Der Politiker bemängelte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur DPA den "Tatort", weil er "zur "Stigmatisierung" beitragen könne. Es geht in dem Fall um Clan-Kriminalität und die Frage, ob sich die Clan-Mitglieder dauerhaft von ihrer Umgebung lösen können. Ein Mann, der den Absprung fast geschafft habe, werde am Ende wieder kriminell, ganz nach dem Motto einmal dazugehörig, immer dazugehörig, so Münch. "Genau das ist es ja, was wir nicht brauchen an Botschaften", sagte Münch, der früher auch Polizeipräsident in Bremen war.
Die Richterin haut mit der flachen Hand auf den Tisch: "Schluss jetzt." Ohne die Vorsitzende eines Blickes zu würdigen, drückt der Angeklagte demonstrativ den Knopf des Mikrofons, sodass ihn alle hören können. "Ich habe keinen Bock, mich verarschen zu lassen", tönt er, "das Urteil steht doch sowieso schon fest - und dann wundert ihr euch, wenn die Leute die Gesetze selbst in die Hand nehmen."
Die Richterin ist fassungslos. Auch ihre Beisitzerinnen, die Schöffen und der Staatsanwalt schweigen, sitzen da wie paralysiert. Neun Minuten lang haben die Brüder im voll besetzten Gerichtssaal das Kommando. "Wir machen jetzt eine Pause", sagt die Vorsitzende dann. Mit wehender Robe verlässt sie den Gerichtssaal, es sieht aus wie eine Flucht.
Den beiden Miri-Brüdern werden in diesem Prozess elf Straftaten zur Last gelegt, darunter versuchte gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und schwerer Landfriedensbruch. Gemeinsam mit 20 Komplizen sollen sie, bewaffnet mit Messern und Schlagstöcken, ein Lokal überfallen und den Wirt schwer verletzt haben.
"Organisierte Kriminalität vom Feinsten"
Seif und Hassan Miri sind Mitglieder einer Großfamilie, die in Bremen so bekannt und gefürchtet ist wie die Mafia in Palermo. Der Name Miri steht in der Hansestadt für "organisierte Kriminalität vom Feinsten", wie ein Kriminalbeamter sagt. Eine fünfköpfige Sonderkommission der Polizei beschäftigt sich ausnahmslos mit den Miris, die gern Polohemden tragen, auf denen sich ein aufgestickter Lorbeerkranz um den Schriftzug "Das goldene M" wölbt.
Ausländische Großfamilien wie sie hätten in verschiedenen Regionen Deutschlands bereits Fuß gefasst und "ethnisch abgeschottete Subkulturen" gebildet, warnte das Bundeskriminalamt schon vor Jahren - die Zerschlagung dieser kriminellen Strukturen werde "nur noch in Teilbereichen" möglich sein.
Die Miris gehören zu einem weitverzweigten Clan von Arabisch sprechenden Mhallamiye- Kurden, der allein in Bremen etwa 30 Familien mit 2600 Angehörigen zählt. Die Papierrolle, auf der die Kripo die Verwandtschaftsverhältnisse der Sippe entschlüsselt hat, ist acht Meter lang. Viele Familien haben 15 oder mehr Kinder. 1466 Angehörige - also über die Hälfte aller Mitglieder des Bremer Clans - sind schon einmal straffällig geworden, darunter 207 Vielfachtäter und 66 Schwer- sowie Schwerstkriminelle. Allein im Jahr 2009 sollen 1129 Straftaten auf das Konto der Großfamilie gegangen sein - vom einfachen Diebstahl bis hin zum Mord.
So fahndet die Polizei beispielsweise derzeit mit internationalem Haftbefehl nach einem 33-jährigen Clan-Mitglied, das in Schwanewede bei Bremen den 43-jährigen Deutsch-Libanesen Hussein E. erschossen haben soll. Der war an einem Überfall auf eine Eckkneipe beteiligt, bei dem ein 18-jähriger Verwandter der Miris starb. 60.000 Euro soll der Killer für die Hinrichtung kassiert haben. Das Opfer ahnte, dass es ermordet werden sollte, und vertraute sich kurz vorher dem "taz"- Redakteur Christian Jakob an. "Der hatte Angst, dass ihn Angehörige des Clans töten lassen würden", sagt der Journalist.
50 Millionen Euro Umsatz mit Drogen
Es gibt zwar ein paar Angehörige der Großfamilie, die inzwischen eingebürgert sind, als Gemüsegroßhändler oder Zahnarzt arbeiten und pünktlich ihre Steuern zahlen. Nach Polizeierkenntnissen sind das allerdings "absolute Ausnahmen". Denn die meisten Familien kassieren angeblich Hartz IV plus Kindergeld und bessern die staatliche Unterstützung mit Schutzgelderpressung, Diebstählen, Drogen- oder Waffenhandel auf. 50 Millionen Euro jährlich soll der Clan nach Polizeischätzungen allein in Bremen mit dem Verkauf von Drogen umsetzen. Das Startkapital dafür stammte, so heißt es in Kripo-Kreisen, aus einem Sozialhilfebetrug in sechsstelliger Höhe Anfang der 80er Jahre.
Damals kamen die ersten Mhallamiye-Kurden vermutlich auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg im Libanon über die Türkei nach Deutschland und ließen sich hauptsächlich in Berlin, Essen und Bremen nieder. Heute leben etwa 15.000 auf deutschem Boden, die meisten - gemessen an der Gesamtbevölkerung - in Bremen. Der Stadtstaat war deshalb so beliebt, weil hier die Sozialhilfe jahrelang in bar ausgezahlt wurde und nicht wie anderswo in Wertgutscheinen.
Und nun wird Bremen das Problem nicht mehr los. Viele der Flüchtlinge vernichteten nach der Ankunft in Deutschland ihre Pässe, um ihre Herkunft zu verschleiern. Der Libanon weigert sich, Mhallamiye-Kurden aufzunehmen, behauptet, sie seien Türken. Tatsächlich hat die Bremer Innenbehörde Hinweise darauf, dass die Familie Miri aus der Türkei stammt. Die Türkei aber besteht darauf, dass die Sippe aus dem Libanon stamme. Solange die Herkunft nicht geklärt ist, gelten sie als staatenlos, müssen geduldet und können nicht abgeschoben werden.
Regiert wird der Miri-Clan von mächtigen Patriarchen, die so gut wie alle wichtigen Entscheidungen treffen. Ihr Wort gilt mehr als die Anweisung eines Polizeibeamten oder das Urteil eines Richters. "Diese Menschen leben isoliert in ihren Stammesverhältnissen und betrachten jeden, der nicht zur Familie gehört, als Feind", sagt der libanesische Buchautor und Islamwissenschaftler Ralph Ghadban. "Sie betrachten uns als Beutegesellschaft, pflegen religiöse Vorstellungen, in denen Nicht-Muslime verachtet werden. Daher kommt auch diese menschenverachtende Gewalt."
Viele Clan-Mitglieder schlagen schon im Kindesalter eine kriminelle Karriere ein. Ziehen ihre Klassenkameraden ab, erpressen Markenklamotten und Handys. Und müssen dabei noch nicht mal Gewalt anwenden. Oft reicht schon der kleine Hinweis: "Ich bin ein Miri."
Als Teenager feilen sie dann weiter an ihren kriminellen Laufbahnen, mit Raubtaten, Körperverletzungen und ersten Drogendelikten. "Je älter sie werden, desto gewalttätiger sind sie", sagt ein Ermittler. Denn die Vorbilder der Jungen sind ihre Väter, Brüder und Onkel, die ohne Schulabschluss und Ausbildung viel Geld im Drogengeschäft verdienen - selbstbewusst und überaus durchsetzungsfähig.
Vor der Justiz haben sie keinen Respekt. Wenn Gerichtsvollzieher an ihren Türen läuten, haben die vorsichtshalber Polizei dabei. Als kürzlich drei Männer der Miri- Sippe wegen gefährlicher Körperverletzung auf der Anklagebank saßen, drohten sie dem Staatsanwalt: "Wir wissen, wo Ihr Sohn verkehrt."
Zeugen verlieren auffallend häufig das Gedächtnis, wenn sie gegen Angehörige der Großfamilie aussagen sollen. So zog ein 24-Jähriger, den zwei Miris mit Totschlägern traktiert hatten, seine Anzeige zurück; auch die anderen Zeugen konnten sich plötzlich vor Gericht nicht mehr an den Überfall erinnern. "Ich glaube, die hatten alle Besuch", schimpfte eine Anwältin entnervt. In Justizkreisen ist es ein offenes Geheimnis, dass Zeugen bedroht oder gekauft werden. 40.000 Euro soll die Familie angeblich schon mal lockermachen, damit Opfer oder Zeugen den Mund halten.
"Ich ficke eure Frauen"
Vor gut drei Jahren scheiterte ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen zwei Miri-Männer: Bei einem Streit in einer Diskothek war ein Miri mit dem Messer verletzt worden. Der Clan hielt einen damals 33-Jährigen für den Täter und zitierte ihn zu einem Treffen, das als "Friedensgespräch" verabredet war. Dort griffen sie ihn an, stachen mit einem Messer auf ihn ein und schossen ihm ins Gesäß. Der Mann konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Doch vor Gericht erinnerte er sich nicht mehr an seine Peiniger.
Hassan und Seif Miri, die jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung vor dem Bremer Landgericht stehen, fielen schon als Kinder immer wieder wegen Diebstählen auf. Mit 16 wurde Hassan Miri erstmals wegen gemeinschaftlichen Raubs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Inzwischen ist er 23 und elfmal vorbestraft. Zuletzt wurde er zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, weil er einen jungen Mann in einer Diskothek mit einem metallenen Standaschenbecher schwer an der Wirbelsäule verletzt hatte. Sein Bruder Arut*, ebenfalls in die Schlägerei verwickelt, hatte einem Mann mit voller Wucht gegen den Kopf getreten, sodass das Opfer erblindete.
Seif Miri, verheiratet, Vater zweier kleiner Söhne, ist 31 Jahre alt und 15-mal vorbestraft, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Raub, Hehlerei, Drogenhandels und schweren Bandendiebstahls. Mit 16 kam er das erste Mal in Jugendhaft, hat seitdem mehrere Jahre im Gefängnis verbracht. Respekt vor der Polizei hat er nicht. "Ich breche euch allen das Genick, einem nach dem andern", schrie er bei einem Polizeieinsatz. Und zeigte auf eine junge Beamtin: "Mit dir fange ich an." Als Beamte seinen Wagen bei einer Verkehrskontrolle stoppten, brüllte er: "Ich zahle keinen Euro Bußgeld. Das zahlt der deutsche Staat. Ich ficke eure Frauen."
Im Dachgeschoss eines renovierten Altbremer Hauses am Rande der Innenstadt wohnen Seif und Hassan Miri mit Eltern und Geschwistern. Die Frau von Seif Miri lebt mit den gemeinsamen Kindern bei ihren Eltern in Achim, einem kleinen Ort außerhalb Bremens. Ein roter Teppich liegt auf den Stufen, die zur Wohnung führen. Vor der orange getünchten Wand des Wohnzimmers steht ein elegantes Ledersofa, auf dem Parkett liegen Perserteppiche. Feine Spiegel hängen in goldenen Rahmen, goldfarben auch die Beistelltischchen. Selbst die Tischdecke ist mit goldenen Perlen bestickt. Und in der Obstschale, einer opulenten Schüssel in Gold, liegen rote Plastikäpfel.
Ismail Miri hat nur eine "Fiktionsbescheinigung"
Ismail* Miri, Seifs und Hassans Bruder und einer der Wortführer des Clans, versucht zu erklären, weshalb sechs der acht Brüder kriminell geworden sind - und bringt es doch nur auf eine Antwort: "Auf jeden Fall sind wir nicht allein schuld."
Der 38-Jährige trägt ein blassblaues Hemd, das am Kragen mit einem blauen Band aus Satin abgesetzt ist. Als seine Eltern 1985 mit 13 Kindern nach Deutschland gekommen sind, "hausten wir mit 15 Personen in drei Zimmern - wir hatten nichts, lebten von Sozialhilfe". Irgendwann habe er ein Fahrrad geklaut, weil es seinem Vater nicht erlaubt war, einer Arbeit nachzugehen und Geld zu verdienen. "So fing es an", sagt er, "bei mir und auch bei meinen Brüdern."
Später hat er insgesamt 30 Monate im Gefängnis gesessen, wegen gefährlicher Körperverletzung, Urkundenfälschung, Bedrohung. Seine letzte Verurteilung stammt aus dem Jahr 2003. "Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn wir hätten arbeiten dürfen. Aber als Staatenlose durften wir nicht. Und wenn man nicht arbeiten darf, kommt man auf dumme Gedanken."
Ismail Miri will demonstrieren, wie völlig chaotisch Bremens Ausländerbehörde mit der Herkunft der Familie umgeht - und legt die Pässe seiner Angehörigen auf den Tisch: Seine Eltern haben die libanesische und die türkische Staatsbürgerschaft und eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Ismail Miri hat nur eine "Fiktionsbescheinigung", eine vorläufige befristete Aufenthaltsgenehmigung, die ihn als Türken ausweist. Alle drei bis sechs Monate muss er seine Duldung verlängern lassen. Hassan Miri dagegen gilt als staatenlos und wird geduldet, während Seif Miri vorläufig als Libanese geführt wird. Will er seine Frau und die Kinder in Achim besuchen, braucht er dafür eine Genehmigung der Behörde. Und seine Duldung muss er alle drei Monate verlängern lassen, obwohl sein Vater, erzählt Ismail Miri, extra im Libanon Geburtsurkunden besorgt habe, um die Herkunft der Familie beweisen zu können. Vergebens. Der Stadtstaat Bremen erkannte die Papiere nicht an.
Eine Schwester der Miri-Brüder besitzt dagegen einen deutschen Pass. Sie hatte Glück. In einer Phase, als die Innenbehörde ihre Eltern als Staatenlose führte, durfte sie deutsche Staatsbürgerin werden. Grund: Kinder von Staatenlosen haben oft ein Recht auf beschleunigte Einbürgerung. Ihre eigenen Kinder sind jetzt auch Deutsche, können eine Ausbildung machen und arbeiten. Die Kinder von Ismail Miri dagegen werden in Deutschland nur geduldet - so wie er.
So unterschiedlich ihr Status, so unterschiedlich die Chancen, in Deutschland Fuß zu fassen. Seine Eltern hätten inzwischen um die 100 Nachkommen, rechnet Ismail Miri aus. 100 Nachkommen, von denen viele theoretisch immer damit rechnen müssen, abgeschoben zu werden. "Die Leute haben Angst", sagt Ismail Miri, "und sie haben keine Perspektive."
Der Sprecher der Innenbehörde stöhnt, als er den Namen Miri hört: "Das leidige Thema." Auf die Frage, weshalb es in einer einzigen Familie so viele verschiedene Staatsangehörigkeiten geben kann, hat er keine Antwort.
Es ist eine unheilvolle Entwicklung, die da in Gang gekommen ist. Auf der einen Seite der offenbar überforderte Stadtstaat Bremen, der im Herbst 2009 "null Toleranz" gegen die Miris versprach, rasenden Drogendealern die Führerscheine wegnehmen und Eltern, deren Kinder die Schule schwänzten, zur Kasse bitten wollte und dessen zuständige Behörde Ausländerrecht als Gefahrenabwehrrecht definiert.
Auf der anderen Seite verstockte und aggressive Angehörige der Miris, die sich drangsaliert und gedemütigt fühlen, gleichwohl aber weiterhin unbeirrt ihren kriminellen Geschäften nachgehen, weil ihnen angeblich nichts anderes übrig bleibt - und damit auch einzelne Mitglieder ihrer Großfamilie in Verruf bringen, die eingebürgert sind, anständige Berufe ausüben und ihre Steuern zahlen.
"Ich scheiß auf diesen Staat"
Mit den kurdischen Großfamilien in ihrer Stadt hatte sich auch die verstorbene Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig beschäftigt. "Ich bin überzeugt, dass es einzelne Mitglieder der Familien schaffen könnten, sich in eine andere Richtung zu entwickeln", notierte sie in ihrem Buch "Das Ende der Geduld". Ihr schwebte "eine Art Ausstiegsprogramm aus dem Kriminalitätsstrudel" vor.
Ein solches Programm will jetzt Ahmed Mery, 50, in Berlin auf die Beine stellen. Mery, ein Cousin der Bremer Miri-Brüder, betreibt im Stadtbezirk Charlottenburg einen Großhandel für Parfüm und Geschenkartikel und hat Anfang des Jahres mit Mitgliedern anderer arabischer Familien in der Hauptstadt eine "Familien-Union" gegründet. Er hat vor, in Zusammenarbeit mit der Polizei, den Schulen und anderen Behörden den kriminellen Zweig der Sippe auf den rechten Weg zurückzuholen. "Wir werden mit erwachsenen Familienmitgliedern ernste Gespräche führen und uns vor allem um die Kinder und Jugendlichen kümmern", sagt er, "denn der einzige Weg, der sich später auszahlt, führt über die Bildung - und nicht über Kriminalität."
Sein Verein plant zum Beispiel Freizeiteinrichtungen, um die Jugendlichen von der Straße zu holen: "Die hängen ohne Schulabschluss und arbeitslos herum und werden kriminell - damit muss Schluss sein." Die Berliner Polizei verfolgt das Projekt interessiert - und wartet ab, ob den Absichtserklärungen auch Taten folgen werden.
In Essen ist man da schon weiter. Dort unterstützt eine Familien- Union bereits seit 2008 vor allem junge Sippenangehörige. Vereinsmitglieder geben Nachhilfeunterricht, haben eine eigene Pfadfindergruppe gegründet und holen renitente Schulverweigerer auch schon mal morgens von zu Hause ab, bringen sie in die Schule und bleiben notfalls im Unterricht neben ihren "Klienten" sitzen. "Die Vermittlungsgespräche, die die Familien-Union mit den Familien führt, sind wichtig", bestätigt ein Sprecher der Essener Polizei.
Der Berliner Ahmed Mery, laut Pass Libanese, hat in Deutschland Fuß fassen können, weil er seit 20 Jahren eine Arbeitsgenehmigung besitzt. Mit seinem Cousin Ismail Miri steht er in Kontakt. "Ich werde nach Bremen reisen und meinen Verwandten dort bei der Gründung einer Familien-Union helfen", verspricht Mery, der nun unbedingt deutscher Staatsbürger werden will.
Davon ist Seif Miri, angeklagt vor dem Bremer Landgericht, noch weit entfernt. Als im Gerichtssaal ein Video gezeigt wird, das ein Spezialeinsatzkommando von einem Einsatz bei den Miris aufgenommen hat, dreht er durch. "Ist das normal?", schreit er und deutet auf eine Szene, in der ihn ein Polizist mit den Knien am Boden hält: "Ich scheiß auf diesen Staat."
Dieser Text erschien 2011 im stern. Die mit einem Sternchen* gennzeichneten Namen sind geändert.