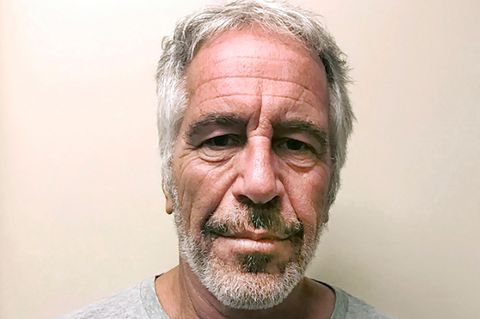Die Geschäfte gehen gut für Dan Gallo. Normalerweise verkauft er Wanzen und kleine versteckte Kameras und Bücher mit Titeln wie »Revenge is sweet« (Rache ist süß) oder »The Conspiracy Theory« (Die Verschwörungstheorie) im »Counter Spy Shop« auf der Madison Avenue. Doch seit ein paar Wochen hat sich der Geschmack der Kundschaft radikal verändert. Vorn im Laden stehen zwei Puppen in Schutzanzügen und mit Gasmasken. Ein paar Schritte weiter ist das Rockefeller-Center und darin Panik: Milzbrand-Erreger bei NBC.
Irgendwie ist es Dan Gallo ein bisschen peinlich, dass die Geschäfte so florieren. Aber Panik und Hysterie sind gut für den Umsatz. Früher gingen Gasmasken nie, mittlerweile verkauft der Laden bis zu fünfzig am Tag, Tendenz steigend. Mister Gallo hat seine ganze Familie, Frau und vier Kinder, mit diesen Masken ausgestattet. Seine Tochter, 13, war ein wenig besorgt, als Daddy mit den unheimlichen Dingern nach Hause kam. Aber dann hat auch sie eingesehen, dass es nicht schaden kann, Gasmasken zu besitzen in diesen Tagen. Und Schutzanzüge.
Mister Gallo hat abends zuvor die Rede des Präsidenten gehört und die Warnungen des FBI vor weiteren Attacken, und morgens stand auf der Titelseite der »Daily News« in dicken roten Buchstaben »RED ALERT«, Roter Alarm. Polizei und Nationalgarde patrouillieren. Autoschlangen vor den Tunnels und Brücken. Männer mit grimmigem Gesichtsausdruck, die mit ihren Taschenlampen in Autos leuchten und in verängstigte Gesichter. Das Lebensgefühl in New York ist Roter Alarm. »Es wird wieder was passieren in diesem Land«, sagt Dan Gallo, »vielleicht in Chicago oder in Los Angeles oder doch wieder in?« Auf der Ladentheke liegen Prospekte. Es gibt jetzt auch Schutzanzüge für Drei- bis Achtjährige und den »Baby
Protection Suit», «mit einem Filter, der mehr als zehn Stunden in kontaminierter Umgebung hält». Ist das Hysterie, Mister Gallo? Er sagt: «Das ist der Wunsch nach Sicherheit.»
Die Geschäfte gehen schlecht
Die Geschäfte gehen schlecht für Brian und Abby Lydon im »Moran?s«. Das Restaurant, 103 Washington Street, liegt in der so genannten »Frozen Zone«, Sperrbezirk. Die Washington Street läuft direkt zu auf Ground Zero. Stahlgerippe im Hintergrund und Bagger und Kräne und, ganz klein, Feuerwehrleute und Schweißer auf dem größten Schutthaufen der Welt. Man kann das »Moran?s« nur nach einer Personenkontrolle erreichen. Wenn man Soldaten Ausweis oder Führerschein zeigt und verspricht, keine Fotos zu machen. Vor dem 11. September war die Washington Street ein belebter Platz in Downtown Manhattan, aßen 200 Leute im »Moran?s«, mindestens. Heute sind sie froh, wenn ein paar Feuerwehrleute auf ein Bier vorbeikommen und Polizisten auf ein Sandwich. Vor dem 11. September war der Laden mit der langen Mahagony-Theke abends pickepackevoll. Brian kennt Hunderte Gäste mit Namen. Er wagt nicht, im Internet nach den Opfern zu suchen. Will nicht wissen, wie viele seiner Stammkunden nur einen Block weiter unter den Trümmern verwesen. Ab und zu ruft ein Gast von früher an, nur um zu sagen: »Ich bin okay.« Das sind die besten Momente des Tages für die Lydons.
Sie haben eine Tochter, Meghan, neun Jahre. Als Meghan noch kleiner war, fragte sie ihre Mutter »Was ist, wenn die Türme umfallen?« Abby Lydon antwortete »Keine Sorge, Sweetheart, so was passiert nur in Filmen.« Jetzt fragt Meghan Dinge wie »Können wir uns das College für mich leisten?« Die Lydons müssen noch eine Hypothek abtragen fürs Restaurant und ihr
Apartment, 600 Gateway Plaza. Dort kommen sie nicht hin momentan, Sperrbezirk. Einmal durfte Abby Lydon in die alte Wohnung, um das Notdürftigste einzusammeln. Sie fand im Wohnzimmer eine leere Flasche Rotwein und einen Zettel: »Thank you«.
Viele New Yorker Restaurants mussten schließen seit dem 11. September. 11900 Leute in der Gastronomie verloren ihren Job. Weit über 100000 Menschen insgesamt wurden und werden noch arbeitslos. Der volkswirtschaftliche Schaden geht ins Unermessliche, 105 Milliarden, 120 Milliarden? Mehr? Weniger? Der andere Schaden lässt sich mit einer Ziffer, über 5000 Tote, nicht ermessen. Schicksale werden nicht mit Zahlen aufgewogen. Abby Lydon sagt: »Wir leben. Das ist die Hauptsache.« Die Stadt ist ein einziges Meer von Stars and Stripes. An den Autoantennen Fahnen, vier Dollar. An den Revers der Geschäftsleute Stars-and-Stripes-Pins, zwei Dollar. Oder Schleifchen, ein Dollar fünfzig. Drüben in Totowa, auf der anderen Seite des Hudson, ist eine Fahnenfabrik. Vor dem Anschlag brachte sie monatlich 1400 US-Flaggen an Mann und Frau. Jetzt sind es 20000, täglich. Fahnen gehen noch besser als Gasmasken.
»God bless America«
O Suzannah, wie lange halten deine Stimmbänder noch? Suzannah B. Troy, 39, Künstlerin, beherrscht den Westside Highway, Ecke Christopher Street mit Wort und Tat. Sie und eine Gruppe Freiwilliger haben seit Wochen Position bezogen an der vierspurigen Ausfallstraße. Mit Fähnchen und Luftballons in den Nationalfarben Weiß, Rot, Blau. Von weitem sieht das aus wie eine Wahlkampfparty. Und von nahem wie eine Versammlung der einsamen Herzen. Sie stehen dort mit Plakaten, auf die »Thank you« oder »God bless America« oder »We love you« oder »Our Heroes!« gepinselt ist.
Wenn die Busse kommen vom Ground Zero Richtung Uptown mit erschöpften Feuerwehrleuten und Polizisten und Arbeitern, gerät die Gruppe in Wallung. Vorneweg Suzannah mit dem lautesten Organ. Sie springen von der begrünten Verkehrsinsel an den Straßenrand, halten die Schilder hoch und eine Hand aufs Herz und kreischen im Chor »Huuuu, Yeahhh, God Bless you. We love you. You?re doing a great job.« Die Fahrer hupen zum Dank, und die Männer winken müde aus dem Fenster. Suzannah sagt: »Siehst du das Glänzen in ihren Augen. Das ist unser Dank. Das ist das Einzige, was wir ihnen geben können.« Mitunter stehen sie auch nur stumm da und kerzengerade, mit der Hand auf dem Herzen, wenn wieder ein von Motorrädern eskortierter Ambulanzwagen vorüberfährt, und jeder weiß, dass in dem Wagen ein geborgener Körper liegt. Oder Teile davon.
Eigentlich ist Suzannah Künstlerin, die im wahren Leben Kondome zu Büstenhaltern formt und sich für »geo-sexuelle Politik, Frauenangelegenheiten, Kommunikation, menschliche Beziehungen, in einem Wort: Peace!« engagiert. Aber es gibt kein wahres Leben mehr in New York. Das Rumstehen, Kreischen, Winken, sagt Suzannah, »ist jetzt meine Art von Kunst. Obsession«. Außerdem: Testosteron, viel Testosteron, endlich. Sie wohnt im East Village, und dort leben viele Schwule. Aber hier, am Westside Highway, in den Bussen: Was für Kerle! Am schärfsten sind die Stahlarbeiter, gefolgt von Feuerwehr und Polizei. Sie hätte gern Sex mit diesen Typen, »Stunde für Stunde«. Aber richtiger Sex ist ihr doch zu gefährlich, und deshalb ruft sie nur »SEX, multiple orgasms, HuuuHuuu!«
»Ich danke den USA«
Abends um sechs ist Schluss mit Jubel. Suzannah geht nach Hause, CNN gucken. Neues über die Milzbrand-Viren in der
Stadt und das Militär in Afghanistan. Die geo-sexuelle Künstlerin weiß schon eine gerechte Strafe für Osama bin Laden: »Schwanz ab, Eier ab, Bart ab. Und leben lassen als Frau unter den Taliban.« Au, Suzannah. God bless America.
Mohammad Ishaq Jalili ist stolz auf sein Land. Er kauert in seinem winzigen silbernen Kaffeewagen am Times Square, verkauft Bagels, Doughnuts, Tee und Kaffee. An guten Tagen kommt er auf 65 bis 70 Dollar. Das reicht für ein Einzimmer-Apartment in Queens, Frau Jasmin und die Kinder Ashib und Suzan. Er sagt: »Ich danke den USA.« Mohammad Ishaq Jalili, 29, stammt aus der Stadt Mazar-I-Sharif, Afghanistan. Dort leben noch drei Schwestern und die Familie seiner Frau. Als Jalili von den Bombenangriffen erfuhr auf das Land, das einmal seine Heimat war, fühlte er keinen Schmerz. Bomben fielen auch auf Mazar-I-Sharif, die Stadt, in der er groß wurde und die er verließ auf Geheiß der Mutter: »Sie werden auch dich holen, du musst weg.« Da war er 18 und hatte keinen Bruder und keinen Vater mehr. Eine russische Bombe tötete Vater Mustafa. Und kurz darauf kamen vermummte Männer ins Haus und holten den Bruder Osman.
Jalili, usbekischer Abstammung, hat Frieden nur erlebt in New York. Bis zum 11. September. Er ist am 28. November 1989 in New York angekommen und wollte studieren. Aber er hatte kein Geld, und seitdem steht er auf der Straße mit seinem Kaffeewagen. Mohammad Ishaq Jalili, US-Bürger inzwischen, Reservist der Army, würde nie zurückkehren nach Afghanistan. Höchstens, um Urlaub zu machen, wenn eines Tages Frieden ist und sein Land Amerika gewonnen hat. »Ich bin Amerikaner«, sagt er. Gelegentlich sprechen ihn die Kunden an auf den Krieg, und mit denen ist er sich schnell einig: Nieder mit den Taliban! Nieder mit bin Laden! God bless New York!
Es geht der Stadt schon besser. Der Broadway erholt sich, langsam, langsam. »Die Leute brauchen Ablenkung«, sagt
Jalili. Die Besucherzahlen der Musicals erreichen fast schon Vorjahresniveau. Am Broadway ist das Abba-Musical »Mamma Mia« jeden Abend ausverkauft. Und nächste Woche macht womöglich ein Klassiker wieder auf: die »Rocky Horror Picture Show«.
Jeder Feuerwehrmann in New York ist ein Held. »Our bravest, our finest«, schreiben die Zeitungen. Billy Oettinger, 39, verheiratet, drei Kinder, mag das nicht mehr hören. Er ist kein Held und war nie einer. Und die anderen, selbst die Toten, haben auch nur ihren Job gemacht. Man denkt sowieso ganz anders über Helden, wenn man beinahe selbst in der Zeitung gestanden hätte mit der Adresse der Kirche für den Trauergottesdienst dahinter und der Bitte um rege Anteil-
nahme.
Billy hatte Glück
Billy hatte Glück. Am Morgen des 11. September ist er bei einer Übung drüben auf Randalls Island, Routine. Er hört von dem Desaster, setzt sich ins Auto und rast hinter einem Feuerwehrwagen nach Downtown. Aber Billy Oettinger hat keinen Helm dabei. Er geht in die Wache neben dem World Trade Center, um sich Ausrüstung zu borgen. Kaum ist er im Gebäude, kracht der zweite Turm, danach: Dunkelheit und Schutt um ihn herum. Oettinger kauert mit zwei Rettungsleuten im Bad unter einem Tisch. Einsturzgefahr. Die Rettungsleute beten, Oettinger denkt an seine Frau Mary und die Kinder. Und daran, dass er viel Scheiße gebaut hat in seinem Leben, das vielleicht jetzt zu Ende geht. Er bittet um Verzeihung.
Schließlich lichtet sich der Staub ein wenig. Sie arbeiten sich vor bis zur Küche, durch die geborstenen Fensterscheiben hinaus auf die Straße. Und machen, was Billy Oettinger »Job« nennt. Er sieht zwei Japaner, eingeklemmt zwischen Trümmerteilen. Einer der Männer hält einen Aktenkoffer fest umklammert. Die Feuerwehrleute werden nervös, sie debattieren kurz. Was ist in dem Aktenkoffer? Eine Bombe vielleicht. Immerhin sieht es um sie herum so aus, als wäre Bombenkrieg in Manhattan. Billy schreit ihn an: »Gib mir den verdammten Koffer.« Keine Reaktion. Der Japaner versteht kein Englisch. Der andere Japaner sagt was von Geld. Aber Billy droht, dem Koffermann den Schädel zu spalten mit seiner Spitzhacke, wenn er das Ding nicht rausrückt. Am Ende gewinnt Billy, und die Japaner werden gerettet. Im Koffer sind zehn Millionen Dollar.
Billy Oettinger hat am 11. September viele Kollegen sterben sehen. Er hat sich nicht gewundert, dass die Krankenhäuser relativ leer blieben und schon tags drauf wieder Schönheitsoperationen durchgeführt wurden, denn: Da waren nur Tod und Verwüstung und wenig Verwundete. »Es wird eine Generation dauern, bis wir den 11. September verwunden haben.« Nachmittags muss Billy Oettinger zu einer Trauerfeier. Bis tief in den November hinein, hat er ausgerechnet, wird das noch gehen. Drei-, viermal die Woche.
Die Suchhunde werden depressiv
Es gibt viele Geschichten in New York, wenige handeln von Wundern. Die von den zwei Blinden, Omar Rivera und Michael Hingson etwa, die mit ihren Hunden Salty und Roselle rauskamen aus den brennenden Türmen des World Trade Center, 71. und 78. Stock. Oder die von der Katze Gritty, die nach 18 Tagen im Schutt gefunden wurde. Doch auf Ground Zero werden
die Suchhunde depressiv, weil sie keine Menschen finden. Zuweilen legen sich Helfer in den Staub, damit die Hunde ein Erfolgserlebnis haben.
Joyce DeFillippo, 52, Telefonistin bei der Patentanwaltskanzlei Kenyon & Kenyon, erzählt und erzählt. Ihr Psychiater hat ihr das geraten - zu reden über ihr Erlebnis. Das würde befreien. Also redet sie: Wie sie am Morgen des 11. September nach Downtown fährt. Wie sie den ersten Crash aus dem Busfenster sieht, und der Fahrer ruft »Alles raus!« Wie sie, eine einfache Frau, denkt: »Aber ich muss doch zur Arbeit« und geht und geht und geht. Erzählt, wie ihr, herzschwach, die Luft knapp wird auf Höhe der Chambers Street. Wie sie in den West Broadway einbiegt, wie es plötzlich diesen furchtbaren Knall tut. Und wie dann ein Schuh vom Himmel fällt. Ein hochhackiger Schuh mit einem abgerissenen Fuß darin. Wie er eine Frau erschlägt, genau vor ihren Augen auf dem Bürgersteig, West Broadway. Und der Schuh mit dem Fuß steckt im Schädel der Frau, die auf der Stelle tot ist. Joyce taumelt nur noch um die Ecke, und der Straßenverkäufer Dwaine hilft ihr wieder auf die Beine. Zwei Kolleginnen, Sarah und Virginia, kommen vorüber und sehen die hilflose, traumatisierte Joyce, haken sie unter und ziehen sie mit. »Ich habe zwei Ehemänner durch Krebs verloren«, sagt Joyce DeFillippo, »und in diesem Augenblick wusste ich, dass sie bei mir sind. Dass die beiden mich ziehen durch Sarah und Virginia.«
Neun Tage später ist Joyce DeFillippo wieder zur Arbeit gegangen. Sie hat Telefonate durchgestellt und in der Pause den Kollegen ihre Geschichte erzählt. Der Psychiater glaubt, dass das befreit.
»Wir konnten uns wenigstens noch verabschieden«
Alayne Gentul war eine beliebte Frau. Zur Messe kamen 700 Leute in die Kirche. Man konnte Alayne identifizieren anhand der Inschrift ihres Eherings, gefunden am 19. September. Acht Tage nach jenem Anruf, der Jack Gentul am New Jersey Institute of Technology erreichte. Es war kurz nach neun Uhr morgens. Seine Frau, Personalchefin der Treuhandgesellschaft »Fiduciary Trust Company«, sagte, Rauch sei im Turm. Sie sagte, dass sie nach oben gefahren sei, vom 90. Stock in den 97., um die Kollegen aus der Computerabteilung zu alarmieren. Alayne und Jack Gentul, 23 Jahre verheiratet, sprachen eine Viertelstunde miteinander. »Wir konnten uns wenigstens noch verabschieden. Sie sagte, dass sie unsere Jungs liebt und mich. Und dass sie Angst hat.«
Später wurde bekannt, dass Alayne Gentul durch ihre rechtzeitige Warnung 40 Kollegen das Leben gerettet hat. Als sie an sich denken konnte, war es zu spät. »So war sie«, sagt ihr Mann, »sie dachte immer erst an andere und zuletzt an sich.« Manchmal ist er wütend, dass sie so war. Manchmal ist er stolz, dass sie so war.
Jack Gentul, Dekan an der Universität, muss nun Vater und Mutter sein für seine Söhne Alex, 12, und Robbie, 8. Aber er kann die Hemden nicht so akkurat falten wie Alayne. Er kann nicht so gut kochen, er wird sie nie ersetzen können. Alles im schmucken Haus der Gentuls erinnert an Alayne. Sogar ihre Notizen mit den Anweisungen für die Jungs kleben noch am Eisschrank. Alex und Robbie schlafen seit dem 11. September im großen Ehebett, der Vater in der Mitte. Einmal fragte der Kleine: »Wie soll ich dir ein Geburtstagsgeschenk besorgen ohne Mum?«
Jack und Alayne hatten beschlossen, sich vorzeitig zur Ruhe zu setzen. Sie wollten mehr Zeit haben für sich und die Jungs und für große Reisen. Nur einmal, vor Jahren, hatten sich die Gentuls eine große Reise geleistet, eine Kreuzfahrt. Bei starkem Seegang mussten die meisten Passagiere kotzen. Alayne nicht. Sie war das gewohnt: Die Türme des World Trade Center schwankten ständig, mitunter so stark, dass die Stifte vom Tisch rollten.
Jack Gentul sagt: »Meine Frau war Teil eines großen historischen Ereignisses. Es hat die Welt verändert. Der Hass hat
sie umgebracht. Aber Bomben bringen Alayne auch nicht zurück.»
Mehr als 5000 Opfer
Beim Anschlag in New York starben mehr als 5000 Menschen. Nicht mal zehn Prozent der Opfer konnten bislang identifiziert werden. 81 Prozent der Toten sind Männer, Durchschnittsalter: 39 Jahre. Nach vorsichtigen Schätzungen haben 10000 Kinder am 11. September Vater oder Mutter verloren. 1000 bis 1500 sind Vollwaisen.
Ohne Sicherheiten kein Geld
Juliane Kohen, 40, und ihr Mann David, 55, haben es nicht so gut wie der Juwelier nebenan. Zum Juwelier kommen immerhin die Touristen und wollen Schmuck mit World-Trade-Center-Staub drauf als Souvenir. Verstaubte Schuhe kauft niemand. Nicht mal als Souvenir. Und in der Auslage von »The Ten Toes Footwear« in der John Street liegt fingerdick Staub auf den Damenschuhen, die nur noch 30 Dollar pro Paar kosten, zwei Paar 50 Dollar. Ausverkauf. Zwei Wochen nach dem Anschlag
war David losgezogen, um finanzielle Hilfe zu beantragen. Die Politiker, auch Bürgermeister Rudy Giuliani, hatten stets betont, gerade die kleinen Geschäftsleute zu unterstützen. Kohen meldete sich also bei der »US Small Business Administration«, und die drückten ihm einen Stapel Formulare mit Fragen in die Hand: »Haben Sie Aktien?«, »Nein«. »Besitzen Sie ein Haus?« »Nein«. »Haben Sie sonstige Sicherheiten?« »Nein«. Sorry, aber ohne Sicherheiten kein Geld.
Am Tag der Neueröffnung nach der Terror-Attacke haben die Kohens in acht Stunden ein Paar Schuhe verkauft. Früher waren es 35 bis 40. Juliane und David Kohen haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll mit ihrem Schuhladen. Die Miete für die kleine Wohnung in Brooklyn, 600 Dollar, dürfen sie abstottern. Die Miete fürs Geschäft nicht. Der Vermie-
ter ist gnadenlos, er verlangt das Geld sofort, er duldet keinen Aufschub, nicht mal in Zeiten, von denen es heißt, die New Yorker hätten die Nächstenliebe entdeckt. Das Ehepaar Kohen bekam einen Brief, datiert vom 25. September: »An alle Mieter. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, all jenen unser Mitgefühl auszudrücken, die von der Tragödie am World Trade Center betroffen waren. Anbei die Rechnung für Oktober 2001.« Forderung an die Kohens: 13318 Dollar und 77 Cents. Der Vermieter der Kohens ist die Reformierte Protestantische Niederländische Kirche von New York City.
Michael Streck