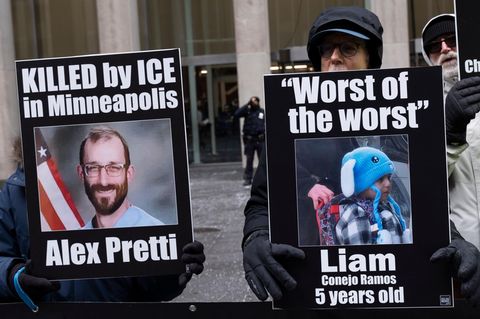Als Politiker, der auf sich hält, nimmt man ja gerne an Ereignissen teil, die als "historisch" gepriesen werden. Zumal, wenn gleich das Schicksal der ganzen Welt auf dem Spiel steht. Wie etwa beim Thema Klima. Demnach hätte Deutschlands Umweltminister Sigmar Gabriel diese Woche eigentlich in New York verbringen müssen. Denn dort fand ja die rasch "historisch" gepriesene Klimaschutz-Sondersitzung der Vereinten Nationen statt. Arnold Schwarzenegger hielt eine kernige Eröffnungsrede, dann hörten lauter wichtige Staatenführer einander zu. Für Deutschland vertrat Klima-Kanzlerin Merkel die gute Sache in romantisch zartrosa Jackett - dieses wichtige Thema lässt sich eine wie sie ja nicht nehmen. George W. Bush allerdings - immerhin Präsident der Nation mit dem weltweit größten CO-2 Ausstoß - war nicht erschienen. Er hatte seine Außenministerin geschickt.
Katja Gloger
Die US-Hauptstadt ist ein politisches Haifischbecken, in dem getuschelt, geschmiedet, verschworen und gestürzt wird. Mittdendrin: Katja Gloger. Die stern-Korrespondentin beobachtet in ihrer Kolumne "Washington Memo" den Präsidenten und beschreibt die, die es werden wollen. Dazu der neueste Klatsch aus dem Weißen Haus und von den Fluren des Kongresses.
Unterdessen begab sich der deutsche Umweltminister in dieser Woche nach Washington, in die Höhle des Löwen. Denn auch dort fand eine Klimakonferenz statt. Die Klimakonferenz des George W. Bush. Der hatte zum Meeting der "16 größten Volkswirtschaften über Energiesicherheit und Klimawandel" geladen. Und passend zum Tagungsplan lieferte das Weiße Haus gleich auch einen so genannten "Faktenzettel": "Die USA übernehmen eine Führungsrolle bei der Reduktion von Treibhausgasen" steht darin. Als ob das wirklich jemand glauben würde.
Bush lässt sich nicht verpflichten
Denn die Washingtoner Konferenz war eine Altlast. Schließlich stand Präsident Bush im Wort: hatte ihm doch vor allem seine Freundin Angela Merkel auf dem letzten G-8-Gipfel in Heiligendamm ziemlich Druck gemacht, ihn gar bedrängt mit dem Wörtchen "verbindlich". Auch die USA sollten sich endlich auf verbindliche Klimaschutzziele verpflichten, und das im Rahmen der UN. Doch einer wie Bush lässt sich nicht verpflichten, auf Klimaschutz schon gar nicht - und so hatte er zum Ärger der Kanzlerin flugs mit einer eigenen Initiative aufgewartet: Eine internationale Konferenz in Washington, später dann internationale Vereinbarungen der großen Industrieländer, aber keine verbindlichen Ziele zur dringend nötigen Reduzierung von Treibhausgasen. "Die USA nehmen diese Sache ernst", behauptet der Präsident kühn. Und Jim Connaughton, Klima-Frontmann im Weißen Haus, tönt verbindlich-unverbindlich: "Es handelt sich um ein Langzeit-Ziel, nach dem wir streben." Und Bush bat seine getreue Außenministerin, die Sache abzuwickeln.
Unklar aber blieb: Wohin strebt man in Washington? Und vor allem: Mit wem? Gemeinsam mit den Vereinten Nationen, wie von Bush bestätigt wurde? Etwa gar nach Bali? Dort wollen 180 Nationen dieser Welt im Dezember wenigstens darüber verhandeln, ob sie später über eine Fortsetzung des Kyoto-Protokolls verhandeln wollen. Oder ist Bushs angebliche Klima-Offensive doch nur der Vorwand für einen amerikanischen Alleingang? Luftige Ziele, keine Verpflichtungen und ansonsten stets der Verweis darauf, der technologische Fortschritt werde das Weltklima schon verbessern.
So war die Washingtoner Klimakonferenz von Anfang an umstritten. Kein einziger bindender Beschluss könne gefällt werden, mäkelten die Kritiker. So hatten von 16 Teilnehmerstaaten drei ihre Umweltminister entsandt: China, Indien und - Deutschland. Ach ja, und die EU war mit Dänemarks Umweltministerin vertreten.
Diplomatisches Tauziehen über Konferenzteilnahme
Über die Zusammensetzung der Delegationen hatte es zunächst sogar ein regelrechtes diplomatisches Tauziehen gegeben. Da sollten die Deutschen in einer Art europäischen Teildelegation vertreten sein, gemeinsam mit Italien. Die Briten hingegen hätten einen eigenen Delegierten entsandt. Eine derartige Herabsetzung wollten sich die Deutschen auf keinen Fall bieten lassen - und schicken schließlich Minister Gabriel in die Schlacht.
Der, nicht faul, nutzte seine Chance. Vier Tage lang mischte er Washington klimamäßig auf. Interviews, Reden und dann auch noch sein großer Auftritt im US-Senat. War der Mann aus Goslar doch als "Zeuge" bei einer Anhörung vor den Umweltausschuss des mächtigen US-Senats geladen. Eine kleine Sensation, denn Ausländer, gar Minister kommen eigentlich nicht auf den Zeugenstuhl. Die rührige Kongress-Vorsitzende, die Demokratin Nancy Pelosi, hatte die Sache eingefädelt - sie war nach einem Besuch in Berlin ganz angetan von dem kernigen Minister. Und hervorragend Englisch spricht er auch
So kamen am vergangenen Dienstag immerhin sechs der 19 Senatoren des "Ausschusses für Umwelt und öffentliche Arbeiten", um den Besucher aus Deutschland zu beäugen, darunter auch ein gewisser John Kerry, einst Präsidentschaftskandidat.
Gabriel knüpft transatlantische Koalitionen
Und Mr. Gabriel referierte kundig über die Schaffung grüner Arbeitsplätze und die Chancen der Wirtschaft beim Kampf gegen die Klimakatastrophe. Skizzierte Milliardenmärkte bei der Entwicklung alternativer Technologien. Lobte amerikanischen Finanzfirmen, die mit dem CO2-Handel endlich ordentlich Geld verdienen wollen. Zeigte sich begeistert, regelrecht enthusiastisch über die USA, die "dynamischste Volkswirtschaft der Welt", sang gar das Hohelied der globalisierten Finanzmärkte - natürlich nur zum Segen des Klimaschutzes. Und schon bildeten sich ganz neue, transatlantische Große Koalitionen: da fand sich Gabriel einig mit erzkonservativen Senatoren von den Republikanern, die wildkapitalistisch freien Emissionshandel forderten. Und ließ sich gar vom einst demokratischen, jetzt unabhängigen Senator und Irakkriegs-Befürworter Joe Lieberman versichern, "dass die USA bis Ende des kommenden Jahres ein Gesetz über den Emissionshandel verabschieden werden". Schließlich mache vor allem die amerikanische Industrie "echten Druck", wusste Gabriel. Ausgerechnet die Bosse wollten Gesetze, verbindliche Standards über CO-2 Emissionen. "Das ist eben der Unterschied zwischen den Deutschen und den Amerikanern", philosophierte er während eines Pressegespräches in Washington. "Da schreiben große US-Unternehmen dem Präsidenten einen Brief und fordern ihn auf, endlich mehr in Sachen Klimaschutz zu tun. Und bei uns? Da schreiben mir die deutschen Funktionäre, und die haben nur Kritik an unserer Klimapolitik."
"Der Mann ist doch schon Geschichte"
Und so fegte der Sigmar Gabriel klimaverändernd durch Washington, stets in adrettem Anzug, eleganter Krawatte und das Englisch ziemlich perfekt. Die Klimakonferenz? Ach ja, die absolvierte er auch. Lobte brav die "enorme Veränderung" in der amerikanischen Position. "Jetzt wollen wir die USA beim Wort nehmen. Sie sollen sich in den Prozess der Vereinten Nationen einbinden." Verteilte ein bisschen Kritik: "Es geht schon auch um die Substanz dessen was verhandelt wird. Und da liegen Europa und die Vereinigten Staaten noch ziemlich weit auseinander."
In Wahrheit war man auch nach zwei Tagen Washingtoner Klimakonferenz nicht viel schlauer. Da wollen die USA angeblich, dass die Konferenz von Bali ein Erfolg werde. Doch jedes Land müsse "pragmatisch" Lösungen über die Reduzierung von Treibhausgasen finden. Und Präsident Bush, der Kanzlerin Merkel einmal scherzhaft versichert hatte, er könne das Wort "Treibhausgase" buchstabieren, begnügte sich mit einem 30-Minuten-Auftritt. Mehr schien ihm seine eigene Klimaoffensive wohl nicht wert. Der Minister aus Deutschland nahm's gelassen.
"Der Mann im Weißen Haus ist doch schon Geschichte", sagte er. Und lachte.