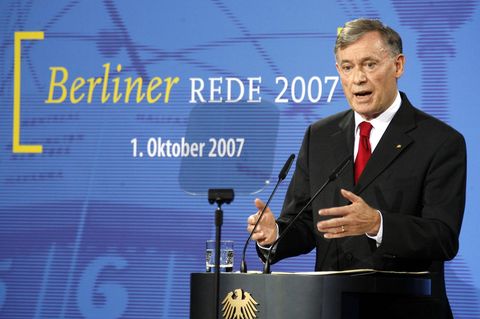Über eines sind sich die Beamten im Berliner Finanzministerium einig: Ihre Kollegen im Schloss Bellevue müssen schneller werden. Beim Arbeiten, aber auch, wenn es darum geht, die Türen zuzuschmeißen. Denn sonst könnte sie ein Briefbeschwerer treffen, den der künftige Bundespräsident im Zorn schon mal seinen Mitarbeitern hinterherwirft. In Bonn, so die Legende, soll das zugespachtelte Loch immer noch zu besichtigen sein.
Horst Köhler hat einen Ruf wie ein Donnerhall. "Der hat sich hier aufgeführt wie Rumpelstilzchen", sagt ein Ministerialer über den früheren Finanzstaatssekretär. "Ihm riss der Geduldsfaden sehr schnell", beschreibt ein Mitarbeiter des Sparkassenverbandes den einstigen Präsidenten. "He is a shouter", ein Schreier, heißt es beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington über den Ex-Direktor.
Ein Choleriker als erster Mann im Staat?
Ein Choleriker als erster Mann im Staat? Ja, die Frage darf man stellen. Doch die Antwort fällt kompliziert aus. Denn dieselben Leute, die Köhler als Vulkan schildern, sind auch von ihm fasziniert: "Er hat ein ungeheures Feuer", sagt ein Beamter. "Er ist ein besessener Arbeiter", meint ein Ex-Mitarbeiter. "Er war einer der wenigen, die Kohl die Meinung gesagt haben", erinnert sich ein Kollege.
Im persönlichen Gespräch kann der 61-jährige Überraschungskandidat unheimlich gewinnend sein. Seine stahlblauen Augen strahlen das Gegenüber an, eine Haarsträhne kräuselt sich über die Stirn, Schwieriges macht er in einfachen Worten verständlich, seine Sprache wirkt durch das leichte Schwäbeln fast charmant.
Wer ist dieser Horst Köhler? Nur 20 Prozent der Deutschen kannten ihn, ergab eine Forsa-Umfrage für den stern, gerade 34 Prozent halten ihn für geeignet, 54 Prozent trauten sich kein Urteil zu. Vom Flüchtlingskind zum Finanzfachmann, vom Ministerialbeamten zum Millionär, vom Bauernbub zum Bundespräsidenten - die Geschichte von Horst Köhler ist die Geschichte eines steilen Aufstiegs, eines Aufstiegs durch Leistung. Und es ist eine sehr deutsche Geschichte. Wohl zum letzten Mal rückt jemand an die Spitze des Staates, in dessen Leben sich fast alle Hochs und Tiefs des vergangenen Jahrhunderts wiederfinden: Nazi-Diktatur, Krieg, Flucht, deutsche Teilung, Wirtschaftswunder, Wiedervereinigung und europäische Einigung. Längst hat der als Technokrat geltende Kandidat erkannt, dass sein Lebenslauf zur Selbstinszenierung taugt: "Meine Biografie ist eine Biografie deutscher Geschichte."
Köhlers Eltern waren deutschstämmige Bauern
Köhlers Eltern waren deutschstämmige Bauern im rumänischen Bessarabien. Dort sind auch sechs seiner sieben Geschwister geboren. Der Hitler-Stalin-Pakt schlug das Gebiet im Sommer 1940 der Sowjetunion zu. Die so genannten Volksdeutschen wurden "heim ins Reich" geholt und später in besetzten Gebieten angesiedelt. Die Familie Köhler verschlug es nach Ostpolen. Dort wollte SS-Führer Heinrich Himmler ein "Bollwerk" für die Expansion nach Osten errichten. Zu den ersten Dörfern, die die SS räumte, zählte am 28. November 1942 um ein Uhr morgens Skierbieszów. Alle Bewohner wurden deportiert. Noch in der gleichen Nacht zogen die ersten deutschen Kolonisten ein. Drei Monate später, am 22. Februar 1943, kam dort Horst Köhler zur Welt. Seine Geburtsurkunde ist von der SS ausgestellt ("im ersten Jahr deutscher Besiedlung").
Vor der Roten Armee floh Mutter Köhler mit dem einjährigen Horst und vier weiteren Kindern nach Westen. "Auf der Flucht sind wir von Partisanen angegriffen worden", erinnert sich der ältere Bruder Eduard, damals 14 Jahre alt. Bomben fielen, Züge explodierten. "Zum Glück haben das alle überlebt." Die Familie landete in Markkleeberg bei Leipzig. "Ich habe neun Jahre meines Lebens in Ostdeutschland gelebt", umwirbt der Kandidat heute die Bürger in den neuen Ländern. 1953 machten die Köhlers in den Westen rüber. Nach Zwischenstationen in Flüchtlingslagern bekam die Familie 1957 in Ludwigsburg eine Wohnung. Erst von diesem Zeitpunkt an habe sich sein Lebenslauf "verfestigt". Die Familie wurde in Schwaben heimisch, der 14-Jährige ging auf das örtliche Mörike-Gymnasium. "Horst weiß, was es heißt, nicht reich zu sein", sagt seine zwei Jahre jüngere Schwester Ursula Bauer dem stern. Der Vater verdiente als Zimmermann gerade genug, um die Familie durchzubringen. Auf den ersten Kühlschrank mussten die Eltern lange sparen, bis sie ihn bar bezahlen konnten.
Horst spürte, dass er an seiner Schule als "Arbeiterkind" in der Minderheit war. Zwar beteuerte er gegenüber der Schülerzeitung seines alten Gymnasiums später, dass er "nie benachteiligt wurde", doch die Unterschiede bemerkte er schon, "zum Beispiel bei Ausflügen, wenn wir einfach nicht das Geld hatten". Er versuchte dann, mit Lehrern "soziale Diskussionen anzufangen". Sein Englisch-Pauker Wolfgang Frank erinnert sich: "Er war ein sympathischer Bub, freundlich, interessiert, wach, auch kritisch, aber in gemäßigter Form."
"Oh", stammelte Köhler, "lauter Vierer, soweit ich weiß"
Wie sah Ihr Abitur aus?, wollten die Schülerzeitungsredakteure vom IWF-Chef wissen. "Oh", stammelte Köhler, "lauter Vierer, soweit ich weiß." Er sei "kein besonders guter" Schüler gewesen, "aber ich musste nie parken. Ich war auch naiv und überhaupt nicht verbissen, was das Leistungsstreben angeht."
Das Studium der Volkswirtschaftslehre packte Köhler, der als einziges Kind der Familie zur Uni ging, von 1965 an deutlich zielstrebiger an. Obwohl er sich in Tübingen während der Studentenbewegung an "heißen politischen Diskussionen" beteiligt hatte, schaffte er 1969 das Diplom nach neun Semestern. Zum schnellen Lernen trieb ihn auch die nackte Not. 1966 war der Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen, Köhler musste sich sein Studium selbst finanzieren. Auf der Kegelbahn stellte er Kegel auf, in der Gärtnerei steckte er Setzlinge und schuftete auf dem Bau. "Das war richtige Knochenarbeit", sagt seine Schwester.
Ende 1969 muss Horst Köhler wohl zum ersten Mal das Gefühl gehabt haben, dass er es geschafft hat: Er hatte seine Frau Eva geheiratet, bekam eine Referentenstelle am Institut für angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen und wurde Mittelstürmer in der Fußballmannschaft der jungen Wissenschaftler. "Er war ein schwungvoller, lustiger Mensch, von dem man sicher wusste, dass er nicht Professor wird", erinnert sich sein Forscherkollege Adolf Wagner. Denn jahrelang über Büchern zu brüten, lag Köhler nicht. Zwar lieferte er eine sehr gute Doktorarbeit über die Arbeitsmarktwirkungen des technischen Fortschrittes ab, aber er wechselte gern von der Theorie in die Praxis.
Vom späteren Bundesbankpräsidenten Tietmeyer entdeckt
Als Hilfsreferent ging er 1976 in der Grundsatzabteilung des Wirtschaftsministeriums in Bonn an. Dort fiel er dem damaligen Abteilungsleiter und späteren Bundesbankpräsidenten Hans Tietmeyer auf, weil bei ihm spätabends im Büro immer noch Licht brannte. Um den Beförderungsstau zu umgehen, wechselte Köhler 1981 nach Kiel in die Staatskanzlei von Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg. Als der CDU-Politiker nach dem Regierungswechsel Finanzminister wurde, brachte er seinen Redenschreiber wieder mit nach Bonn. Damit war der Karriereturbo gezündet: Innerhalb weniger Jahre rackerte sich Köhler vom Leiter des Ministerbüros zum Abteilungsleiter hoch.
Es waren die goldenen 80er Jahre, die Wirtschaft boomte, Millionen neue Jobs entstanden und Steuern und Staatsverschuldung sanken gleichzeitig - nicht zuletzt dank Stoltenberg und seinem treuen Helfer Köhler. "Der roch die Probleme in den Vorlagen, das hatte er im Urin", erzählen sich Beamte noch heute.
Auch nach dem Ministerwechsel 1989 ging die Karriere weiter. Theo Waigel (CSU) ernannte Köhler zum Staatssekretär, Kanzler Kohl machte ihn zu seinem persönlichen Beauftragten für die Weltwirtschaftsgipfel. Als Manager der Macht hat Köhler so viele Spuren hinterlassen wie kaum ein anderer Beamter zuvor. Er entwarf die deutsch-deutsche Währungsunion. Er handelte das Milliardenabkommen zum Abzug der Roten Armee aus. Er konzipierte wesentliche Teile des Vertrages von Maastricht. Gert Haller, damals Köhlers engster Mitarbeiter und inzwischen Vorstandsvorsitzender der Wüstenrot & Württembergische AG, erinnert sich: "1990 sind wir ein Vierteljahr praktisch gar nicht nach Hause gekommen."
Dieses Pensum wurde selbst dem arbeitswütigen Staatssekretär zu viel - erst recht seiner Frau Eva und den beiden Kindern Ulrike und Jochen. 1993 gab Köhler überraschend sein Amt auf und wurde Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Ein Job, bei dem er weniger reisen musste und sehr viel mehr verdiente. Geld und Zeit brauchte er, um seine Tochter zu fördern, die durch eine schwere Krankheit langsam erblindet war, und um seine kranke Mutter zu pflegen, die ein Jahr später im Alter von 89 Jahren in Bonn starb. "Er ist ein echter Familienmensch", sagt seine Schwester Ursula, "die Familie ist sein Anker."
Die ehemalige Lehrerin ist stark sozial engagiert
Vor allem Köhlers 57-jähriger Frau Eva schreiben Freunde "die segensreiche Wirkung" zu, den abgehobenen Gatten "immer wieder auf den Teppich runterzuholen". Die ehemalige Lehrerin ist stark sozial engagiert. Während ihr Mann als IWF-Chef in Afrika oder Südamerika mit den Regierungen verhandelte, besuchte sie Waisenhäuser und Slums. Der frühere Wirtschaftsberater Helmuts Kohls, Johannes Ludewig, der das Paar seit 1976 kennt, prophezeit, dass Frau Köhler eine gute First Lady abgeben wird: "Eva macht das."
Chef des IWF war Köhler im Jahr 2000 nach einer Zwischenstation bei der Osteuropabank in London geworden. Wie jetzt wieder bei der Kür des Bundespräsidenten war er auch damals nur zweite Wahl. Nachdem Kanzler Schröder seinen Wunschkandidaten bei den Amerikanern nicht durchbekommen hatte, rief er den CDU-Mann zur Hilfe. Und wie immer machte der den Job so gut, dass ihm höhere Aufgaben zugetraut wurden. Zwar kritisieren ihn Globalisierungsgegner von Attac als "Süßholzraspler", der eine neoliberale Politik durchsetze. Doch wie kein IWF-Chef zuvor hat Köhler die Arbeit der globalen Finanzfeuerwehr offen gelegt. Die Vertreter der Mitgliedsländer verabschiedeten ihn mit stehendem Applaus.
Nach sechs Auslandsjahren und mehr als hundert Reisen präsentiert sich der Finanzfachmann nun "bescheidener, offener, neugieriger". Als einer, der glaubt, dass er mit seinen Erfahrungen "Deutschland helfen kann". Das sind nicht nur Sprüche. "Er war ehrlich entsetzt, als er von seiner ersten Afrikareise wiederkam", berichten Gesprächspartner. Mit funkelnden Augen saß Köhler dann bei Kanzler Gerhard Schröder und begeisterte den muffeligen Regierungschef dafür, mehr für den vergessenen Kontinent zu tun. Im Berlin der Machttaktiker und Zyniker wäre ein Bundespräsident Köhler ein Exot. "Der glaubt wirklich, dass man die Welt verändern kann", beteuern Weggefährten.
"Das ist kein ultraliberaler Ökonomist"
"Das ist kein ultraliberaler Ökonomist", sagt auch der Tübinger Theologe Hans Küng. Der von der Amtskirche geschnittene Katholik Küng und der protestantische Christdemokrat Köhler setzen sich gemeinsam für einen weltweiten Grundkonsens über Menschenrechte und -pflichten ein. "Ich teile die Meinung von Hans Küng, dass es kein Überleben des Globus geben kann ohne eine globale Ethik", sagte Köhler in seiner Antrittsvorlesung als Honorarprofessor in Tübingen. "Das ist sein linkes Herz", sagt der einstige Forscherkollege Wagner, der es früher nie für möglich gehalten hätte, "dass der mal in die CDU eintritt". Schließlich ist Köhler fast ein früher Grüner. In den 70er Jahren kämpfte er in seinem Wohnort Mönchberg-Herrenberg als Vorsitzender einer Bürgerinitiative gegen den Bau einer Müllverbrennungsanlage - mit Erfolg natürlich. Seine Frau saß damals im Ortschaftsrat, gewählt auf der Liste der SPD.
Besonders gern zitiert der Ökonom Köhler den Philosophen Karl Popper ("Optimismus ist Pflicht"). Ihm sei es stets um die Frage gegangen: "Was sollen wir tun?", um "die Welt ein wenig besser zu machen". So verteidigt Köhler auch den Vertrag von Maastricht als einen "Versuch, die Welt ein wenig besser zu machen". Seine Vision für den IWF war, "einen Beitrag zu einer besseren Globalisierung zu leisten". Und nun will er versuchen, Deutschland ein bisschen besser zu machen.
Dabei steht der selbstbewusste Kandidat ("Ich bin Köhler") bei seinen ersten Auftritten so dynamisch und übermotiviert am Pult, als könnte er die erstarrte Republik ganz allein in Bewegung versetzen. Immer wieder gehen ihm Hände und Stimme durch ("Wir haben das Potenzial in Deutschland"). Die Beschränkung aufs Repräsentative fällt ihm schwer. Damit schürt Köhler eine Frage: Ist er ein guter Mann am falschen Platz? Als Finanzminister könnte er Theo Waigel und Hans Eichel locker in die Tasche stecken. Als Macher im Schloss Bellevue würde er aber sowohl mit Kanzler Schröder als auch dessen möglicher Nachfolgerin Angela Merkel aneinander geraten - und auch noch gegen das Grundgesetz verstoßen.
Zur Beruhigung seiner Finderin ist das aller Voraussicht nach nächste Staatsoberhaupt der Deutschen am vergangenen Sonntag vor den Präsidien der Unionsparteien eine Selbstverpfichtung eingegangen: "Ich werde immer im Rahmen des Verfassungsmandats des Bundespräsidenten arbeiten." Das musste noch keiner seiner acht Vorgänger versprechen. Aber von Papa Heuss bis Bruder Johannes hatte auch noch keiner das Temperament eines Horst Köhler.