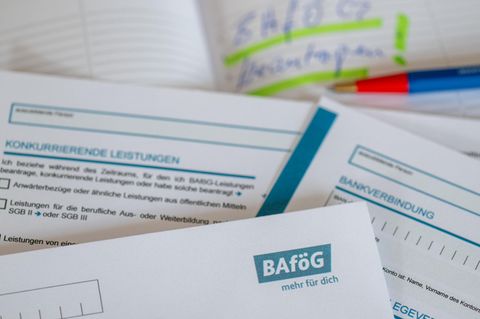Der Streit um die Pendlerpauschale beschäftigt seit diesem Mittwochvormittag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der Zweite Senat prüft, ob die umstrittene Kürzung der Entfernungspauschale rechtmäßig war. Ein Urteil des höchsten deutschen Gerichts wird bis zum Ende des Jahres erwartet. Die mündliche Verhandlung könnte einen Hinweis auf die spätere Entscheidung der Richter geben.
Zum Auftakt der Verhandlung mahnte der Vorsitzende Richter Andreas Voßkuhle Sachlichkeit an: "Das Gericht würde sich freuen, wenn es zu einer rhetorischen Abrüstung käme", sagte der Vorsitzende des Zweiten Senats. "Wir haben nicht zu entscheiden, ob die alte Pendlerpauschale wieder eingeführt werden soll oder nicht", betonte Voßkuhle. Das Gericht habe lediglich zu ermessen, ob die Abschaffung der Pendlerpauschale verfassungsgemäß war oder nicht. Sei dies nicht der Fall, müsse der Gesetzgeber tätig werden.
Vor Beginn der mündlichen Verhandlung zeigte sich Finanzminister Peer Steinbrück zuversichtlich, dass die Ablösung der allgemeinen Pauschale durch eine Härtefallregelung Bestand haben wird. Das Urteil des Zweiten Senats über das von der CSU im bayerischen Landtagswahlkampf herausgehobene Thema wird erst in einigen Monaten erwartet.
Seit 2007 kann Kilometergeld von 30 Cent auf dem Weg zur Arbeit nur noch ab dem 21. Kilometer steuerlich abgezogen werden. Der Einschnitt, durch den der Staat jährlich rund 2,5 Milliarden Euro einspart, trifft etwa die Hälfte der rund 16 Millionen Pendler. Die Kläger sehen darin einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz.
"Wenn ich die bisherigen Steuer-Urteile des Gerichts vor meinem geistigen Auge ablaufen lasse, bin ich zuversichtlich", sagte hingegen Steinbrück. Angesichts der hohen Energiepreise sei die Pendlerpauschale ein politisches Thema mit hohem Symbolcharakter. Wer jedoch die Wiedereinführung fordere, solle sich auch dazu äußern, wo die fehlenden Milliarden herkommen sollten. Wegen der Härtefallregelungen sei die Abschaffung auch nicht ungerecht.
Im Mittelpunkt des Juristenstreits steht das "objektive Nettoprinzip". Es sieht vor, dass Ausgaben, die zur Sicherung des Erwerbs notwendig sind, vor der Besteuerung vom Einkommen abgezogen werden. Für den Bundesfinanzhof gehören alle gefahrenen Kilometer zur Arbeit dazu. Das Finanzministerium verweist dagegen darauf, dass das Verfassungsgericht schon 2002 befunden habe, dass die Fahrten zur Arbeit nicht nur einen dienstlichen, sondern auch einen privaten Charakter hätten. Schließlich könne man sich aussuchen, wo man wohne.
CSU-Chef Erwin Huber kritisierte diese Auslegung erneut als lebensfremd und einseitige Benachteiligung der Arbeitnehmer. Es sei der Ausnahmefall, dass jemand neben seiner Arbeitsstätte wohnen könne, sagte er im Deutschlandfunk. Außer diesem juristischen gebe es auch politische Gründe für eine Rückkehr zur alten Regelung, die aus haushaltspolitischen Gründen gekippt worden sei. Die Energiekosten seien drastisch gestiegen, und die Steuereinnahmen hätten stark zugenommen, so dass die Sparmaßnahme nicht mehr so notwendig sei.
Der Bund der Steuerzahler fordert gar eine Erhöhung der Pauschale auf mindestens 35 Cent pro Kilometer. Sollte die Regierung nach dem Verfassungsgerichtsurteil die Pendlerpauschale für alle wieder einführen müssen, dann aber niedrigere Sätze festsetzen, werde es die nächsten Klagen geben, kündigte Verbandspräsident Karl Heinz Däke in der "Braunschweiger Zeitung" an.