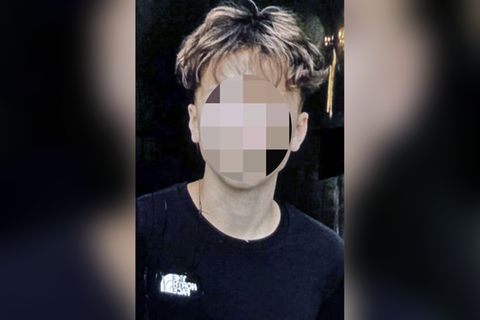Nicht nur die prominenten Beispiele von rechtsextremer Gewalt der letzten Tage lassen Sachsen in einem hässlichen Licht erscheinen. Zahlen, die das Innenministerium auf Anfrage der Linken veröffentlicht hat, sprechen die gleiche Sprache: 167 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte ereigneten sich in der ersten Hälfte des Jahres, 39 davon in Sachsen – so viele wie in keinem anderen Bundesland.
"Das ist eine Machtprobe"
Das Rassismus-Problem sei von der CDU-geführten Landesregierung über Jahre hinweg verharmlost worden, meint Timo Reinfrank von der Amadeu Antonio Stiftung. "Die gefestigte, rechtsextreme Szene testet nun, wie weit sie gehen kann", so der Stiftungskoordinator. "Das ist eine Machtprobe." Zudem habe der jahrelange Verbleib der NPD im Landtag Spuren hinterlassen. Anders als in Brandenburg, wo die Politik konsequent gegen Rechtsextremismus vorgegangen sei und Initiativen wie "Tolerantes Brandenburg" unterstützt habe, seien in Sachsen die Augen vor der Wirklichkeit verschlossen worden.
Offen geführte rassistische Diskussionen um Asylbewerber schüfen einen fruchtbaren Nährboden für extreme Ideologien, so Robert Kusche, Sprecher einer ostdeutschen Opferberatungsstelle im Gespräch mit dem "Tagesspiegel". Gesellschaftspolitisches Engagement und Gegendemonstrationen seien außerdem in Sachsen lange Zeit nicht genügend gefördert worden, vermutet der Informationsdienst "blick nach rechts". Sozial engagierte und ausländerfreundliche Bürger hielten sich daher im Hintergrund, da sie sich in der Minderheit fühlten.
Sachsen bleiben unter sich
Fremdenfeindlichkeit ist dort am größten, wo wenig Konfrontation mit Fremdem besteht – soweit besteht Einigkeit in der soziologischen Forschung. Seit 1990 haben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)" zufolge fast eine Million Menschen den Freistaat verlassen - die meisten davon jung und gut gebildet, zurück bleiben die Älteren und sozial Schwächeren. Der Ausländeranteil betrug nach Angaben des Sächsischen Landtags Ende 2013 gerade mal 2,6 Prozent. Diese relativ homogene Bevölkerungsstruktur begünstigt die Ablehnung des neuen Flüchtlingszustroms.
Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa vermutet ferner, dass sich zahlreiche Sachsen fremd im eigenen Land fühlen, da viele Ämter und Posten von Westdeutschen besetzt sind. In der "FAZ" erklärte er, die Flüchtlinge böten eine "Projektionsfläche für die gebrochene Resonanzachse zwischen etablierter Politik und Institutionen auf der einen Seite sowie auf der anderen Seite weiten Teilen der Bevölkerung, die sich zurückgelassen fühlen."
Alte Wunden heilen nicht
Mit 9,0 Prozent war die Arbeitslosenquote im vergangenen Juli im Osten Deutschlands deutlich höher als im Westen mit 5,7 Prozent. Nicht nur im Freistaat schürt dies Angst vor Konkurrenz, die zum fremdenfeindlichen Klima beiträgt. Auch die spürbaren Folgen der DDR-Vergangenheit teilt Sachsen mit seinen ostdeutschen Nachbarn: Jahrzehntelange Abschottung nach außen durch Ausreisesperren und dem Verbot von Westmedien erschweren noch heute die Offenheit gegenüber Neuem und Fremdem. Timo Reinfrank von der Amadeu Antonio Stiftung bestätigt, dass sich auch in anderen deutschen Regionen Flüchtlinge kaum aus ihren Unterkünften trauten, da ihnen im Supermarkt "Ebola"-Rufe entgegen schallten oder sich Kassiererinnen zum Bedienen Handschuhe anzögen.
Es scheint, als sei Sachsen nur die Spitze des Eisbergs.