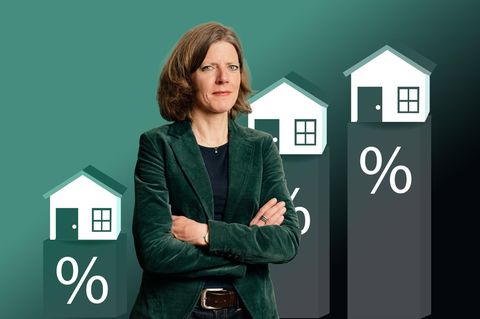Peter Frohn sitzt in seiner Stammkneipe. Am Ohr einen Brilli, am Handgelenk ein Goldarmband - und um den Hals eine Krawatte. "Hör mal", sagt er so laut, dass es alle im Raum hören können, "ich trag so was normalerweise nicht, nur wenn es offiziell wird, klar?" Frohn ist einer von hier, breiter bremischer Akzent, unter dem schwarzen Hemd voll tätowiert. Vor einer halben Stunde hat er noch mit den Geschäftsführern verhandelt, nach Lösungen gesucht, Sozialpläne diskutiert, deshalb die Krawatte. "Es geht um Augenhöhe", sagt er. "Wir wollen so viele Kollegen retten wie möglich."
"Aggressive Spannung in der Luft
Nun sitzt er im Hinterzimmer der "Letzten Kneipe vor New York", direkt am Bremerhavener Kaiserhafen, und raucht Marlboro. Am Tresen rufen Werftarbeiter in Blaumann und Helm die Bedienung "Schätzchen" und wollen Haake-Beck vom Fass oder ein Kännchen Kaffee vor der Nachtschicht.
Seit beinahe drei Jahrzehnten ist Frohn Hafenarbeiter, seit 14 Jahren Chef des Betriebsrats des Gesamthafenbetriebsvereins (GHB) in Bremerhaven - und seit ein paar Wochen letzter Hoffnungsträger Hunderter Kollegen, die ihre Kündigung erwarten. Es ist die dritte große Krise, die der 55-Jährige miterlebt. Doch dieses Mal ist alles anders. "Hier ist eine Panzerplatte runtergeknallt", sagt er. "Du spürst die aggressive Spannung in der Luft, eine Kleinigkeit reicht, dass sich die Leute an die Wäsche gehen." Jeder im Hafen verzichtet auf irgendetwas, meist auf Geld, und wer jetzt nicht voll ranklotzt, wird angeblafft, es geht doch um ihre Jobs!
Klares Feindbild fehlt
Die Krise hat sich festgesetzt, in Bremerhaven viel hartnäckiger als anderswo. Im ersten Quartal ist das Containergeschäft im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel eingebrochen, der Autoumschlag sogar um die Hälfte. Noch vor wenigen Monaten, im Rekordjahr 2008, stapelten sich am Wilhelm-Kaisen-Terminal die Container dreifach und vierfach. Nun liegen Flächen brach. Im Boom mussten die Schiffe vor Helgoland warten, weil alle Plätze an der Kaje belegt waren. Nun klaffen weite Lücken - und den bremischen Häfen droht eine Entlassungswelle. 1050 von insgesamt 2700 GHB-Mitarbeitern werden ihren Job verlieren.
Wütend macht ihn das, sagt Frohn: "Aber du kannst die Wut nirgendwo lassen, du weißt ja nicht, wem du in die Fresse hauen sollst." Es ist einfach keine Arbeit da. Seit Monaten lesen die Menschen in Deutschland, dass es bergab geht, eine Schreckensnachricht jagt die nächste. Doch lange war von der schwersten Wirtschaftskrise seit Menschengedenken im Alltag kaum etwas zu spüren. Erst langsam, ganz langsam nistet sie sich ein, schleichend, wie ein Nebel, der sich über eine Landschaft legt, wie feuchte Kälte, die langsam durch die Kleidung kriecht und einen erschauern lässt.
Immer tiefer dringt die Krise in das Leben der Menschen vor, bringt sie um den Schlaf, lässt sie verzweifeln. "Jetzt sind die großen Räder gebrochen", sagte Bundespräsident Horst Köhler während seiner Berliner Rede Ende März. "Wir werden Ohnmacht empfinden und Hilflosigkeit und Zorn."
Alle sind betroffen
Die Rezession packt das Land. Die Hafenarbeiter in Bremerhaven, die im Herbst arbeitslos sein werden. Die Handwerker und Kleinunternehmer aus Magdeburg, die sich in ihrer Not beim Sorgentelefon melden. Die Leiharbeiter und Putzfrauen, die in Stuttgart gegen ihre Entlassungen klagen. Die Arbeitslosen und Lehrer, die nach Berlin reisen, um gegen die Krise zu demonstrieren. Den Bürgermeister von Salzgitter, der nicht weiß, wie er neue Kindergärten bauen soll. Bandarbeiter und Manager. Große und kleine Leute.
"Am Anfang war die Krise ganz weit weg", sagt Markus Krieger in der Hafenkneipe, kurz vor Beginn seiner Schicht. Er ist Hafenfacharbeiter, seit sieben Jahren fest angestellt beim GHB, bezahlt nach Tarif. Bis Ende Dezember haben sie ganz normal gearbeitet, im Dreischichtsystem Container auf die Schiffe gestapelt, Bananenkisten entladen oder Autos, je nachdem. Macht euch keinen Kopp, hieß es immer.
Dann kam die Kurzarbeit, dann traf es die Zeitarbeiter. Und dann, im März, kamen die Gerüchte von Massenentlassungen, vom Kahlschlag. Unter den Arbeitern ging das Rechnen los, wen erwischt es als Ersten? "Im März wurde mir klar, dass es auch mich treffen könnte", sagt Krieger, der bislang nur den Aufschwung kannte. Früher fuhr er Gabelstapler, heute transportiert er mit einem gigantischen Vancarrier tonnenschwere Container. Er hat sich ein Häuschen gekauft und wird bald zum zweiten Mal Vater. "Jetzt rechne ich fest damit, dass ich es nicht packe."
"Wir wissen, dass dies ein schreckliches Jahr wird"
Einen so rasanten Absturz gab es noch nie. Die deutsche Wirtschaft schrumpft in aberwitzigem Tempo, in diesem Jahr um vier Prozent, fünf Prozent, wer weiß, vielleicht sogar um sieben Prozent. Der deutsche Maschinenbau scheint in sich zusammenzubrechen. Das hat es seit Beginn der Statistik 1958 nicht gegeben. Die Stahlkonjunktur, das Gleiche. Erstmals seit 1928 ist die Zahl der Arbeitslosen in einem März nicht gesunken. "Wir wissen, dass dies ein schreckliches Jahr wird", sagt OECD-Generalsekretär Angel Gurría.
Und doch dauert es, bis die abstrakten Zahlen der Krise den Alltag der Menschen erreichen. Bis nach den Wachstumskurven auch die Lebensläufe tiefe Dellen bekommen. Es läuft ja noch ganz gut im Land: Die Preise für Benzin, Milch und Butter sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, die Inflation ist so gering wie lange nicht, die Reallöhne werden sogar steigen. "Die Konsumenten haben bisher auf die ständigen Hiobsbotschaften erstaunlich gelassen reagiert", sagt Rolf Bürkl von der Gesellschaft für Konsumforschung, die Binnennachfrage steige sogar leicht. "Die Wahrnehmung der Krise ist auf individueller Ebene in Deutschland verzögert", sagt auch Ludger Pries, Soziologieprofessor an der Ruhr-Universität Bochum. "Die Angst sickert erst ganz langsam durch."
Volkmar Linke kann sie hören, die Angst, die Unsicherheit, das Unbehagen. Durch sein graues Telefon kommt die Krise zu ihm, in sein kleines Büro, Raum 260, Wirtschaftsdezernat, Stadt Magdeburg. "Am Anfang hat fast alle fünf Minuten das Telefon geklingelt", sagt Linke. Er arbeitet für die Magdeburger Finanzkrisen-Hotline, ähnliche Initiativen gibt es auch in anderen Städten.
Alle spüren die Krise
Bei ihm rufen Unternehmer in Not an, stammelnd, schimpfend, enttäuscht. Sie haben Angst vor der Insolvenz, vor dem Aus, ihnen gehen die Aufträge aus, sie können ihre Kredite, ihre Rechnungen, ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. "Ein Fliesenleger ist neulich richtig aggressiv geworden", erzählt Linke. "Der hatte keine Aufträge mehr. Aber die kann ich ihm ja auch nicht liefern."
Linke ist eine Mischung aus Seelsorger und Unternehmensberater. Er kann die Gefühle der Menschen in seiner Region nachvollziehen, er hat so etwas ja selbst schon mal miterlebt, damals nach der Wende als Maschinenbauer, als sein Kombinat "zusammenklappte wie ein Kartenhaus".
"Manchmal brauchen die Leute nur ein paar Informationen oder Formulare. Manchmal muss ich sie ein bisschen trösten", sagt er. Linke ist 58 Jahre alt, blaues Brillengestell, über dem Bauch eine Krawatte mit Teddybären. Er spricht die Sprache der Leute hier. "Am Anfang muss man erst mal ein kleines Späßchen machen", sagt er. "Nun mal Kopf hoch, Brust raus, das wird schon wieder. So was hilft."
Vor allem Handwerker wählen die 540 22 22, seine Nummer. Ein Konditormeister, mehrere Frisörsalons, eine Glaserei, eine Autowerkstatt, ein Fliesenleger, sie alle spüren die Krise, noch bevor ihre Angestellten es mitkriegen: Keine Aufträge, kein Geld, "mieser als Hartz IV", sagt eine Frau mit einer Zimmerei. Die meisten erkundigen sich nach Kurzarbeit. "Die Leute haben davon irgendwo gehört, da gibt es viel Nachholbedarf", sagt Linke. Das Antragsformular von der Arbeitsagentur schickt er ihnen per E-Mail zu.
Krise bedeutet Arbeit für die Justiz
In den drei Wochen seit dem Start der Hotline haben Linke und seine Kollegen 35 Unternehmer beraten. Das klingt nicht viel, aber mit den meisten telefoniert er zweimal, dreimal, viermal. Die Gespräche dauern oft eine Stunde. So geht das rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche - nach Feierabend stellt Linke das Telefon auf das Handy seines Chefs um. Die Handwerkskammer hat die Nummer vor drei Wochen in einem Rundbrief an ihre Mitglieder verschickt, vor Ostern hat die Industrie- und Handelskammer den gleichen Rundbrief an ihre 12.165 Betriebe versandt. In den nächsten Tagen erwartet Linke die ersten Anrufe: "Dann brennt hier die Luft", sagt er.
Donnerstag früh, kurz nach halb neun. In der Halle des Stuttgarter Arbeitsgerichts trippeln Kläger und Beklagte unruhig umher, Schweigen, Blicke kleben am Boden. Alle warten auf den Richter, der endlich mit einem Aktenstapel unterm Arm die Treppe herunterkommt. Sie haben Respekt vor dem Mann mit der schwarzen Robe und der weißen Krawatte, der auf dem Richterstuhl Platz nimmt, hinter sich das Wappen Baden-Württembergs. Stefan Funk streicht sich kurz durch das widerspenstige braune Haar, greift eine Mappe aus dem Stoß und nestelt in den Papieren. Ein harter Vormittag wartet auf ihn, alle 15 Minuten ein neuer Fall, streng getaktet.
Ältere vor dem Aus
Wenn die Wirtschaft schwächelt, häufen sich die Kündigungen - und damit die Streitfälle vor Gericht. Allein im März gingen in Stuttgart 1832 Klagen ein, die Hälfte mehr als vor einem Jahr und so viel wie nirgendwo sonst in der Republik. In der Region sitzen die Automobilindustrie und der Maschinenbau, beide sind stark von der Krise betroffen. Noch ist die Arbeitslosenquote mit 4,8 Prozent niedrig. Doch Kurzarbeit und Stellenabbau häufen sich, vor allem bei Zeitarbeitern, Aushilfen, Jugendlichen.
Im stickigen Gerichtssaal geht es um eine Änderungskündigung, ein Gütetermin, die Suche nach einer Einigung, um ein langes Verfahren zu verhindern. Frau S., Mitte 50, frische Dauerwelle, will nicht einfach so akzeptieren, dass sie weniger arbeiten soll - und hat geklagt. Nun sitzt sie hier mit ihrer Anwältin, ihr gegenüber ihre Chefin. Frau S. arbeitet als Putzfrau für eine Reinigungsfirma, seit Jahren ist sie im Einsatz bei einem Automobilzulieferer nördlich von Stuttgart. Papierkörbe leeren, Böden polieren, Toiletten reinigen, was man so macht. Doch der Zulieferer muss sparen und hat den Vertrag mit der Reinigungsfirma gekündigt.
Mehr ist nicht drin
Frau S. ist nun eigentlich überflüssig, soll zunächst statt acht nur noch vier Stunden am Tag arbeiten - für die Hälfte des Geldes. Ein Schlag für die Frau. "Was, wenn ich in ein paar Monaten ganz entlassen werde?", fragt sie. "Dann bekomme ich noch weniger Geld vom Arbeitsamt." Es reiche so schon nicht. Und in ihrem Alter finde sie keinen neuen Job mehr.
"Ich kann nicht ausschließen, dass wir unser Personal noch weiter reduzieren müssen", sagt die Chefin der Reinigungsfirma. Der Richter nickt. Am Ende einigen sich die Parteien. Frau S. wird sofort gekündigt und von ihrer Arbeit freigestellt. Ihr Gehalt erhält sie noch bis Mai, dazu 5000 Euro Abfindung. Mehr ist nicht drin, nicht bei so einem Einbruch. Funk legt die Akte weg, nächster Fall.
Verfahrensflut droht
Im vergangenen Jahr hat jeder Richter durchschnittlich 45 Klageeingänge pro Monat bearbeitet. Im März waren es 70. Der Präsident des Stuttgarter Arbeitsgerichts, Helmut Zimmermann, sieht das mit Sorge. Schon 2008 habe "der Verfahrenseingang beim Arbeitsgericht Stuttgart die konjunkturellen Rahmenbedingungen, insbesondere die Lage auf dem Arbeitsmarkt, gespiegelt", schreibt er in seinem Jahresbericht. Für 2009 drohe nun eine Verfahrensflut, bei der Lage da draußen.
Noch geht es da draußen relativ ruhig zu, doch wie lange die Stimmung der Krise noch trotzen kann, hängt maßgeblich vom Arbeitsmarkt ab. Im März waren 3,6 Millionen Deutsche arbeitslos - und erst langsam wächst das Heer. "Bei der nie da gewesenen Wirtschaftsentwicklung präsentiert sich der Arbeitsmarkt immer noch besser als das, was derzeit in vielen Wirtschaftsbereichen stattfindet", sagt Frank-Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.
Bislang habe es bei den Stammbelegschaften keine Entlassungen gegeben, beobachtet auch IG-Metall-Chef Berthold Huber. "Dies könnte sich aber ab Sommer dramatisch verändern." Mit den ersten Massenentlassungen würde die Krise in die Mitte der Gesellschaft vordringen, würde das Stabile ins Wanken bringen. Michael Sommer, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), warnt vor "sozialen Konflikten in diesem Land, dass es knallt".
Pausenlos Schreckensmeldungen
Noch hält vor allem die Kurzarbeit die Auswirkungen der Krise in Grenzen. Seit Oktober haben die Betriebe 2,15 Millionen Menschen in Kurzarbeit geschickt. Der Sozialstaat kann die Krise abfedern. Doch wenn den Firmen das Geld ausgeht, fliegen auch die Kurzarbeiter raus, schon im Spätsommer, warnen die Banken.
Wie sollte es auch anders sein? Über die Nachrichtenticker laufen pausenlos Schreckensmeldungen: Villeroy & Boch streicht jeden zehnten Arbeitsplatz + 3000 Stellen bei ThyssenKrupp auf der Kippe + Heidelberger Druckmaschinen streicht 5000 Arbeitsplätze + Continental schließt Werk in Hannover - 780 Jobs weg + Kurzarbeit für 68.000 der 141.000 Daimler-Mitarbeiter - weniger Lohn für alle anderen + 3500 Mitarbeiter von Karmann-Pleite betroffen. "Schwarzer Tag für unsere Jobs", titelt die "Bild"-Zeitung.
Bewährungsprobe für die Demokratie
"Die Krise geht auch an kräftigen, gesunden Unternehmen nicht spurlos vorbei", warnt Bundesarbeitsminister Olaf Scholz. "Sie ist eine Bewährungsprobe für die Demokratie insgesamt", sagt Bundespräsident Köhler. Die Krise stellt das Zusammenleben der Menschen infrage, vor allem in Industrieregionen.
Der Oberbürgermeister von Salzgitter legt ein Stück Papier vor sich auf den Tisch und streicht es mit der Hand energisch glatt. Das bisschen, woran Frank Klingebiel sich derzeit orientieren kann, passt auf dieses eine Blatt. "Entwicklung der Gewerbesteuer", steht darauf. Für das Jahr 2008 ist der Balken riesig, für dieses Jahr klitzeklein. Die Differenz: 70 Mio. Euro - fast ein Drittel des Haushalts. "Dass man die einsparen kann", sagt der Bürgermeister ruhig und schaut aus dem Fenster, "das ist völlig utopisch."
Salzgitter: Epizentrum der Krise
Klingebiel, 44, ist in Salzgitter geboren, er hat fast sein ganzes Leben hier verbracht. Seit zweieinhalb Jahren steht der CDU-Politiker seiner Heimatstadt vor, eigentlich eine angenehme Aufgabe. Motoren von Volkswagen, Busse und Lastwagen von MAN, Stahlprodukte der Salzgitter AG, Steuergeräte von Bosch, Triebwagen von Alstom, fünf große Werke bestimmen den Rhythmus der Stadt. Die "Big Five", wie Klingebiel die Unternehmen nennt, haben dafür gesorgt, dass sich Salzgitter zum drittgrößten Industriestandort Niedersachsens entwickelt hat. Jeden zweiten Arbeitsplatz in der Stadt stellen die fünf Firmen und 80 Prozent der Wirtschaftskraft. Ein Segen in guten Zeiten - ein Fluch in Zeiten wie diesen.
Salzgitter spürt wie sonst kaum eine andere deutsche Großstadt die Folgen der Krise. Die Aufträge bei der Salzgitter AG sind im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 60 Prozent zurückgegangen. "So einen Einbruch hat es noch nie gegeben", sagt der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Leese. Die Bestellungen von Nutzfahrzeugen bei MAN brachen sogar um mehr als zwei Drittel ein, und "eine Trendwende sehen wir noch nicht", sagt Konzernchef Hakan Samuelsson. Vier der fünf großen Firmen in Salzgitter lassen kurzarbeiten. "Jetzt sieht man, wie abhängig wir von ihnen sind", sagt Bürgermeister Klingebiel.
Kurzarbeit und Katastrophenstimmung
Die Kurzarbeit gibt den Rhythmus in den Straßen vor. In der Fußgängerzone ist Markt, es ist viel los für einen ganz normalen Wochentag. Die Leute haben Zeit, mehr als ihnen recht ist. Alle paar Meter verstärkt ein leer stehendes Geschäft die gedrückte Stimmung. Es ist, als ob die Krise sämtliche Geräusche geschluckt hätte. Die Leute gehen nicht, sie schleichen. Und es gibt nur ein Thema. Er habe keine Angst, dass es in Salzgitter bald massenhaft Arbeitslose gebe, sagt Klingebiel tapfer, sorge sich aber, "wie lange es noch so weitergehen wird".
Natürlich könnte der Bürgermeister ein paar Millionen aus seiner Stadt herauspressen, ein Schwimmbad schließen oder die Musikschule. Aber die Probleme würden dadurch nur schlimmer. Es ist schon so schwer genug, die Menschen hier zu halten. Nicht einmal 104.000 Einwohner hat Salzgitter noch, jedes Jahr schrumpft die Zahl um 1000. "Wenn sie keine guten Leute mehr bekommen, gehen die großen Firmen weg", sagt Klingebiel.
Noch spielen sie mit. Die Salzgitter AG hat das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent des Nettolohns aufgestockt, auch bei MAN haben die Verantwortlichen sich zu diesem Schritt durchgerungen. Bis Mitte nächsten Jahres könnte das noch so weitergehen. Bisher gibt es keine Entlassungen. Bisher.
Bärenmäßige Enttäuschung
Andreas Link hat in Salzgitter schon eine Menge erlebt, aber so etwas noch nie. Der Betriebsrat von MAN lässt seine Hand wie einen Achterbahnwaggon erst über die Kuppe und dann sehr tief nach unten sausen. "Diesmal ist es so richtig abgestürzt", sagt er. Das ist es, was ihn und seine Kollegen so beunruhigt. Fünf Jahre lang hat MAN einen Rekord nach dem anderen erzielt. Und jetzt das. Kurzarbeit und Katastrophenstimmung. "Die Leute sind bärenmäßig enttäuscht", sagt er, "wir haben samstags gearbeitet, wenn es sein musste, sogar am Sonntag - und jetzt werden wir weggelegt wie ein kaltes Bügeleisen."
Der Ton wird rauer, auch in Salzgitter. Betriebsratschef Hasan Cakir musste ganz schön kämpfen, bis sein Arbeitgeber, die Salzgitter Flachstahl, bereit war, den Mitarbeitern auch während der Kurzarbeit 90 Prozent ihres Lohnes auszuzahlen. "Es gab lange Diskussionen und Streitereien", sagt er. Und zum ersten Mal fielen auch die Worte, die keiner hören will: "Betriebsbedingte Kündigungen". Es war wie ein Weckruf. Mehrere Tausend Mitarbeiter haben in Salzgitter gegen die Pläne protestiert. Und neulich, an einem Wochenende, sind die Arbeiter dann nach Berlin gefahren, mit 17 Bussen. Jeder sollte sehen, dass Salzgitter keine Lust hat, das Desaster allein auszubaden.
"Mit 70 meine erste Demo"
Etwa 30.000 sind nach Berlin gekommen, aus allen Teilen Deutschlands. Sie haben Schilder dabei und Transparente. "Weg mit Hartz IV" steht da oder "Es war nicht alles schlecht im Kapitalismus" oder "Mit 70 meine erste Demo". Es ist ein ziemlich bunter Haufen, Stahlarbeiter, grauhaarige Lehrer, junge Studenten, Familien, Singles, Angestellte, Selbstständige. Irgendwie geht diese Krise ja jeden an. Dutzende Organisationen haben aufgerufen, Motto: "Wir zahlen nicht für eure Krise!"
Auch Stefan Müller (Name geändert) aus Hamburg ist an diesem Morgen um sechs Uhr aufgestanden, um dabei zu sein. Er sieht müde aus. Eigentlich könnte er sich jetzt ein bisschen ausruhen, der Bus zur Demonstration nach Berlin braucht fast vier Stunden. Aber er muss lernen, der 37-jährige Büroschlosser wird gerade zum Elektriker umgeschult.
Kurzarbeit, Umschulung und Existenzangst
Es ist kurz vor acht Uhr. Vor dem Hamburger Hauptbahnhof haben sich mehr als 300 Menschen gesammelt. Sie wollen alle in die Hauptstadt, zur ersten großen Demo gegen die Krise. Sieben Busse werden von Hamburg Richtung Osten rollen, organisiert von Attac und der Linken. Die meisten haben sich vorher über das Internet angemeldet, aber nicht alle haben schon bezahlt. Eine Frau sammelt mit einer Klarsichtfolie die 15 Euro ein.
Müller hat noch 50 Cent bis zum Ende des Monats, er ist Hartz-IV-Empfänger. Er kann sich die Fahrt eigentlich nicht leisten, hat bei den Organisatoren angerufen, ob sie ihn auch so mitnehmen. Er hat Angst, dass ihm bald das bisschen, das er zum Leben hat, auch noch genommen wird. "Wenn es ganz hart kommt", sagt er, "werden die Sozialleistungen gekürzt."
Im Bus läuft das Radio. Ein Bericht aus London, einer der Hauptstädte der Finanzkrise, es geht um Banker, die sich in der Öffentlichkeit fürchten, die ihre Nadelstreifenanzüge deshalb gegen Jeans tauschen. Ein paar Fahrgäste verteilen Flugblätter und Heftchen, Aufrufe für die nächsten Demos, Kampfschriften gegen das System.
Ja, das System ist schuld
Endlich in Berlin, die Masse schiebt sich durch die Mitte der Stadt. Es ist friedlich, vielleicht auch deshalb, weil ein klares Feindbild fehlt. Ja, das System ist Schuld, sagen die meisten, aber das System kann man schlecht mit Eiern beschmeißen.
Vor dem Roten Rathaus, vorn auf der kleinen Bühne spricht Gregor Gysi. Der Chef der Linken gestikuliert wild und schreit, dass jetzt mal die zur Kasse gebeten werden sollen, die Schuld an der ganzen Misere sind. Und dass dieses Land eine Vermögenssteuer braucht, die ihren Namen auch verdient hat. Die Zuhörer johlen Zustimmung. Stefan Müller klatscht vorsichtig in die Hände. Soll dies der Anfang des Aufstands sein?
Noch ist das Land gelassen. Erstaunlich gelassen. "Alle Indikatoren deuten daraufhin, dass es schlimmer wird als 1929. Doch es gibt eigentümlicherweise keine öffentlich feststellbare Unruhe", sagt Hans-Ulrich Wehler, Deutschlands bedeutendster Sozial- und Wirtschaftshistoriker. Im Ausland, ja, da schlägt sich der Zorn schon auf der Straße nieder, da werden die Häuser von Bankern angegriffen, Manager als Geiseln genommen, sogar mit dem Tode bedroht. Aber hier? "Der Funke schlägt nicht über", sagt Wehler.
Um kurz nach fünf ist auch der Anfang vom Aufstand in Berlin beendet. Vor dem Roten Rathaus fegen sie Flugblätter zusammen. Die Busse rollen aus der Hauptstadt und bringen die Menschen zurück in ihr Leben. Hier links, sagt der Busfahrer, ist das berühmte Kaufhaus Lafayette, "das berühmte Kaufhaus RAF" versteht einer. Alle lachen.