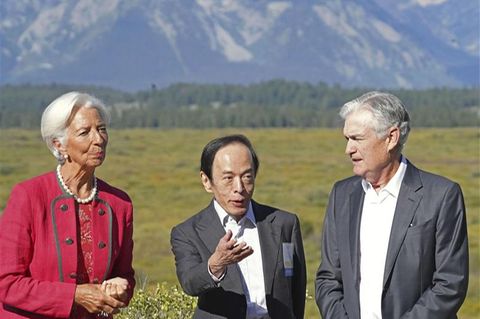Soll die Europäische Zentralbank (EZB) Staatsanleihen kriselnder Eurostaaten kaufen oder nicht? Über diese Frage ist eine Debatte entbrannt, die kontroverser kaum sein könnte. Der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Wirtschaftsweise Wolfgang Franz nennt die Anleihekäufe die "Todsünde einer Zentralbank". Bundesbankpräsident Jens Weidmann warnt vor den hohen ökonomischen Kosten einer Staatsfinanzierung durch die Notenpresse der EZB. Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) spricht sich klar gegen eine Lösung der europäischen Schuldenkrise mithilfe der Notenpresse aus.
Sie alle befürchten: Wenn die EZB für den Anleihenkauf frisches Geld in den Markt bringt, könnte das die Inflation anheizen. Außerdem würden hochverschuldete Staaten keinen Anreiz mehr sehen, zu sparen - die EZB kauft ja die teuren Anleihen.
Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite stehen renommierte US-Ökonomen wie Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, der das Gegenteil empfiehlt: Die EZB solle massiv Staatsanleihen kaufen, um die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu beenden. Auch Frankreich und Spanien drängen zu einem weiteren Eingreifen der EZB auf den Finanzmärkten. Sie wollen, dass die Notenbank in großem Stil Staatsanleihen ankaufen darf.
Bricht die Eurozone auseinander?
Soll die EZB nun Staatsanleihen kaufen, um die Märkte zu beruhigen? Oder ist die Gefahr einer Inflation zu hoch? Das Problem ist: Niemand kann vorhersehen, was wirklich geschieht, wenn die EZB die Finanzmärkte ihren eigenen Kräften überlässt. Ersticken die Länder unter ihre Zinslast? Bricht die Eurozone auseinander? Kehren die Länder zu ihren nationalen Währungen zurück? Gibt es dann ein Nord- und ein Südeuropa?
Die Situation auf den Anleihemärkten lässt darauf schließen, dass Investoren solche Szenarien nicht mehr für utopisch halten. Es sind nicht mehr nur die Papiere aus Griechenland, Portugal und Irland, deren Zinsen auf schwindelnde Höhen klettern. Spanien musste den Anlegern am Donnerstag fast sieben Prozent Rendite bieten. Auch die Risikoaufschläge für französische und belgische Staatsanleihen sind auf Rekordstände gestiegen – dabei sind es Länder, die bislang noch eine hohe Bonität genießen.
"Ich kann mir die Kursentwicklungen nur so erklären, dass die Märkte mit einem Auseinanderbrechen der Eurozone rechnen und schon Wechselkursrisiken zwischen den nationalen Währungen mit eingepreist sind", sagt Jens Boysen-Hogrefe vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel im Gespräch mit stern.de. Dabei sei die Lage in Italien oder Spanien gar nicht mit Griechenland vergleichbar. "Das sind keine fiskalpolitischen Hazardeure. Sie haben Sparprogramme aufgelegt und die Schulden sind nicht so hoch, als dass sie damit nicht leben könnten. Die Märkte sind derzeit hysterisch"
Langfristig kann es nicht Aufgabe der EZB sein, Anleihen zu kaufen
Deshalb, sagt er, müsse die Politik oder im Zweifel eben auch die EZB ein klares Signal geben, dass die Spekulationen keine Substanz haben. "Wenn die Stimmung an den Märkten anhält oder sich weiter verschärft, bleibt der EZB nichts anderes übrig als Staatsanleihen zu kaufen, um die Stabilität im Euroraum zu wahren." Zumindest als akute Maßnahme.
Andere Wissenschaftler, wie etwa Kai Carstensen vom Münchner ifo Institut, halten es für falsch, dass die EZB überhaupt Anleihen kauft. Es sei eine Illusion zu denken, dass die EZB wirklich etwas Nachhaltiges ausrichten kann. "Sie kann wohl kurzfristig Spitzen von Renditeausschlägen abmildern, aber dauerhaft gelingt ihr das nicht“, sagt er im Gespräch mit stern.de. Bisher hätten die Anleihekäufe der EZB kaum Auswirkungen gehabt. „Die Zinsen von griechischen, portugiesischen und irischen Staatsanleihen sind nach wie vor sehr hoch.“
Die deutschen Experten sind sich jedoch einig: Es kann langfristig nicht die Aufgabe der EZB sein, Anleihen kriselnder Staaten zu kaufen. Denn das würde Dynamiken in Gang setzen, die schädlich für Europa sind:
Inflation wäre eine Vergemeinschaftung der Schulden
- Es könnte zu einer massiven Inflation kommen, weil die EZB für den Kauf von Staatsanleihen frisches Geld in Umlauf bringt. Das würde einer Vergemeinschaftung der Schulden gleich kommen, denn die Zeche würden alle in Form von höheren Preisen bezahlen. "Vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen, die man in Deutschland mit Hyperinflationen gemacht hat, ist das Thema natürlich ein sehr sensibles", sagt Ernst Fahling, Wirtschaftsprofessor von der International School of Management (ISM). Kaufe die EZB unbegrenzt Anleihen, "dann kommt die Notenpresse nicht mehr zum Stillstand", warnt Fahling. Außerdem rechnen Anleger in einem solchen Fall mit einer zukünftigen Inflation und fordern einen Aufschlag bei den Staatsanleihen. Folglich steigen auch die Zinsen, der Rettungseffekt verpufft.
- Die von der EZB gekauften Anleihen könnten im Kurs weiter abfallen. Die EZB würde abschreiben müssen. Der deutsche Steuerzahler würde für einen Großteil der Verluste aufkommen müssen: Das Land trägt immer 27 Prozent des Risikos, entsprechend ihrer Quote am Zentralbank-Kapital. Die EZB müsste die Regierungen um neues Kapital bitten, obwohl sie eigentlich unabhängig sein sollte.
- Die Regierungen der verschuldeten Länder hätten weniger Druck, ihren Haushalt in den Griff zu bekommen, weil sie nicht durch hohe Zinsen auf ihre Anleihen bestraft würden. Das könnte den Effekt haben, dass diese Staaten nicht rigide genug sparen, was die Krise verschärfen würde.
- Die Glaubwürdigkeit der Europäischen Zentralbank würde beschädigt werden, weil sie indirekt Staatsschulden finanziert. "Geldpolitik basiert auf dem Vertrauen auf die Institutionen. Wenn man es missbraucht, um kurzfristige Beruhigungen zu erzeugen, schädigt man das Vertrauen.", sagt Carstensen vom ifo Institut. Auch das könnte die Finanzmärkte beunruhigen.
Die Notenbank selbst pocht auf ihre Unabhängigkeit
Deshalb fordert Oliver Holtemöller vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) langfristige Mechanismen, die verhindern, dass Staaten zu viele Schulden aufbauen. „Außerdem muss klar sein, was passiert, wenn ein Land überschuldet ist. Ohne eine glaubwürdige Drohung, dass es schlimmstenfalls auch zu einer Staatsinsolvenz kommen kann, wird es nicht gelingen, Staaten und deren Kapitalgeber hinreichend zu disziplinieren.“
Die Notenbank selbst pocht in all dem Gerangel auf ihre Unabhängigkeit. Die Glaubwürdigkeit der EZB sei im Erfolg ihrer Geldpolitik begründet, mit der sie die Inflation eindämme, sagt am Freitag EZB-Präsident Mario Draghi. "Das ist der Beitrag, den wir leisten können, um das Wachstum, die Schaffung von Arbeit und die Finanzstabilität zu unterstützung." Dabei hat die Notenbank schon seit Mai 2010 deutlich mehr gemacht - und damit ihre Kompetenzen überschritten. Bis Ende vergangener Woche hatte sie Staatsanleihen in Höhe von 187 Milliarden Euro aufgekauft. "Das", sagt Fahling von der International School of Management, "ist eigentlich schon ein Sündenfall."