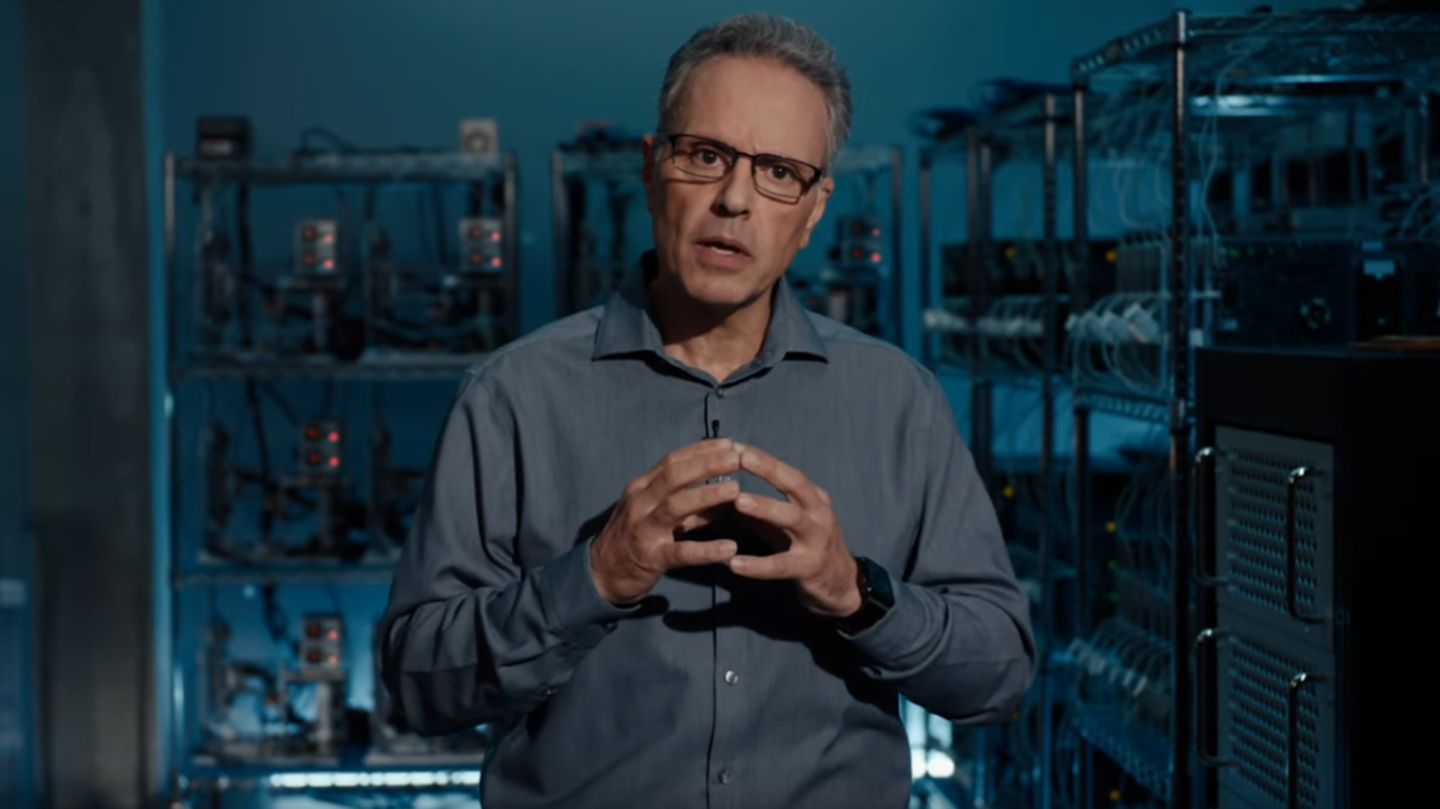Johny Srouji ist einer der einflussreichsten Männer des Silicon Valley - doch seinen Namen dürften bislang selbst langjährige Technik-Fans kaum gehört haben. Das änderte sich schlagartig an diesem Montag, als der 56-Jährige im Rahmen der diesjährigen Eröffnungs-Keynote derApple-Entwicklerkonferenz WWDC ins Rampenlicht trat.
Und einen fulminanteren Auftritt konnte sich Srouji, Leiter von Apples Chipentwicklung, wohl kaum wünschen: Die Keynote dauerte bereits anderthalb Stunden, das Pulver schien längst verschossen, als Tim Cook noch ein Ass aus dem Ärmel zog. Der Apple-Chef gab bekannt, dass Mac-Computer zukünftig mit eigenen Chips ausgestattet werden, die auf derselben Technologie fußen wie jene, die bereits heute in mehr als einer Milliarde iPhones und iPads den Takt angeben. Dieser Schritt sei nicht weniger als "der Beginn einer neuen Ära", frohlockte Cook.
Geprägt wird diese Ära maßgeblich von Srouji. Wer ist der Mann, der in hohem Maße für die Entwicklung des iPhone, iPad und der Apple Watch verantwortlich ist - und der nun Apples Rechen-Revolution vorantreiben soll?
Apples Chip-Flüsterer
Srouji wurde 1964 in Haifa, einer Hafenstadt im Norden Israels, geboren. Er war das dritte von vier Kindern, sein Vater besaß eine kleine Fabrik für Gussformen. Schon früh begeisterte er sich für Naturwissenschaften und Computer, am Technion - Israel Institute of Technology erwarb er einen Bachelor- und Master-Abschluss in Informatik.
Nach dem Abschluss erhielt Srouji eine Stelle bei IBM, das seine größte nicht amerikanische Forschungseinrichtung in Haifa angesiedelt hatte. Er forschte an verteilten Systemen, einem vielversprechenden Gebiet, in dem Computer an verschiedenen Standorten miteinander vernetzt werden, um rechenintensive Aufgaben zu erledigen.
1993 wechselte er zu Intel, dort blieb er bis 2005. Nach einem erneuten Zwischenstopp bei IBM stieß er zu Apple. Angeheuert wurde er von Bob Mansfield, einem Apple-Urgestein und einer der engsten Berater von Steve Jobs. Mansfield lockte ihn mit der Möglichkeit, etwas von Grund auf Neues aufbauen zu können.

Eigene Chips waren der Grundstein für den Erfolg
Das war 2008, zu diesem Zeitpunkt war das iPhone gerade einmal ein Jahr auf den Markt. Das Gerät galt als die Zukunft, krankte aber an den Problemen der Gegenwart. Die Akkulaufzeit war gering, das Telefon funkte nur auf einer langsamen 2G-Verbindung, vor allem aber war es untermotorisiert. Jobs wusste, wenn er langfristig einen Unterschied machen wollte, würde er nicht um die Entwicklung eigener Chips herumkommen.
Als Srouji bei Apple anheuerte, arbeiteten 40 Ingenieure daran, Chips von verschiedenen Zulieferern ins iPhone zu integrieren. Im April 2008 vervielfachte sich die Zahl auf 150 Mitarbeiter, nachdem Apple die PowerPC-Entwicklerfirma P.A. Semi aufgekauft hatte. Srouji übernahm die Leitung, seine erste große Aufgabe war die Entwicklung des Apple A4, des ersten hauseigenen SoCs.
Die Abkürzung SoC steht für "System-on-a-Chip". Während auf einem PC-Mainboard Schaltkreise und Komponenten wie Arbeitsspeicher in der Regel ausgelagert sind, hat ein SoC sämtliche wichtigen Hardware-Elemente wie Bildsignalprozessor und Speichercontroller auf einem Chip vereint. Nur so lassen sich die leistungsstarken, aber trotzdem schlanken Smartphones, wie wir sie heute kennen umsetzen.
Einen eigenen SoC zu entwickeln, statt einen einzukaufen, ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produkte in einem Detailgrad anzupassen, dass sie perfekt zu den Funktionen seiner Software passen und zugleich die kritische Balance zwischen Geschwindigkeit und Batterieverbrauch wahren. Knapp zwei Jahre nachdem Srouji seine Arbeit bei Apple aufgenommen hatte, enthüllte Steve Jobs das iPad. Die Welt feierte den riesigen Touchscreen, doch die eigentlich bahnbrechende Technologie war für das Auge unsichtbar: der A4-Chip.
Srouji sei "die wichtigste Apple-Führungskraft, von der Sie noch nie gehört haben", schrieb einmal das US-Wirtschaftsportal "Bloomberg". Im Dezember 2015 stieg er bei Apple als Senior Vice President für Hardwaretechnologien in die Geschäftsleitung auf, er berichtet direkt an Tim Cook.
Hinter der Magie stecken Hunderte Ingenieure
Mit jeder Generation verbesserte Apple seine Chip-Designs weiter. Die Grafikleistung des iPads habe sich innerhalb eines Jahrzehnts vertausendfacht, rechnete Srouji während der Keynote vor. Die Fortschritte sind so immens, dass die iPhone-Prozessoren in puncto Geschwindigkeit denen der Android-Konkurrenz schon vor Jahren enteilt sind.
Längst beschränkt sich der Konzern nicht mehr auf Rechenchips: Mittlerweile sind die Geräte vollgestopft mit Komponenten, die für einzelne Anwendungen optimiert wurden. Einige steuern die Künstliche Intelligenz, andere zählen die Schritte des Nutzers, optimieren die Grafik von Videospielen oder verschlüsseln private Daten und packen sie in eine Art virtuellen Tresor.
Erst das Zusammenspiel all dieser Elemente sorgt für die von Apple-Managern gern beschworene "Magie". Doch selbstverständlich ist nichts Übernatürliches daran, wenn sich Kopfhörer besonders schnell mit dem Telefon verbinden oder ein Computer mit einer Armbanduhr entsperrt wird. Es ist lediglich das Ergebnis vieler Arbeitsstunden der Ingenieure, die in streng abgeschirmten Laboren in Apples Heimatstadt Cupertino und in Herzliya, Israel, an neuen Bauteilen tüfteln.
Am Ende geht es um Leistung pro Watt
Einen kleinen Einblick in eines dieser Labore konnte man im Rahmen der Keynote erhaschen. In schwarzer Jeans und grauen Hemd stand Srouji in einem sonst streng von der Außenwelt abgeschotteten Raum, umringt von Dutzenden Computern und Apparaturen, während er erklärte, worauf es bei Chips seiner Meinung nach wirklich ankommt: auf die Leistung pro Watt.
"Das iPhone verlangte Leistung und Fähigkeiten, die in einem so kleinen Gerät als unmöglich angesehen wurden", sagt der 56-Jährige. Weil der Platz begrenzt, der Rechenbedarf jedoch groß war, musste sich das Team auf das beste Verhältnis von Leistung pro Watt konzentrieren. "Und jetzt bringen wir all dieses Fachwissen und den gleichen fokussierten und disziplinierten Ansatz in den Mac ein." Srouji ist überzeugt, der Umstieg von Intel- zu hausgemachten Prozessoren werde den Mac auf "ein völlig neues Leistungsniveau" heben.
Offene Fragen
Aber sind die ARM-Chips von Apple tatsächlich leistungsfähig genug, um solche von Intel und AMD zu ersetzen? Das ist immer noch eine offene Frage - auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference scheute sich das Unternehmen, eine endgültige Antwort zu geben. Apple ging es in erster Linie darum, die Welt auf den Wandel vorzubereiten (hier erfahren Sie warum). Die für das Unternehmen typischen Diagramme, Benchmarks und Superlative, die sonst jede neue Generation von Silizium Made in Cupertino flankieren, fehlten. Mehr als kurze Demos und vage Versprechungen gibt es noch nicht. Und auch der Fokus auf die Formulierung "Leistung pro Watt" lässt rätseln. Mag sein, dass Apple die effizientesten Chips baut - aber sind es auch bei Computern die besten und schnellsten?
Doch man sollte die kurzen Einblicke vom Montag auch nicht überbewerten, womöglich gibt der Konzern weitere Details bekannt, sobald es konkrete Produkt gibt. Der erste Mac mit Apple-Chip soll bereits in diesem Jahr erscheinen. Ohnehin wird der Konzern mindestens zwei Jahre zweigleisig fahren. Denn zumindest öffentlich gibt Apple Intel nicht den Laufpass. Apple plant nicht nur, in der Zukunft noch einige Mac-Rechner mit Intel-Chips vorzustellen, das Unternehmen versicherte zudem, man werde "auch in den kommenden Jahren weiterhin neue Versionen von MacOS für Intel-basierte Macs unterstützen und herausbringen".
Chips aus der Folterkammer
Mit dem Umstieg von Intel auf eigene Chips gewinnt Apple auch die Kontrolle über Innovationen in seinen Computern und muss nicht mehr länger die zuletzt immer unvorhersehbaren Innovationszyklen von Intel abwarten. Das bietet Chancen, aber auch Risiken. Die Entwicklung von Chips verzeiht keine Fehler, jeder einzelne Transistor muss funktionieren. Um das zu gewährleisten, testet Apple in speziellen Testlaboren jedes Bauteil wochen- oder gar monatelang unter widrigsten Umständen.
Der stern besuchte im vergangenen Jahr eines der Geheimlabore, in dem Chips etwa mit starken Temperaturschwankungen von -40 bis +110 Grad Celsius traktiert werden. Diese Prozessor-Folterkammer soll sicherstellen, dass die Hardware selbst unter Extrembedingungen nicht zu Fehlern neigt. Schließlich könnten Hacker solche Umstände absichtlich herbeiführen, um etwaige Schwachstellen auszunutzen. Die Ingenieure gehen deshalb auf Nummer sicher und fordern das Silizium mitunter mehr, als es auszuhalten vermag. Denn stecken die Chips erst einmal in Abermillionen Geräten in der freien Wildbahn, ist bei einem nicht entdeckten Fehler der Schaden groß.
Kosten in Milliardenhöhe
Deshalb verlassen sich viele Hersteller lieber auf Spezialisten wie Qualcomm und Intel, die Chips im großen Stil produzieren. Das ist aus vielen Gründen nachvollziehbar, allerdings steigt dadurch die Uniformität der Geräte. Oder anders ausgedrückt: Wenn in jedem Smartphone derselbe Chip steckt, ist die Nutzererfahrung überall die gleiche. Um sich von Mitbewerbern abzuheben, setzen daher auch Samsung und Huawei - nach Verkaufsvolumen die beiden größten Smartphone-Hersteller der Welt - in ihren Telefonen auf hauseigene Chips,
Hinzu kommt: Die Wissenschaft des Siliziums ist kostspielig und komplex - und man kann sich leicht an ihr übernehmen. Davon kann auch Apple ein Lied singen: Die Entwicklung eigener Chips für den Mac war ein Ziel, das der Konzern in den 80ern und 90ern schon einmal verfolgte. Am Ende wurden Milliarden in den Sand gesetzt, ohne dass ein marktreifes Produkt entstand. Der Vorstoß in das Geschäft mit komplizierten und teuren Chips ist nur dann sinnvoll, solange das Unternehmen 300 Millionen Geräte pro Jahr verkauft, rechnete "Bloomberg" einmal vor.
Dennoch: Die Entwicklung der hochspezialisierten, nicht einmal briefmarkengroßen Chips verschlingt nicht nur jede Menge Geld. Wenn man alles richtig macht, spülen sie ein Vielfaches der Kosten zurück in die Kasse. Denn erst das Zusammenspiel der verschiedenen Geräte macht das Apple-Ökosystem attraktiv, wofür wiederum viele Kunden bereit sind, mehr Geld auszugeben. Die Chips sind somit ein essenzielles Bauteil von Apples Gewinnmaschine.
Die Aktienoptionen im Wert von rund 10 Millionen Dollar, die Teil von Sroujis Beförderung im Dezember 2015 waren, dürften sich für Cook bislang jedenfalls ausgezahlt haben.