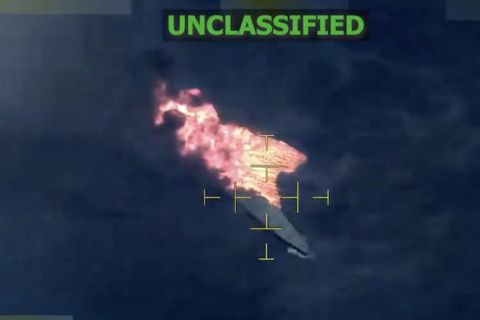Es bleibt die Frage, wo Igor hingehen soll. Zwei Tage war er weg. Er sagt: auf der Wache. Vielleicht stimmt das sogar. Wer einmal im Knast war, landet dort schnell. Wer Drogen nimmt, auch. Vielleicht aber tauchte Igor einfach nur ab. Igor könnte zu Aljona gehen, seiner Freundin. Ihr geht es schlecht, sie kann sich kaum bewegen, sie liegt in der Wohnung ihrer Eltern, wegen des Kaiserschnitts. Ilja, das Baby, ist erst ein paar Tage alt. Igor wird auf jeden Fall ein guter Familienvater sein, das ist sein Plan. Er hat ja auch sonst Glück. "Ich bin 48 Jahre alt", sagt Igor, "und lebe noch."
Er könnte zu Aljona, er könnte allerdings auch zum Boulevard der Kosmonauten, Igors zweites Zuhause. Dort wohnen sein Vater und manchmal auch andere, das weiß man nie so genau, wenn man ein paar Tage nicht da war. Meistens hängen alle in der Küche ab. Man kann am Mittwochmittag kommen oder am Dienstagmorgen, jeder Tag fühlt sich wie ein Samstagabend an, allerdings wie einer mit zu viel Alkohol und Drogen. Hier wird niemand fragen, wo Igor war, schon allein deshalb nicht, weil sich niemand mehr genau daran erinnert, was vor zwei Tagen passiert ist.
Drogen-Alltag in der Küche
Igor entscheidet sich erst einmal für den Boulevard. Vor dem Haus sitzt eine Nachbarin auf der Bank und mustert ihn voller Verachtung. Igor eilt weiter, schnell die Treppen des Plattenbaus hoch. Im Wohnungsflur liegen Kisten, irgendwer hat eine der Zimmertüren mit einer Axt zerhackt. Vielleicht auch eingetreten, je nachdem, wer die Geschichte gerade erzählt. Das Klo ist kaputt. In den Zimmern: Müll, zerwühlte Betten, dreckiges Zeug.

In der Küche steht sein Freund Mischa in Unterhosen. Er kann misslaunig sein und wortkarg, aber heute ist er es nicht. "Ich fühle mich wie eine Blume!", ruft er. Daneben sitzt Julija, die alle daran erkennen, dass sie auf einem Auge kaum noch etwas sehen kann. Julija, Friseurin, war eine der Letzten in ihrem Freundeskreis, die Drogen ausprobierten. Ihr Mann, ihr Bruder, alle hingen längst drin. Den Bruder fand sie später auf dem Dachboden, aufgehängt an seinem Armeegürtel. Nur ihr Sohn, fast volljährig, nimmt nichts, ist sie sicher. Zur Vorsicht soll er bald zur Armee, weg vom Hof, raus aus der Stadt. Wanja, der hagere Nachbar von oben, raucht mit geschlossenen Augen. Er redet nur selten. Einmal hat er sich im Rausch aus dem Fenster geworfen, weil er dachte, er könne fliegen. Das passiert immer häufiger, seit neue Drogen im Umlauf sind: Fentanyl, Amphetamin, Salze und Spice, alles Designerstoffe, die immer anders wahnsinnig machen. Wanja blieb an der Klimaanlage draußen an der Hauswand hängen, er überlebte. Um nichts anderes geht es hier ja.
Der Absturz Toljattis
Igor lebt in Toljatti, was in seiner Kindheit noch wie ein Versprechen klang. Die Stadt liegt an der Wolga, der Name aber stammt aus Italien. Dort kauften die Sowjets in den 60er-Jahren die Lizenz für den Fiat 124 ein, Auto des Jahres 1967. Die Menschen träumten von Aufbruch, Wohlstand, einem Leben fast wie im Westen. Der neue Staatskonzern "Awtowas", der nur gebaut wurde, um das italienische Auto herzustellen, wuchs bald zur größten Autofabrik Osteuropas. Mehr als 150.000 Menschen montierten dort Schigulis, im Ausland als Lada bekannt. Bis Ende der 90er-Jahre sahen die kleinen kastigen Wagen noch aus wie das Auto des Jahres 1967. Die Stadt, das waren die Plattenbauten um die Fabrik herum.
Während der Perestroika Anfang der 90er-Jahre fuhr das halbe Land mit diesen Wagen, natürlich nur deshalb, weil sie billig waren. Die Fabrik erstickte dennoch an Schulden. Jedes verkaufte Auto brachte neue Verluste, dafür strichen die Händler Gewinne von über hundert Prozent ein. Wer in der Fabrik arbeitete, galt jahrzehntelang als Glückspilz. Und auf einmal, so schien es, hatte er alles falsch gemacht. Das Leben stand Kopf.
Bereits in den 80er-Jahren kletterten Banden durch löchrige Zäune auf das Fabrikgelände und klauten, was zu kriegen war: Schrauben und Benzin, Reifen, Türen. Wenige Jahre später benutzten die Gangster den Haupteingang, hatten Hausausweise, bestellten Autos am Förderband oder verabredeten sich zu Schießereien zwischen den Werkshallen. Alle raubten die Fabrik aus, selbst die Manager. Im verbrecherischen Russland der 90er-Jahre erlangte Toljatti bald den zweifelhaften Ruhm, eine der kriminellsten Städte zu sein: ein Dutzend Banden, vier Mafia-Kriege, mehrere Hundert Tote – so die blutige Bilanz der jüngsten Stadtgeschichte. Auch Igor entschied sich damals für die Seite der Gewinner, also der Drogenhändler, Banditen und Erpresser. Die Knast-Tattoos auf seinem Rücken trägt er mit Stolz, als Beweis dafür, dass er es auf seine Art zu etwas gebracht hat.

Ein Artikel aus ...
... JWD. Joko Winterscheidts Druckerzeugnis. Die 13. Ausgabe gibt es ab 27. Juni am Kiosk – oder hier.
Die Banden überfluteten Toljatti mit Drogen. Erst spülten sie Heroin in die 700.000-Einwohner-Stadt, billig eingeführt aus Tadschikistan. 2005 verkaufte die größte Dealer-Bande, benannt nach ihrem Chef Sergej Sudakow, täglich mehr als zehntausend Schuss. Sudakow fuhr mit seinem Hummer oder dem Porsche Cayenne durch die Plattenbauviertel. Mit den Polizisten verstand er sich so gut, dass Ermittler aus ganz Russland anrücken mussten, um die Bande zu stoppen. Aber die Drogen blieben.
Drogen sind in Russland in der Mitte der Gesellschaft
Bis heute spritzen sich in kaum einem anderen Land so viele Menschen Drogen wie in Russland. 2010 sprach der damalige Chef der zentralen Drogenbehörde, Wiktor Iwanow, von einer "Drogen-Apokalypse": Nach offiziellen Statistiken waren 2014 mehr als 1,5 Millionen Russen heroinabhängig. 2015 starben schätzungsweise 90.000 an den Folgen.
Drogen gehören in Russland nicht zum Rand der Gesellschaft, sie sind mittendrin. Abhängig sind Marina, Klavierlehrerin aus Toljatti, und Anton, der Englisch unterrichtet. Sascha war Verkäufer, Jurij arbeitete früher in der Autofabrik. Olga pflegt eine Rentnerin und kochte mit ihrer Mutter in der Küche billigen Heroinersatz. Die ist inzwischen tot. Dafür geht Olgas Sohn, 14, nicht mehr zur Schule. Auf seinem letzten Zeugnis standen nicht einmal mehr Noten. Die beiden leben in einer Wohnung voll mit Müll, zwischen verwilderten Katzen und Hunden, und was er treibt, wenn Olga arbeiten geht, weiß sie nicht.
"Badesalz" oder "Fischfutter" gab es legal zum Verkauf
Dima steht auf dem Friedhof, ein Samstagmorgen, es ist kalt. Dima raucht. Wie eine Müllhalde sieht der Friedhof aus, am Rand, wo die billigen Gräber liegen. Als hätte jeder einfach losgebuddelt, ohne Plan. Dimas Onkel und Tante laufen durch ein Gewirr aus Zäunen und Kreuzen, suchen das Grab von Jewgenij, Dimas Bruder. Andere haben als Wegweiser Plastiktüten oder Stofffetzen in Büsche geknotet. Dimas Verwandte nicht, sie kommen nicht oft. Irgendwann winkt seine Tante aus dem Gräbermeer.
Jewgenij starb vor knapp zwei Jahren, weil er sich Dutzende Male ein Messer in den Körper rammte. Er spritzte Salze, das brachte den Wahn. Es gibt Geschichten von Menschen, die sich den Bauch aufschlitzten, weil sie dort eine Bombe vermuteten. In Russland stand das Pulver als "Badesalz" oder "Fischfutter" eine Zeit lang legal in Kiosken zum Verkauf. Die Behörden kamen mit ihren Verboten kaum hinterher.
Die Tante wollte ihrem Neffen damals nur etwas zu essen bringen. Sie bemitleidete Jewgenij, der sich seinen ersten Schuss mit 15 Jahren setzte. Dima hatte ihn da schon längst aufgegeben. Keine Liebe, kein Hass. Nur Trümmer hinterließ er. Krediteintreiber hatten die Fenster eingeschlagen, die Küche war gelb vom Dampf der Drogen, an den Wänden klebte Blut. Heute lebt Dima dort. Längst ist alles gesäubert, gestrichen, geputzt, aber Dima wundert sich trotzdem, wenn Fremde das Benzin aus dem selbst gemachten Heroin nicht mehr riechen können. Er findet, der Geruch hängt noch immer in den Räumen.
Die Drogen zerstörten auch Dimas Leben, sie gehören zu ihm, seit er denken kann. Seine Eltern starben früh, in den letzten Jahren ihres Lebens stritten sie dauernd über die Sucht des Sohnes, der 15 Jahre älter war als Dima. Einmal war eine Bande hinter dem Bruder her. Sie erwischten ihn ausgerechnet, als er Dima aus dem Kindergarten abholte. Männer zerrten sie in eine Wohnung, hielten Dima fest, verprügelten Jewgenij vor den Augen des Kindes.
Der Drogenersatz "Krokodil" lässt das Fleisch am lebendigen Leib verfaulen
Als das Heroin für eine Zeit lang verschwand, begann Jewgenij zu kochen. Der Ersatz heißt im Volksmund "Krokodil", es ist ein tödlicher Mix aus dem Hustenstiller Codein, Phosphor, Jod, Salzsäure und Benzin. Toljattis Standortvorteil: Weißer Phosphor lagert bis heute in der stillgelegten Fabrik. Das Hustenmittel gibt es wie überall im Land in der Apotheke. Es ist seit ein paar Jahren rezeptpflichtig, aber alle Abhängigen wissen, welche Apotheken es auch ohne verkaufen.
Kam Dima aus der Schule, sah er seinen Bruder in der Küche, inmitten neuer Freunde, dem Tod näher als dem Leben. Er erinnert sich an Leute ohne Beine, mit Abszessen voller Eiter, denn Krokodil lässt das Fleisch am lebendigen Leib verfaulen. Manche kamen die Treppen nicht mehr alleine hoch, irgendwer schleppte sie. Oft fiel die Polizei in der Wohnung ein. Auch der Bruder musste für ein paar Jahre ins Gefängnis. Nach der Entlassung verpufften alle guten Vorsätze schon auf dem Rückweg nach Toljatti. Als er seine Heimatstadt erreichte, war er high.
Nach Jewgenijs Tod schloss sich Dima "April" an, der einzigen Organisation, die sich in Toljatti um Drogenabhängige kümmert, denn der Staat hat sich auf Verbote, Verdrängung und Verachtung spezialisiert. Verlässliche Statistiken existieren nicht. Drogenabhängige finden oft nur schwer Ärzte, die ihre Krankheiten behandeln, und keine Jobs, wenn sie einmal im Gefängnis saßen. In Kliniken binden Ärzte die Abhängigen manchmal zum Entzug an Betten fest.
Drogenersatztherapien sind verboten. Als Iwan, Mitarbeiter von "April" und drogenabhängig seit seinem 14. Lebensjahr, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Methadon einklagen wollte, schikanierten die Behörden "April" monatelang. Iwan ist inzwischen clean und hält das selbst für ein Wunder. Um sich regelmäßig daran zu erinnern, hat er eine App auf dem Handy. Sie zählt die Sekunden ohne Drogen und heißt: "Rechner der sauberen Zeit".
In Toljatti ist rund jeder achte 30-Jährige HIV-positiv
"April" wurde von Eltern Drogensüchtiger gegründet und arbeitet wie Organisationen im Westen. Sozialarbeiter verteilen Einwegspritzen, Aidstests und Kondome an Abhängige. "Wenn wir Pech haben", sagt Dima, "landen wir selbst im Gefängnis." Denn wer Einwegspritzen verteilt, so die Logik des Staates, lädt zu Drogenkonsum ein. In der HIV-Prävention warf der Kreml alle Strategien über den Haufen, die international seit Jahrzehnten erfolgreich sind. In keiner Gegend der Welt verbreitet sich das Virus so rasant wie in Russland und Zentralasien. In Toljatti ist inzwischen rund jeder achte 30-Jährige HIV-positiv.
"April" bekommt mittlerweile ausschließlich Geld von der "Elton John Aids Foundation" in Großbritannien. Das russische Justizministerium stufte die Organisation deshalb als "ausländische Agenten" ein. Bei "April" steht das nun im Briefkopf. Ärzte dürfen nicht mit ihnen arbeiten, auch wenn völlig unklar ist, was das für eine Spionage sein soll.
Viele Gründe für den lokalen Drogenkonsum liegen ohnehin recht offen da. Die Namen der aktuellen Drogenkataloge im Darknet oder im Messenger- Dienst Telegram stehen überall in der Stadt auf Häuserwänden oder Bordsteinen. Manche Dealer lassen sich per Paypal bezahlen, als handelten sie mit T-Shirts. Der Käufer erhält GPS-Koordinaten auf sein Handy, dazu ein Foto des Drogenverstecks. Die Pulver sind in Plastik verpackt, versiegelt und oft an einem Magneten befestigt, sie kleben an Abfalleimern, Bänken, unter Flaschendeckeln und an Briefkästen. Nachts sind im Wald nicht selten Dutzende "Drogenschatzsucher" mit Taschenlampen unterwegs.
"Das halbe Land vegetiert doch nur vor sich hin"
Igor macht sich am Abend doch noch auf den Weg zu Aljona. Ihr Vater öffnet die Tür. Er ist dünn und blass und kann sich kaum auf den Beinen halten. Er ist wütend auf Igor. Die Geschichte mit der Polizeiwache glaubt er ihm nicht. Der Vater muss sich um seine eigene Frau kümmern und schafft es kaum: Sie steht im Nachthemd und barfuß im Flur und hat doch vergessen, wo sie ist. Bis sie dement wurde, arbeitete Aljonas Mutter als Lehrerin für russische Literatur. Die Familie lebt von ihrer Rente, umgerechnet 200 Euro im Monat. Wie die meisten Arbeiter der Autofabrik verlor der Vater vor Jahren seinen Job. "Das halbe Land", sagt er, "vegetiert doch nur vor sich hin." Aljona brüllt aus dem Nebenzimmer. Sie liegt bei ihrem Baby, auch sie ist sauer auf Igor. Sie hat ja eigentlich auch ein anderes Leben, sie sitzt eigentlich auch in Igors Wohnung am Boulevard der Kosmonauten. Igor beschließt, sein Leben zu ändern. Er will alle dort rausschmeißen, streichen, Arbeit suchen, mit der Familie einziehen. Das ist jetzt der Plan, sagt er.
Am Boulevard hocken Mischa und Julija in der Küche. Auf dem Tisch liegt Schokolade, Mischa hat sie im Supermarkt neben der Kasse gefunden. Julija wünscht sich Hausschuhe mit einem Gesicht auf den Füßen. Außerdem glaubt sie, dass sie in die Zukunft sehen kann. Sie hat ein seltsames Vorgefühl. Es könnte sein, dass sie bald sterben wird. Aber der Tod macht ihr keine Angst. Das schafft nur das Leben.