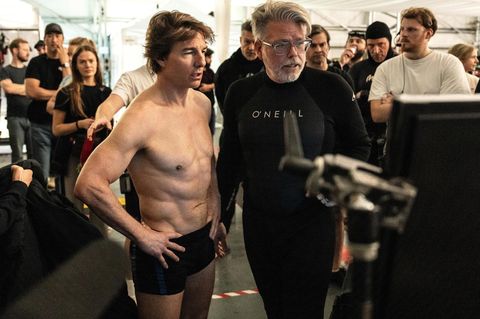Einen Hinterhalt hat hier keiner erwartet. Es gibt nichts außer Treibsand und Dünen. "Leeres Viertel" nennen die Beduinenstämme diese riesige Fläche, die sich von den Gebirgsausläufern des Oman quer durch den Jemen erstreckt und von dort nach Norden bis in die Mitte Saudi-Arabiens.
Die Menschen in dem Jeep, die dieses Niemandsland durchqueren, haben allen Grund, sich unbeobachtet zu fühlen. Aber sie täuschen sich. Über ihren Köpfen kreisen Drohnen. Seit Wochen schon.
Es ist der 3. November 2002, als die ferngesteuerten Roboter ihr Ziel perfekt im Visier haben. Etwa 160 Kilometer von der jemenitischen Hauptstadt Sanaa entfernt, feuert schließlich eine RQ1-Predator-Drohne eine Hellfire-Rakete ab. In dem Toyota-Geländewagen sterben sechs Menschen, allesamt mutmaßliche Terrorbosse von al Kaida - darunter Abu Ali al-Harithi, der als Drahtzieher des Anschlags auf das amerikanische Kriegsschiff USS "Cole" im Oktober 2000 gilt.
Dieser Artikel...
ist erschienen in der Financial Times Deutschland.
Die unbemerkte Eskalation
Wer genau die Rakete von wo abfeuerte, ist bis heute nicht bekannt. Ein CIA-Mitarbeiter im ostafrikanischen Dschibuti könnte es gewesen sein oder jemand in der Zentrale des US-Auslandsgeheimdiensts in Langley, Bundesstaat Virginia. Es wird wohl ein Geheimnis bleiben.
Sicher aber ist eines: Was damals ein spektakulärer Einzelfall war, ist heute Routine, ein Pfeiler der amerikanischen Strategie im Kampf gegen den Terror. Und in jüngster Zeit hat diese Strategie an neuer Dynamik gewonnen: Die USA gehen auf Jagd, rund um den Globus, und sie töten jene, die sie für böse halten.
Ausgerechnet US-Präsident Barack Obama , der Friedensnobelpreisträger, treibt sie voran: 53 Drohnenangriffe haben Forscher von der New America Foundation 2009 allein in Pakistan gezählt, 51 von ihnen hat Obama befohlen. Sein Vorgänger George W. Bush hatte 2008 nur 34 solcher Operationen angeordnet.
Auch rhetorisch wird aufgerüstet: Der Jemen gilt als neue Front. Und nach dem versuchten Anschlag eines Nigerianers auf ein Flugzeug klang Obama fast wie sein Vorgänger: "Wir werden jedes Element unserer nationalen Macht nutzen, um die gewalttätigen Extremisten, die uns bedrohen, unschädlich zu machen und zu besiegen", versprach er. "Egal ob sie von Afghanistan, Pakistan, dem Jemen, Somalia oder irgendwo sonst Anschläge auf unsere Heimat USA planen."
Neue Technik, neue Ziele
Wie ernst er es meint, demonstrierten die Amerikaner bereits vor Weihnachten. Allein im Dezember wurden im Jemen mehr als 30 mutmaßliche al-Kaida-Anhänger aus der Luft getötet - in Rahmen eines jemenitischen Militäreinsatzes zwar, aber sehr wahrscheinlich mithilfe der USA. Unter den Toten soll der radikale Prediger Anwar al-Awlaki gewesen sein. Mit diesem hatte der Attentäter Kontakt, der im November auf dem US-Militärstützpunkt Fort Hood 13 Kameraden erschoss.
Die Ausweitung der Kampfzone, die gezielte Tötung mittels unbemannter Systeme aus der Luft, hat schleichend eingesetzt: 1998, nach dem Bombenattentat auf die US-Botschaft in Tansania, ordnete die Regierung von Bill Clinton zwei Vergeltungsangriffe auf ein al-Kaida-Camp in Afghanistan und auf ein Waffenlager im Sudan an - damals tat sie noch ihr Bestes, den Eindruck zu vermitteln, dass einzelne Personen getötet werden sollten.
Nach dem 11. September war es mit der Zurückhaltung vorbei. Nur wenige Tage nach den Terroranschlägen gab Präsident George W. Bush der CIA das Recht, Mitglieder von al Kaida zu töten. Der Kongress nickte ein Autorisierungsgesetz ab.
Seither ist der Antiterrorkampf nicht mehr auf die offiziellen Militäreinsätze im Irak oder in Afghanistan beschränkt, sondern wird an einer parallelen Front von der CIA geführt. Eine Zäsur markiert dabei jener Angriff gegen Abu Ali al-Harithi, der 2002 im Jemen getötet wurde: Er fand das erste Mal außerhalb des Militäreinsatzes in Afghanistan statt. Die Obama-Regierung hat an diesem Vorgehen nichts geändert, im Gegenteil.
7000 unbemannte Luftsysteme hat das Pentagon derzeit - und die Vorgabe im Verteidigungshaushalt ist klar: Die Ausgaben für konventionelle Kampfjets wie die F-22 wurden zurückgefahren, das Drohnenprogramm deutlich ausgeweitet. "Ein Drittel aller künftig angeschafften Flugzeuge wird unbemannt sein. Und in diesem Jahr werden erstmals mehr Operatoren für unbemannte Flugzeuge ausgebildet als Kampfpiloten", prophezeit P.W. Singer vom Forschungsinstitut Brookings, der ein Buch über Roboterkriege des 21. Jahrhunderts geschrieben hat.
Intransparente Kriegführung
Eines der Hauptziele der USA für diese Einsätze ist Pakistan. In den vergangenen zwei Jahren wurden im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet über ein Dutzend ranghoher Al-Kaida-Führer durch ferngesteuerte Angriffe aus der Luft getötet - und mit ihnen Hunderte Zivilisten. Die rechtliche Grundlage der gezielten Tötungen in Drittländern ist schwammig. "Weil CIA-Angriffe nicht öffentlich zugegeben werden, wissen wir sehr wenig über ihre Einsatzregeln", sagt Matthew Waxman von der New Yorker Columbia-Universität, ein Experte für Völkerrecht. "Wir wissen zum Beispiel nicht, wie Entscheidungen über spezifische Ziele getroffen werden oder von wem."
Als letztes Jahr bekannt wurde, dass die CIA während der Bush-Regierungszeit Teams zusammengestellt hatte, die al-Kaida-Terroristen aufspüren und töten sollten, brach noch ein Sturm der Entrüstung los - obwohl das Programm abgeblasen wurde. Mitglieder der Geheimdienstausschüsse im Kongress beschwerten sich, nicht informiert worden zu sein.
Das Drohnenprogramm in Pakistan sehen viele abgekoppelt von solchen James-Bond-Spielchen - wie eine Verlängerung des legitimen Krieges. "Die Zahl der Luftangriffe in Pakistan war höher als die zu Beginn des Kosovo-Krieges", sagt Singer. "Und trotzdem hatte der Kongress keine einzige Anhörung dazu."
Transparenz gibt es nicht, die vereinzelten Berichte sind kaum nachprüfbar, Hilfsorganisationen, Journalisten und Menschenrechtlern wird der Zugang zu den Stammesgebieten in Pakistan systematisch verweigert.
Jemen übernimmt Verantwortung
Es gibt auch skeptische Stimmen, darunter prominente wie die von Stanley McChrystal. Der Nato-Oberbefehlshaber hat zur Vorsicht bei Luftangriffen in Afghanistan gedrängt. Tenor: Die Herzen der Bevölkerung ließen sich nicht mit technologischer Übermacht und aus sicherer Distanz gewinnen - und schon gar nicht mit toten Zivilisten. Doch das Mandat der internationalen Schutztruppe Isaf gilt nicht in Pakistan, wo viele al-Kaida-Mitglieder bis heute Zuflucht finden.
Im Jemen versuchen die USA noch zu kaschieren, selbst am Drücker gesessen zu haben. Keine US-Flugzeuge, sondern Kampfflieger der jemenitischen Luftwaffe sollen die Bomben im Dezember abgeworfen haben. Welche Rolle der US-Geheimdienst, etwa beim Aufspüren des Zieles, gespielt hat, liegt im Dunkeln.
Noch ist die Regierung in Sanaa bereit, die Verantwortung für solche Aktionen mitzutragen. Sie findet darin auch Rückhalt in der Bevölkerung, in der die Sympathie für al Kaida geschwunden ist.
"Noch in den 90er-Jahren war sie sehr groß", sagt Mustafa Alani vom saudi-arabisch finanzierten Gulf Research Center in Dubai. "Doch heute sieht die Mehrheit der Jemeniten al Kaida als Gefahr an. Sie haben kein Problem damit, dass die Amerikaner den Jemen bei den Attacken unterstützt haben."
Hohe Opferzahlen in Zivilbevölkerung
Dennoch hegt eine nicht unerhebliche Minderheit offene oder heimliche Sympathien für die Terrorgruppe. Sie hält sie für gute Muslime, die etwas Falsches tun. Die USA halten sie ohnehin für den Teufel, eine Haltung, die durch Obama nur leicht abgemildert wurde.
Auch Pakistan ist gespalten. "Die Mehrheit der Menschen heißt die von der CIA koordinierten Angriffe der USA gut, weil sie nicht von den Taliban regiert werden wollen", sagt Sailab Mehsud, der aus der Region stammt und als freier Korrespondent für den arabischen Fernsehsender al-Dschasira arbeitet. Auch die sonst so US-kritischen pakistanischen Medien applaudierten, als im letzten Jahr der Führer der pakistanischen Taliban, Baitullah Mehsud, bei einem Drohnenangriff ums Leben kam. Insgesamt wurden seit Anfang 2008 14 ranghohe al-Kaida-Führer auf diese Weise getötet.
Für die Regierung in Islamabad käme es dennoch einem innenpolitischen Selbstmord gleich, bei Roboterangriffen aus der Luft als Komplize der USA zu erscheinen. Viel zu oft kommen bei diesen Aktionen unschuldige Zivilisten ums Leben, genaue Opferzahlen kennt niemand. Der Journalist Mehsud berichtet von einem Angriff auf eine Beerdigungsfeier eines Talibanführers in Magin. "Dabei wurden 92 Menschen während des Gebets getötet, die dann in einem Massengrab bestattet wurden, weil die Leichen so verkohlt waren, dass man nicht mehr erkennen konnte, wer die Leute waren", sagt Mehsud, der zum selben Stamm gehört wie der getötete Talibanführer, aber sein Dorf in Wasiristan längst verlassen hat.
Abgesehen von allen humanitären und rechtlichen Problemen sind viele Beobachter nicht einmal sicher, ob der Terrorbekämpfung mit den Luftangriffen gedient sei. Einen Terroristen lebend zu fangen sei doch immer noch besser, als ihn mitsamt seinem gefährlichen Wissen zu vernichten, sagt diese Schule. Denn tote Männer erzählen keine Geschichten.