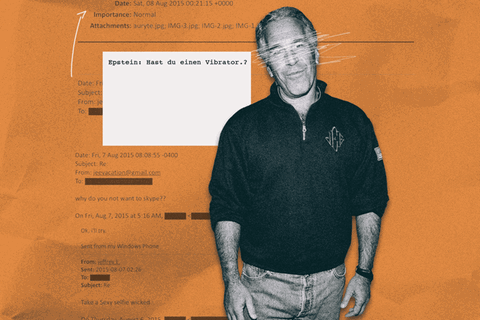Es ist etwas passiert mit Michelle Obama. Sie steht schüchtern lächelnd auf der Bühne des Parteitags der Demokraten, und natürlich muss sie von der Liebe zu ihrem Mann sprechen und der Liebe zum Vaterland und auch der Mutterliebe, das gehört dazu, wenn der Ehemann Präsident werden will. Aber schon ihre Stimme ist anders. Sie ist sanft geworden, fast säuselnd. Und ihre Gesten. Sie sind weich geworden, fast untertänig. Da ist keine Ironie mehr in ihren Sätzen, keine Kampfeslust in den Augen, und auch für ihr eigenes Leben als erfolgreiche Juristin ist kein Platz an diesem Montagabend in Denver. Diese Rede, die bisher wichtigste ihrer Karriere, ist auch ihre bravste. Aber das Publikum ist begeistert. So wünscht es sich eine First Lady.
Vor nicht allzu langer Zeit gab es sie noch, die Momente im öffentlichen Leben der Michelle Obama, in denen sie einfach sie selbst sein durfte. Unverfälscht, geradeaus und kritisch. Eine eigene, neue Kategorie in der Politik, so wie ihr Mann.
Vor ein paar in Iowa zum Beispiel, wo man Rinder züchtet und nicht viel hält von Städtern, trat sie vor die drei Dutzend Zuhörer in "Shearer's Kitchen" und breitete strahlend die Arme aus. Eine kluge Frau die versuchte, ehrlich zu bleiben und normal. Michelle Obama sprach über die Würde, aber auch über die Abgründe Amerikas, über die "Politik der Angst", die aus dem "Land der Starken" ein Land der "kranken Seelen" gemacht habe. Sie sprach über die Zyniker in der Politik, und dann sagten sie noch: "Glauben sie etwa, ich würde das alles mitmachen, wenn ich nicht wüsste, dass mein Mann der Richtige für das Präsidentenamt ist? Sonst würde ich ihn bitten, den Clown bei uns im Wohnzimmer zu spielen."
Vorübergehend jemand anders
Heute scheint es, als ob es niemals auch nur eine dieser vorlauten Bemerkungen Michelles über ihren Mann gegeben hätte, die ihre Fans als Beweis einer starken Partnerschaft sehen. Und die Wahlkampfstrategen als Katastrophe. Bemerkungen über Baracks Schnarchen, seinen Mundgeruch am Morgen, seine Socken, die er im Wohnzimmer rumliegen, und das Brot, das er trocken werden lässt.
Heute hört man von ihr Sätze wie: „Ich werde tun, was mein Land von mir verlangt.“ In diesen Tagen scheint es, als ob sich Michelle Obama gerade in eine typische Politikerfrau verwandelt. Als habe sie entschieden, vorerst nicht mehr Michelle Obama zu sein.
In den Umfragen könnte ihr Mann besser dastehen. Gerade hat ihn der 72-jährige John McCain eingeholt – und das, obwohl „die Marke ,Republikaner‘ so verseucht ist wie ein Atomreaktor aus Sowjetzeiten“, wie die Zeitschrift „Economist“ spottet. Der alte Krieger hat erfolgreich Zweifel an Obama gesät. Vielleicht ist der ja doch zu naiv, zu jung, zu unerfahren für diese gefährliche Welt, in der Putin die Panzer nach Georgien rollen lässt. Vielleicht doch zu elitär, zu viel Harvard. Und vielleicht auch zu schwarz.
Durchschnitt als Produkt
Wenn sich Barack Obama an diesem Donnerstag auf dem Parteitag in Denver vor rund 75 000 jubelnden Jüngern in einem Football-Stadion zum Kandidaten krönen lässt, beginnt die entscheidende Schlacht um Amerikas Mitte. In dieser Schlacht gilt es, das Gesamtkunstwerk Obama massentauglich zu machen. „Wir sind eine ganz normale amerikanische Familie“, lautet die Verkaufsstrategie. Michelle soll die patriotische Mutter und strahlende Gattin sein.
Wie an jenem Vormittag, als sie in ihrer Heimatstadt Chicago um Spenden für Baracks Wahlkampf wirbt. In einem schulterfreien grünen Kleid betritt sie den goldenen Ballsaal des prächtigsten Hotels der Stadt am Lake Michigan. Sie reist an mit acht Beamten des Secret Service und sechs festen Mitarbeitern, die jeden Satz, jede Kameraeinstellung, jede Umarmung überwachen. "Ich hasse solche Veranstaltungen", sagte sie einmal, "ich hasse, hasse, hasse sie." Nun sagt sie, wie gern sie hier sei. Und wie schwer es Frauen hätten, Mutter, Hausfrau und Ehefrau zu sein. Und wie Barack all diese Frauen verstehe.
Im Saal sitzen 700 der einflussreichsten Damen der Stadt, sie haben 1000 Dollar für einen Teller Hühnchen mit Salat bezahlt. "Als Barack ernsthaft überlegte, Präsident werden zu wollen, war meine Reaktion: auf keinen Fall. Ich hielt Politik für ein raues, gemeines Geschäft", sagt Michelle. "Aber dann dachte ich an die Welt, in der meine Töchter aufwachsen werden, und sah ein, dass ich jedes nur denkbare Opfer bringen muss, damit er Präsident wird."
An einem Tisch in der ersten Reihe sitzt ihre Mutter Marian Robinson, eine große, schlanke Frau. Frau Robinson ist 71, Witwe und passt auf die beiden Enkelkinder auf, wenn Michelle Obama Wahlkampf macht. Sie lässt die Kinder Fernsehen schauen, auch wenn Barack das nicht gefällt. Gibt ihnen schon mal Fast Food, auch wenn Michelle auf frische Biofrüchte besteht. Sie ist so störrisch, wie Michelle es einmal war. "Mama, ich liebe dich so sehr", ruft Michelle in den Saal. Dafür bekommt sie den lautesten Beifall ihrer Rede.
Erklärungsnöte
Nach der Veranstaltung drängt sich Marian Robinson durch die Menge. Ist es nicht eigenartig, die eigene Tochter auf der nationalen Bühne zu sehen? "Überhaupt nicht", sagt sie fast empört. Dann hält sie lächelnd die Hand vor den Mund, als ob sie ein Geheimnis verriete: "Michelle hatte schon immer ein großes Mundwerk."
Dieses Mundwerk hat Obamas Wahlkampfteam in manche Not gebracht. Es gab Momente, wie in South Carolina, als sie Amerika "schlichtweg gemein" nannte oder in die Kamera sagte, dass ihr Ehemann als Schwarzer schon auf dem Weg zur Tankstelle erschossen werden könne. Sie sagte, was ihr in den Sinn kam - "ich könnte Bill Clinton die Augen auskratzen" -, und eine Weile konnte man glauben, in diesem Wahlkampf sei Platz für Authentizität.
Der plötzliche Wandel
Wenn Obama für "Yes we can" stand, stand sie für "I'm not so sure". Heute spricht sie in Talkshows über Rezepte und schicke Kleider, die sie im Schlussverkauf ersteht. Die stolzen Eltern lassen sich mit ihren zuckersüßen Töchtern Malia, 10, und Sasha, 7, fotografieren, die im heimischen Wohnzimmer am Klavier klimpern, und sprechen über Taschengeld. Malias zehnten Geburtstag feiert man in einem öffentlichen Park und lässt die Mädchen in die Kameras der Tratsch-Sendung "Access Hollywood" plappern. Michelle Obama erzählt begeistert, dass sie Toilettenpapier beim Discounter kauft, das Massenklatschblatt "Us" liest und neulich mit ihren Freundinnen "Sex and the City" gesehen hat. Und Barack sagt, welch "wunderbare, hingebungsvolle Mutter" seine Michelle sei und dass sie an den "amerikanischen Traum glaubt, weil sie ihn gelebt hat".
"Was erwarten Sie denn, sie hat doch keine Wahl", sagt Rabbi Arnold Wolf. Wolf ist ein guter Freund der Familie. Er wohnt gleich neben den Obamas im wohlhabenden Chicagoer Stadtteil Hyde Park. Der Rabbi hat ihren Weg in all den Jahren verfolgt, er hat sie in seiner Synagoge sprechen lassen und ihren politischen Weg ins jüdische Chicago geebnet. "Michelle ist eine großartige Frau", sagt er. "Smart, erfolgreich und attraktiv." Sie verdiente mit ihrem Job im Management der Uni-Klinik schon 300.000 Dollar im Jahr, als Obama, der Jungsenator, in Washington noch über der Frage verzweifelte, wie man einen Duschvorhang anbringt.
Vorbild vs. Schwachstelle
Sie steht um 4.30 Uhr auf, tut was für ihre Fitness, kuschelt um sechs mit den Kindern, bringt ihren manchmal so selbstverliebten Mann immer wieder auf den Boden zurück und denkt natürlich daran, den Frauen ihrer Sicherheitsbeamten am Valentinstag persönliche Dankeskarten zu schreiben.
"Ja, sie ist die Überfrau", sagt Rabbi Wolf. "Das empfinden manche in Amerika als bedrohlich." Es klingt wie eine bittere Ironie der Geschichte, dass Amerika, dieses Land weiblicher GIs und Astronauten, offenbar immer noch Probleme hat mit einer eigenständigen Frau an der Seite seines Präsidenten.
Michelle Obamas Aufstieg ist ungewöhnlicher als der Baracks, sie ist der American Dream auf Speed - und doch haben die Republikaner sie als Obamas Schwachstelle ausgemacht. Denn Michelle ist nun einmal schwarz, schwarz wie die Sklaven des amerikanischen Südens, von denen ihre Familie abstammt. Bei den Vorwahlen der Demokraten hatte ihre Hautfarbe noch geholfen, skeptische schwarze Wähler zu überzeugen. Jetzt aber gilt es, die skeptischen weißen Wähler nicht zu verschrecken.
Die Angriffe auf Michelle Obama setzten schon im Frühjahr ein. Im Internet zirkulierten Videos ihres inzwischen berüchtigten Satzes "Zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben bin ich stolz auf mein Land". Nicht nur weil Obama so erfolgreich sei, hatte sie noch angefügt, "sondern weil ich glaube, dass die Menschen hungrig nach Veränderung sind. Ich hatte mir so sehr gewünscht, dass sich unser Land in diese Richtung bewegt". Doch man nannte sie unpatriotisch und verbittert, Obamas "bittere Hälfte". Man nannte sie "Baby Mama" - in böser Anspielung auf vorlaute, junge, unverheiratete schwarze Mütter.
Die neue Jackie
Das ist das Dilemma: Michelle Obama mag ein Vorbild für Millionen junge Frauen sein und die Zeitschriften- Cover der Nation schmücken, aber in den Umfragen ist ihr Cindy McCain, die einst depressive, tablettensüchtige, wachsfigurenhafte Hausfrau überlegen. Wenn es eine Schwarze aus der Unterschicht zur eigenen Villa schafft und Bioprodukte mag, gilt das als elitär. Cindy McCain, die Millionenerbin eines Bierimperiums, gilt als bodenständig.
"Im Grunde ist Michelle keine politische Frau", erzählt ihre langjährige Freundin und PR-Beraterin Avis LaVelle aus Chicago. Die beiden arbeiteten einst zusammen für Chicagos Bürgermeister Richard Daley. Ihre Familien feiern zusammen Sommerpartys und Halloween. Sie unterhalten sich über die Kinder und die Männer und warum es so wenige gute schwarze Männer gibt für erfolgreiche schwarze Frauen. Wenn Michelle mit ihren Freundinnen zusammen ist, reden sie selten über Politik, sondern über Brad Pitt und Angelina Jolie und die Fernsehsoaps, über Designerkleider und coole Handtaschen.
Michelle ist so elegant, stilsicher und glamourös wie einst Jackie, schwärmen ihre Bewunderer. Tatsächlich wird sie von manchen Kommentatoren als neue Jacqueline Kennedy beschrieben. Dieser Vergleich gefällt Obamas Strategen. Denn nach acht Jahren Bush und Bibellektüre im Weißen Haus, so das Kalkül, sehnt sich die Mehrheit der Amerikaner vielleicht wirklich nach einer jungen, frischen First Family. Nach einer First Lady für das 21. Jahrhundert.
"Vanity Fair" zählte sie zweimal zu den "zehn bestangezogenen Frauen Amerikas". Sie trägt Hosen von Gap und manchmal sündhaft teure Pumps von Jimmy Choo. Sie schwärmt für Armani und hasst Strumpfhosen, "die Dinger reißen immer, wenn man dran zieht". Als sie neulich in einer Talkshow ein brav geblümtes Kleid trug, das sie für 148 Dollar im Internet erstanden hatte, war es innerhalb eines Tages landesweit ausverkauft.
Ihre Etuikleider lässt sie von der Designerin Maria Pinto aus Chicago schneidern, die sich jetzt vor Aufträgen nicht mehr retten kann. Klarer Schnitt in A-Form, die Taille betont, die Knie bedeckt, leuchtende Farben, gern schulterfrei. Dazu ihre Markenzeichen, die Kette mit den dicken falschen Perlen und der schwarze Lackgürtel von Edeldesigner Azzedine Alaia. Doch für ihre nächsten Auftritte im Wahlkampf ist das schon fast zu viel Glamour. Die Leute sollen hören, in was für einfachen Verhältnissen sie aufwuchs.
Aufstieg mit Disziplin
Es ist ein bescheidenes Häuschen an der South Euclid Avenue in Chicagos rauer South Side, in dem Michelle LaVaughn Robinson und ihr zwei Jahre älterer Bruder Craig mit den Eltern leben. Die South Side ist ein vornehmlich schwarzes Wohngebiet, aber kein Ghetto. Die Uni-Klinik ist in der Nähe, viele Angestellte wohnen hier. Es ist ein behütetes Leben, die Mutter ist Hausfrau, der Vater arbeitet bei den städtischen Wasserwerken, ein langjähriges Mitglied der Demokraten. Die Familie verbringt die Wochenenden gemeinsam, spielt Monopoly am großen Küchentisch, und jedes Jahr fahren sie für eine Woche in "Dukes Happy Holiday Resort" im Nachbarstaat Michigan.
Vater Fraser ist ein liebevoller Mann mit natürlicher Autorität, der nie seine Stimme erhebt. "Immer wollten wir seinen hohen Ansprüchen gerecht werden", sagt Michelle Obama. "Er musste nur sagen, dass er enttäuscht sei, und schon flossen bei uns die Tränen." Fraser Robinson leidet an Multipler Sklerose, er ist teilweise gelähmt, doch solange er kann, geht er jeden Tag zur Arbeit.
Seine Kinder lernen sich nach oben, diszipliniert, motiviert. Michelle besucht eine renommierte Schule am anderen Ende der Stadt, drei Stunden Schulweg jeden Tag, nie bringt sie schlechte Noten nach Hause. Lange habe sie das Gefühl gehabt, nicht gut genug zu sein, sagte Michelle Obama einmal, nicht schlau genug, nicht gut genug vorbereitet.
Die eiserne Disziplin, den Glauben an harte Arbeit und feste Regeln hat Michelle Obama behalten. Tochter Malia glaubt bis heute an den Weihnachtsmann, "weil mir Mama nie so viele Geschenke bringen würde". Und Bruder Craig sagt: "Ich kenne keinen Menschen, der härter arbeitet als sie."
Das leidige Thema
Sie studiert in Princeton, der weißen EliteUni an der Ostküste. Eine Institution des besseren Amerika, doch Anfang der 80er Jahre noch lange nicht frei von Rassismus. Unter den mehr als 1100 Erstsemestern sind nur 94 Schwarze. Als die Eltern ihrer ersten Zimmergenossin von Michelles Hautfarbe hören, fordern sie, ihre Tochter in ein anderes Zimmer zu verlegen. Und wenn wir Schwarzen über den Campus gingen, sagt Michelle Obama, "grüßten uns die Kommilitonen nicht, obwohl wir uns aus dem Unterricht kannten".
Erst in Princeton merkt Michelle, wie schwarz sie wirklich ist, wie fremd in der Welt der Weißen. Sie schreibt ihre Examensarbeit über schwarze Studenten an einer weißen Universität. Ihre Karriere, analysiert sie darin, "wird zu weiterer Integration in eine weiße Kultur und Sozialstruktur führen, die mir lediglich zugesteht, an ihrem Rand zu leben". Obamas Team hielt den Text lange unter Verschluss. Sie wollen das Thema Hautfarbe aus diesem Wahlkampf heraushalten. Sie könne sich eigentlich kaum noch daran erinnern, sagt Michelle, wenn man sie heute nach ihrer Abschlussarbeit fragt.
Der Beruf bringt sie zusammen
Sie absolviert dann auch noch die Harvard Law School, wird Anwältin für Urheberrecht in der renommierten Chicagoer Kanzlei Sidley Austin und hadert schon bald mit dem langweiligen Anwaltsleben. Im Sommer 1988 taucht ein junger Praktikant namens Barack Obama auf, Harvard- Absolvent wie sie, von dem die Kolleginnen sagen: Der ist smart und süß und charmant. Michelle denkt: Wieder ein schwarzer Kerl, der zufällig einen Job hat und einen Anzug trägt und gerade mal unfallfrei einen Satz sagen kann.
Aber er ist gross, sogar größer als sie, er ist ehrgeizig und hat gute Manieren. Und er hat keine Angst vor ihr. Newton Minow, Chefjurist bei Sidley Austin, hat Michelle und Barack damals eingestellt. Er bat die erfahrenere Michelle, sich um den Neuen zu kümmern. "Barack hatte ohne Frage Interesse an ihr, aber sie wies ihn zunächst ab. Sie war ja quasi seine Vorgesetzte", erzählt er. Minow ist schon über 80, aber noch immer ein drahtiger Mann. Er war einst Berater von John F. Kennedy, später Michelles Mentor und ist bis heute der von Barack. Die Liebe der beiden blieb lange geheim. "Wir haben sie dann bei einem Konzertbesuch entdeckt, zwei Turteltauben, die sich ertappt fühlten."
Die Geschichte ihrer Begegnung wird oft dargestellt als das lange Werben Baracks um die zögerliche Michelle, aber Minow hat es anders in Erinnerung. "Barack war sehr zielstrebig in allem, was er tat. Er nahm sie mit zu einem seiner Auftritte bei einer Nachbarschaftsorganisation und zog da eine Show ab. Und dann kommt er eines Tages in mein Zimmer und sagt: ,Tut mir leid, ich kann ihr Jobangebot nicht annehmen. Ich gehe in die Politik.‘ Das war schon ein kleiner Schlag, aber dann fügt er noch hinzu: ‚Ich nehme Michelle gleich mit.‘ Da habe ich geschluckt, aber den beiden natürlich viel Glück gewünscht."
Sie heiraten 1992, weißes Kleid, Kirche, Diamantring, so gehört es sich in Michelles Welt. Er nennt sie "meinen Fels", sie sagt: "Er ist die Liebe meines Lebens."
Nach dem Tod ihres Vaters und dem Krebstod ihrer besten Freundin tauscht Michelle ihren lukrativen Anwaltsjob gegen einen schlecht bezahlten im Bürgermeisteramt. Später leitet sie eine gemeinnützige Organisation, die benachteiligten Jugendlichen Arbeitsplätze vermittelt. Als Obama im Jahr 2000 entscheidet, für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus zu kandidieren, kommt es zur Ehekrise. Du denkst nur an dich, wirft Michelle ihm vor. "Ich hätte nie gedacht, dass ich die Familie allein großziehen muss."
Noch heute sind sie stark eingebunden in die verfilzte Politszene Chicagos und leben in einer 1,65-Millionen-Dollar-Villa mit "Regalen aus Mahagoni und einem Weinkeller für 1000 Flaschen", wie der "New Yorker" spöttisch notierte. Sie beschäftigen eine Haushälterin und geben jährlich 10.000 Dollar für die Hobbys ihrer Kinder aus. Das gegnerische Lager zitiert so was gern.
Gute Entscheidung
Vor drei Wochen trat Michelle Obama bei einem Forum für Militärfamilien in Norfolk, Virginia, auf. Das macht sie jetzt häufiger. Das Militär steht für Patriotismus. Schon bei der Nennung ihres Namens bricht Jubel aus und mehr noch bei dem Satz: "Michelle Obama, die nächste First Lady der USA." Eine schwarze Soldatin in der ersten Reihe sagt später: "Obama hätte auch eine hellhäutigere Frau kriegen können. Aber er nahm sich Michelle. Das macht mich stolz."
"Ich bin in meinem Leben so sehr von diesem Land gesegnet worden", erklärt Michelle. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie nur in Amerika Wirklichkeit werden könne. Und dann spricht sie von ihrer Liebe zu Amerika und den Opfern, die das Militär bringt. Sie bittet die Frauen, von ihrem Leid zu erzählen, vom Leben im Krieg, vom Alltag ohne Männer, und nickt mit viel Anteilnahme. Sie macht ihre Sache gut, doch zurück bleibt ein schales Gefühl. Die Frauen waren vorab ausgesucht, kritische Fragen nicht zugelassen. Ein Auftritt wie aus der Wahlkampffibel.
Nein, sie habe sich nicht geändert, sagt sie beinahe trotzig: "Andere Umstände, gleiche Michelle." Doch in diesen Wochen scheint es, als versuche sie, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass sie vielleicht wirklich ins Weiße Haus einzieht. "Ich werde sein, was mein Land von mir verlangt. Dies wird mein Job sein. Und ich muss darauf vorbereitet sein, zu tun, was nötig ist."