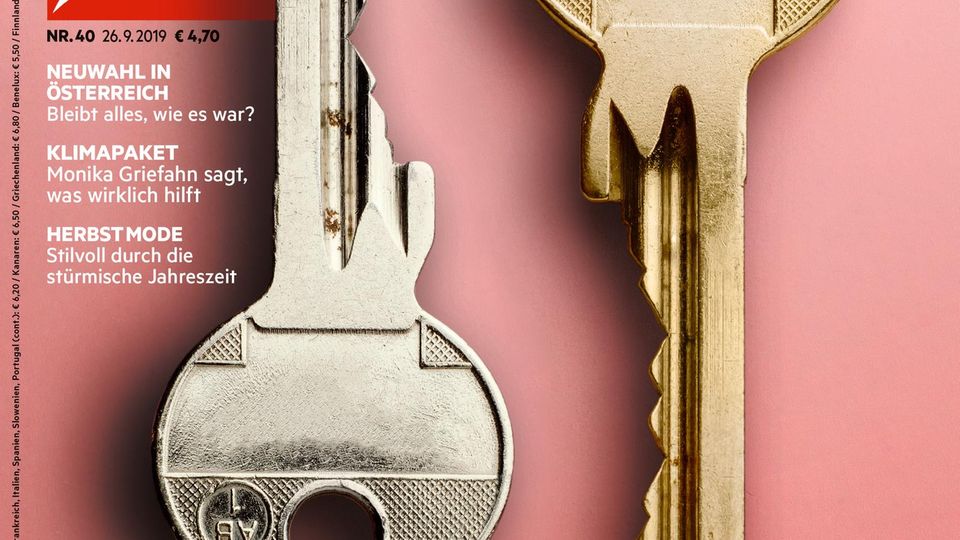Endlich fasst sich die Dame aus dem Burgenland ein Herz. Aufgeregt hat sie am Wegesrand auf Sebastian Kurz gewartet, der mit über tausend seiner Anhänger auf den Csaterberg in Österreichs östlichstem Bundesland gewandert ist. "Soll ich es ihm sagen, soll ich ihn ansprechen?", hat sie Umstehende zurate gezogen, nun ruft sie laut seinen Vornamen. Sogleich dreht er sich lächelnd um und lässt nach seiner Hand greifen. Man ist gespannt, mit welchem Anliegen sich die Frau an den jungen Altbundeskanzler wenden wird. Dann offenbart sie sich: "In meiner Familie heißen alle Erstgeborenen nach dem Heiligen Sebastian – so wie Sie!"
Selfies, Selfies, Selfies
Viel wird in den sozialen Medien über die angebliche Heiligenverehrung des Sebastian Kurz gespottet, hier ist sie sprichwörtlich real und frei von Ironie. Der jugendliche Held der österreichischen Konservativen als Sehenswürdigkeit und messianische Erscheinung in engen Jeans. Die Menschen suchen seine Nähe, manche auch Körperkontakt – und wollen immer wieder Selfies, Selfies, Selfies. "Das ist im Wahlkampf wirklich viel, aber es macht mir auch Freude", sagt Kurz. "Die Nähe zu den Menschen ist mir nämlich wichtig." Der Begriff vom "Politiker zum Anfassen" erlangt ungeahnte Dimensionen.
Politische Inhalte werden auf den sommerlichen Wahlveranstaltungen der "Neuen Volkspartei" nur in kleinen Dosen verabreicht. Es geht um die Mobilisierung der Anhänger – mit den Mitteln einer volkstümlichen Unterhaltungsshow. In einem Burghof hat sich die Menge von einem ehemaligen Radiomoderator anfeuern lassen und bereitwillig dem Interview einer merkwürdigen Familie gelauscht, die ihre Wohnung in der Parteifarbe Türkis gestylt hat. Eine kleine Gruppe an Kurz-Kritikern durfte sich am Burgtor positionieren und hat Schilder mit Sprüchen wie "Menschenrecht statt rechte Menschen" in die Höhe gehalten. Den kleinen Wasserschwall, den Kurz bei seiner Ankunft von einem Gegner abbekommen hat, wischt er verlegen ab.

Er lässt sich nicht nass machen. Das verlorene Misstrauensvotum im Parlament, das zu seiner Abwahl führte, die diversen Anschuldigungen und Pannen im Wahlkampf scheinen an ihm abzuperlen. In Umfragen führt die Volkspartei mit Werten zwischen 33 und 35 Prozent und liegt damit vor ihrem eigenen Spitzenergebnis von 2017. 44 Prozent der Österreicher wünschen sich ihn zurück an die Spitze der Regierung. Dass Sebastian Kurz bald wieder ins Kanzleramt auf dem Wiener Ballhausplatz einziehen darf, gilt als ausgemacht.
Doch bei den vielen Debatten und Duellen der Spitzenkandidaten, die von den Sendern inflationär veranstaltet werden, offenbart sich das bevorstehende Dilemma. ÖVP-Chef Kurz und die sozialdemokratische Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sind einander augenscheinlich in persönlicher Abneigung verbunden. Die gegenseitige Antipathie ist förmlich körperlich zu spüren. Schwer vorstellbar, dass diese beiden Menschen in absehbarer Zeit ihre Unterschriften unter einen gemeinsamen Koalitionsvertrag setzen könnten.
"Wir wollen den Kurs fortsetzen"
Das Aufeinandertreffen mit Norbert Hofer, dem frisch gewählten Parteichef des früheren Koalitionspartners FPÖ, trieft hingegen vor Harmonie. Man duzt sich im Fernsehen und scheint sich schwer damit zu tun, das Gegenüber härter anzupacken.
Wir erinnern uns: Hofer ist Chef jener Partei, deren Spitzenvertreter Strache und Gudenus in einer besoffenen Nacht tiefe Einblicke in ihre schmutzigen Machtfantasien offenbarten und damit für einen der größten politischen Skandale der zweiten Republik sorgten. Wer glaubte, damit sei jene rechtskonservative Koalition, die 17 Monate unter internationaler Kritik gestanden hat, für immer Geschichte, könnte sich getäuscht haben. Man muss bloß genau hinhören, wie Kurz die Zusammenarbeit rühmt. Bereits im Gespräch auf dem Csaterberg sagt er: "Tatsache ist, dass diese Koalition sehr erfolgreich gearbeitet hat." Man habe kleine und mittlere Einkommen entlastet, die Schuldenpolitik beendet und die illegale Migration bekämpft. "Wir wollen diesen Kurs fortsetzen und haben hundert Projekte definiert, die zeigen werden, mit wem das möglich ist." Viele Österreicher hoffen, dass Kurz in einer Dreierkombination mit den Grünen und der liberalen Partei Neos diese Gemeinsamkeiten findet.
Mehrfach lässt Kurz in der Fernsehkonfrontation mit Rendi-Wagner den Namen des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil fallen. Der gilt in seiner Partei, der SPÖ, als Rechtsaußen, koaliert auf Landesebene mit den Freiheitlichen und ist der vermutlich einzige Spitzenvertreter der Sozialdemokraten, der Lust hätte, sich mit Kurz an einen Kabinettstisch zu setzen und dessen restriktive Migrationspolitik weiterzuführen. Doch Doskozil hat im Januar selbst Neuwahlen zu bestreiten.

Gleichzeitig scheint es der FPÖ zu gelingen, trotz des Skandalvideos nur unwesentlich an Stimmen einzubüßen. Mit 20 Prozent konkurriert sie in den Umfragen mit der SPÖ um den zweiten Platz. Auf Plakaten und in Wahlspots fleht die Partei förmlich darum, weiterregieren zu dürfen. Selbst abgebrühte Beobachter der österreichischen Politikszene reiben sich verwundert die Augen.
Hinterm Tellerrand
Im Wiener Café Landtmann an der Ringstraße hat Rainhard Fendrich bei einem starken Mokka Platz genommen. Er gilt als einer der erfolgreichsten Sänger der österreichischen Popgeschichte und ist fast exakt so alt wie die Zweite Republik als souveräner Staat. "Bitte fragen Sie mich nicht, wem es von uns beiden schlechter geht", scherzt er. Mit "I am from Austria" ist es Fendrich vor Jahren gelungen, eine Art kritische Volkshymne zu schaffen. Anderthalb Wochen vor dem Wahltermin hat er nun ein neues Album veröffentlicht, auf dem er politisch sehr klar Position bezieht. "Wann immer wo was schief rennt, die Flüchtlinge san schuld", heißt es da, und: "Glei hinterm Tellerrand hebt sich schon wieder die rechte Hand." Er glaube nicht, dass "die Österreicher per se fremdenfeindlicher wären als andere Europäer", sagt Fendrich, der selbst Sohn einer Flüchtlingsfamilie sudetendeutscher und serbischer Herkunft ist und eher zufällig in Wien geboren wurde. "Keiner ist genetisch rassistisch, aber in Österreich wurde nie eine Vergangenheitsbewältigung wie in Deutschland betrieben."
Einmal habe er Kurz persönlich gesagt, was er von seiner Koalition mit der FPÖ halte – von einer Bühne einer Geburtstagsfeier herab, auf der Kurz Gast gewesen war. "Mir ist der Kragen geplatzt, und ich habe ins Mikrofon gesagt, dass er sich schämen soll."
Einen Tag später habe Kurz persönlich angerufen und ihm erklärt, weshalb er mit den Sozialdemokraten auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sei. "Ich unterstelle ihm gar nicht, dass er Böses will", sagt Fendrich. "Ich glaube, dass ihm die politische Erfahrung fehlt. Ich bin gespannt, ob Sebastian Kurz in 30 Jahren seine Entscheidungen vielleicht anders sehen wird, als er es heute tut." Was würde er ihm sagen, wenn Kurz noch einmal am Telefon wäre? Er denkt nach, lacht in sich hinein und sagt: "ich glaube nicht, dass er noch einmal anruft."

Abgesehen von Kurz’ Distanzlosigkeit zur politischen Rechten kritisiert Fendrich, dass er sich von Spenden abhängig gemacht habe. "Ihm ist vorzuwerfen, wie sehr er mit der Wirtschaft verbandelt ist", sagt der Sänger. "Wenn ein Industrieller eine Spende tätigt, dann erwartet er sich davon etwas."
Tatsächlich wurden im Laufe des Sommers Millionenspenden von Industriellen bekannt. Von der Kärntner Kaufhauserbin Heidi Horten wurden innerhalb der anderthalb Regierungsjahre 931.000 Euro überwiesen, von einem Tiroler Baulöwen zusammen ebenfalls fast eine Million Euro. Alles schön in kleinen Tranchen, um eine Meldung an den Rechnungshof zu umgehen.
Wie blank die Nerven in der ÖVP-Zentrale angesichts der permanenten Enthüllungen liegen, zeigt der unwürdige Vorgang, als die Journalistin der investigativen Wochenzeitung "Falter" von einer Pressekonferenz ausgeschlossen wurde. Die von Kurz betriebene Öffentlichkeitsstrategie der "Message Control" geriet in demokratiepolitisch bedenkliche Sphären.
Ein "Bruder" aus der Partyszene
Die Gegner des Sebastian Kurz kämpfen mit harten Bandagen gegen eben diese PR-Strategie der ÖVP, so zum Beispiel die zunächst anonym auftretende Internetseite "Zoom.Institute". Dort beschäftigte man sich Mitte Juli akribisch mit dem nahen Verhältnis von Sebastian Kurz zu einem Unternehmer und Partyveranstalter namens Martin Ho. Der hatte Kurz in Medien als "Bruder" bezeichnet.
In schillernden Farben werden ausufernde Feste in der Wachau geschildert, wo Champagner geflossen sei und der damalige Bundeskanzler eine launige Laudatio auf Herrn Ho gehalten habe. Die Rechercheure haben sich auf Ho förmlich eingeschossen. Inzwischen hat sich der Betreiber der "Zoom.Institute"-Seite zu erkennen gegeben. Es ist Florian Schweitzer, ein 37-jähriger Aktivist und früherer Greenpeace-Sprecher, der mit dem Sperrfeuer gegen Kurz sein Medien-Start-up zu etablieren versucht.
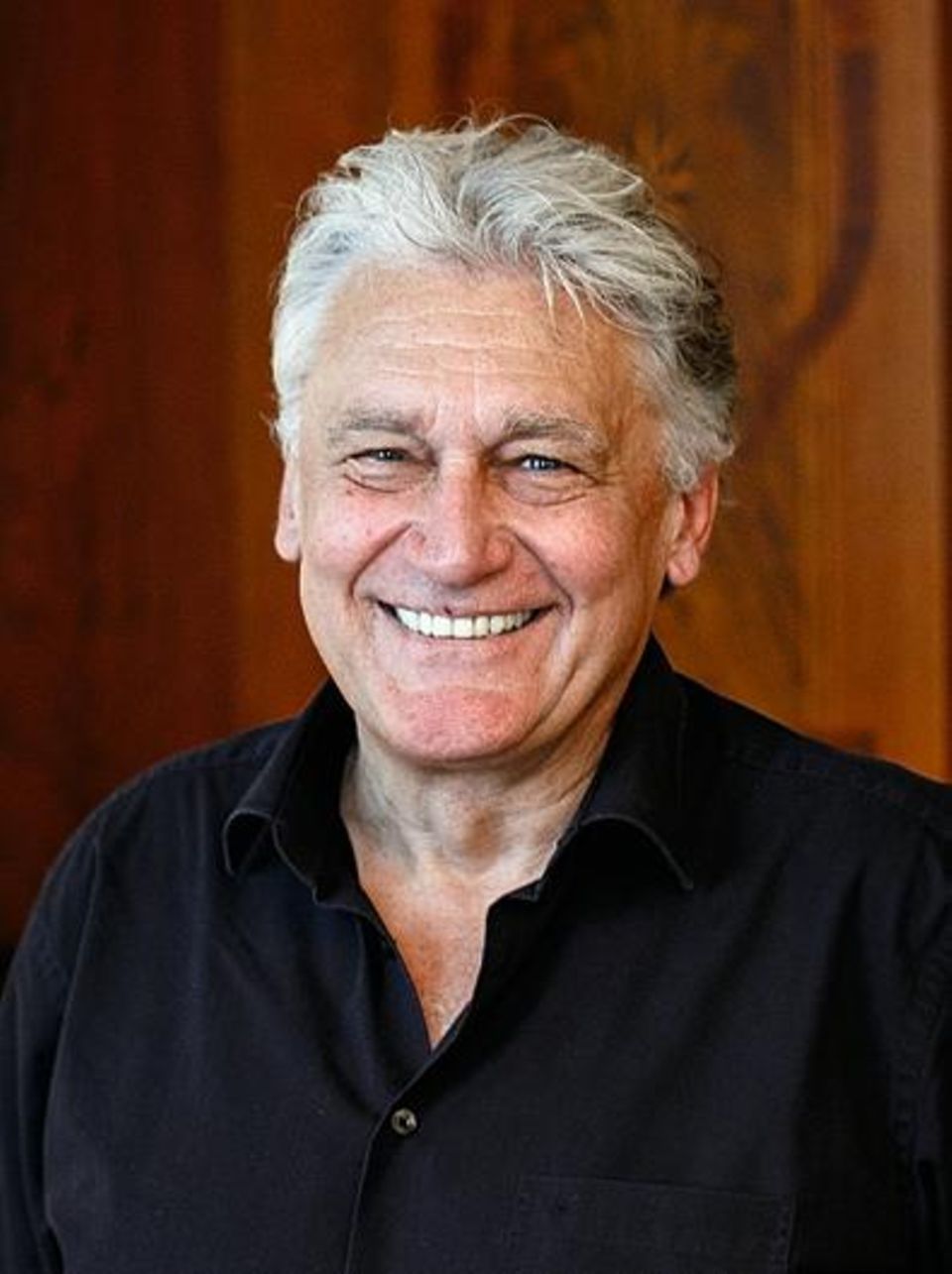
Er sitzt an einem Freitagabend Anfang September vor seinem Laptop am Wiener Naschmarkt, wo sich die Nachtschwärmer versammeln. "Es gab schon länger die Idee, eine investigative Plattform zu gründen", sagt Schweitzer. Als er in Martin Hos Etablissement "Club X" zu Gast gewesen sei und festgestellt habe, dass man dort recht einfach Drogen ordern könne, "habe ich mir gedacht, dass man sich das genauer anschauen muss". Schließlich habe Heinz-Christian Strache in den Videomitschnitten von Ibiza davon gesprochen, dass ein hochrangiger Politiker Verbindungen zu "einem der größtem Drogendealer Wiens" habe. Für Schweitzer liegt der Verdacht nahe, dass es sich dabei um Kurz und Ho handeln könnte.
"Wir sind in einen anderen Club von Ho gegangen und haben gesehen, dass dort systematisch Kokain verkauft wurde – und zwar so offen, dass die Clubbetreiber davon wissen müssten." Natürlich könne man das nicht Kurz anlasten, "aber wir wollen die Frage aufwerfen, ob er das richtige Gespür dafür hat, mit wem er sich als Repräsentant der Republik privat umgibt", sagt Schweitzer. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Wien ein Verfahren gegen Martin Ho eingeleitet. Wie stets gilt die Unschuldsvermutung.
Held seiner Wähler
Etwa zehn Menschen arbeiten laut Angaben von "Zoom.Institute" ehrenamtlich für das Portal. Die ÖVP und auch Kurz weisen die Vorwürfe zurück und sprechen von "Dirty Campaigning". Sebastian Kurz selbst nimmt auf der Unterstützer-Wanderung im Burgenland knapp Stellung. "Es ist schade, dass der Wahlkampf nicht fairer verläuft", sagt er. "Aber schauen Sie sich hier einmal um, das hier sind meine Unterstützer und Wähler. Glauben Sie, dass sich die von etwas beeinflussen lassen, was irgendwelche Homepages streuen?"
Der Wahlkampftross von Sebastian Kurz tourt indessen unermüdlich durchs Land und verbreitet gute Laune. In Murau, einer bezaubernden Kleinstadt in der Steiermark, spielt ein Volksmusikduo den Schlager "Aber Dich gibts nur einmal für mich". Wie in jedem Ort wartet ein beliebter Lokalpolitiker und darf dem Spitzenkandidaten Fragen stellen.
Kurz antwortet überall mit ähnlichen Sätzen und gut ausgearbeiteten Gags. Nach einem kleinen Seitenhieb auf Pamela Rendi-Wagner erzählt Kurz, wie er nach seiner Amtsenthebung mit zwei Freunden auf die Rax, einem Bergmassiv an der steirisch-niederösterreichischen Grenze, gewandert sei und danach zu Hause Spaghetti gekocht habe. "Als die Susanne, meine Freundin, nach Hause gekommen ist und die Verwüstung in der Küche gesehen hat, hat sie mich gefragt: ,Du, Sebastian, wie lange wirst du jetzt öfter zu Hause sein?" Die Anekdote ist bei jeder Veranstaltung ein Hit und garantierter Lacher. Und zeichnet nebenbei das Bild eines ganz normalen, bodenständigen Mannes, den man sich überall eher vorstellen kann als in schlechter Gesellschaft.

Manchmal trägt die PR-Maschinerie auch etwas zu dick auf. Etwa wenn die ÖVP die Schauspielerin Christiane Hörbiger in einem Videoclip sülzen lässt, wie "froh und glücklich" man gewesen sei, als Kurz Kanzler geworden sei. Der Misstrauensantrag von Rendi-Wagner sei "vollkommen verblödet", schimpft die Grande Dame. "Da muss der Hass und der Neid so groß sein, damit man so etwas macht." Der Aufruf geriet zur Lachnummer, andere Mitglieder der Schauspielerdynastie sahen sich zur Distanzierung veranlasst. "Große Familie, sehr unterschiedliche politische Ansichten", twitterte etwa Burgschauspielerin Mavie Hörbiger.
Trotz aller medial begleiteten Fehltritte – inklusive der Veröffentlichung einer peinlich distanzlosen Biografie – weiß Sebastian Kurz die Republik, die er regiert hat, gut einzuschätzen. Er setzt auf die persönliche Begegnung. Nach der aus drei Urnengängen bestehenden Präsidentschaftswahl 2016, den Nationalratswahlen 2017 und nun 2019 hat sich das Land an eine Art Dauerwahlkampf gewöhnt. Viele Bürger scheinen die permanenten Skandale und Enthüllungsgeschichten als Wahlkampfgetöse zu ignorieren. Und machen lieber Selfies mit ihrem Kanzler der Herzen.
Sebastian Kurz gewährt jede Anfrage
Nach einem langen Wahlkampftag, während dessen er seinen 33. Geburtstag auf diversen steirischen Marktplätzen begehen durfte, verlässt Sebastian Kurz ein Weinfest in der Stadt Leibnitz. Schnell noch ein Interview mit einem Privatsender, der dafür ein grelles Lichtset in einem öffentlichen Park aufgebaut hat. Danach bittet ein Kind aus der Zuschauermenge um ein Selfie, und plötzlich noch ein paar Jugendliche. Sebastian Kurz gewährt jede Anfrage wie stets, strahlt wie gewohnt in die Kameras. Dann ruft er allen ein fröhliches "Ciao" zu und steigt in die wartende Limousine.
Es ist unklar, ob er bemerkt hat, dass er gerade mit afghanischen Asylbewerbern Fotos geschossen hat. "Vielleicht können wir die Bilder zeigen, wenn wir die nächste Anhörung für das Asylverfahren haben", sagt Abdul Waseh Nazai, ein höflicher junger Mann, dessen erster Asylantrag gerade abgelehnt worden ist. "Wir möchten hierbleiben, wollen anständige Österreicher sein, arbeiten und Steuern zahlen", sagt er.
Die jungen Afghanen haben verinnerlicht, auf welche Werte und Worte es den Österreichern ankommt. Vielleicht ist es das, was Sebastian Kurz am meisten ausmacht: Projektionsfläche für alle möglichen Hoffnungen zu sein. Für manchen bedeutet eines dieser Selfies mit ihm die ganze Welt.
Dieser Artikel ist der aktuellen Ausgabe des stern entnommen: