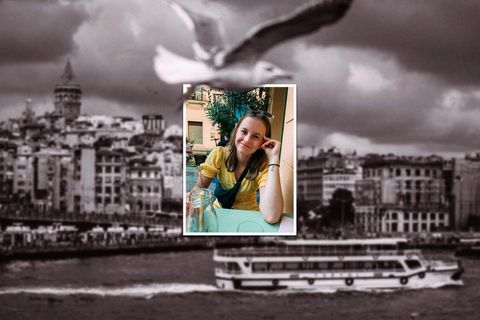Jeden Tag um vier in der Früh weckt Fatma ihre elfjährige Tochter Djaziye für die Arbeit. Im türkischen Torbalı, 20 Kilometer südöstlich der Küstenstadt Izmir, ist es noch dunkel. Djaziye gähnt, streckt sich und dreht sich nochmal um. Fatma bleibt hart – sie hat auch keine andere Wahl, denn draußen wartet schon der Traktor, der die beiden zu den Tomatenfeldern bringen wird.
Djaziye ist das älteste von sechs Kindern. Sie und ihre Familie sind vor zwei Jahren aus Aleppo geflohen und haben sich in einem Haus am Rande von Torbalı niedergelassen. Seitdem schuftet das Kind sechs Tage die Woche auf den Feldern. Die Arbeit beginnt zwischen vier und fünf Uhr in der Früh und endet um 14 Uhr. So wie Djaziye geht es Tausenden von Flüchtlingskindern in der Türkei. Bis zu elf Stunden am Tag ernten sie als billige Arbeitskräfte Obst und Gemüse, das dann auch nach Deutschland exportiert wird. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef geht davon aus, dass eine halbe Million syrische Kinder im Schulalter in der Türkei nicht zur Schule gehen. Doch die tatsächliche Zahl der arbeitenden Flüchtlingskinder ist schwer zu bestimmen.
Kinderarbeit ist schon immer ein verbreitetes Phänomen in der Türkei gewesen. Laut türkischem Statistikinstitut Turkstat gab es 2014 eine Million arbeitende Kinder im Land. Die Hälfte von ihnen war im Landwirtschaftssektor tätig. Die aktuelle Zahl dürfte deutlich gestiegen sein, seit mehr als 1,5 Millionen Flüchtlingskinder in der Türkei leben. Das türkische Arbeitsgesetz sieht eigentlich vor, dass Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren keine harten Tätigkeiten durchführen dürfen. Jüngere Kinder dürfen überhaupt nicht arbeiten. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Das Arbeitsgesetz gilt nicht für Landwirtschaftsbetriebe mit weniger als 50 Arbeitern.
"Die ganze Zeit schreien sie 'schneller, schneller!'"
"Meine Tochter war eine sehr gute Schülerin in Aleppo", sagt Fatma. Mutter und Tochter sitzen auf dem Boden ihres spärlich eingerichteten Wohnzimmers. Djaziye lehnt das Gesicht auf die Knie, die sie nah am Körper hält. In ihren viel zu breiten schwarzen Hosen sieht sie noch jünger aus als ihre elf Jahre. Sie hat heute zehn Stunden Arbeit hinter sich. Auch wegen ihrer Kinder sei Fatma aus Syrien geflüchtet: "Ich wollte meiner Tochter ein besseres Leben bieten, aber jetzt wage ich es nicht einmal, davon zu träumen", sagt sie. Fragt man Djaziye nach ihren Zukunftsträumen, sagt sie, dass sie Lehrerin werden wollte. Wollte, als sie in Aleppo war. Jetzt nicht mehr.
Sechs Tage die Woche pflücken Mutter und Tochter Tomaten - für 37 Lira (rund zehn Euro) am Tag. Der Lohn sollte am Ende jeder Woche von den Mittelmännern ausgezahlt werden, von ihnen werden die Frauen während der Schichten überwacht. "Aber wir warten manchmal sogar Monate, bis sie uns bezahlen", sagt Fatma. "Tschavusch", so nennt sie die Aufseher, "Bosse". Jedes Feld hat einen Tschavusch. Er entscheidet, wie viel Gemüse pro Tag gepflückt werden muss, kontrolliert die Arbeiterinnen und behält einen Teil des Lohns als Provision. "Die Tschavusch lassen uns keine Ruhe. Die ganze Zeit schreien sie 'schneller, schneller!'", sagt Fatma. Ihre Tochter Djaziye hält sich noch fester an den Knien.
Auch wenn ihre Schicht eigentlich zu Ende ist, dürfen die Frauen und Kinder das Feld nicht verlassen, bis der LKW voll ist. In einen LKW passen ungefähr 600 Kisten. "Ist er nicht voll, dürfen wir nicht gehen", sagt Fatma.
Keine wagt, sich zu beklagen
Eine andere Arbeiterin, Iman (15), verließ ihre Heimat Kobane, als der IS den Kampf gegen die Kurden begann. Sie erzählt von einer ähnlichen Situation: "Wir dürfen nicht einmal miteinander sprechen während der Schicht", sagt sie. In Kobane lebte Iman mit ihrer achtköpfige Familie in einem Haus. Der Vater arbeitete für die Gemeinde. Vor einem Jahr kam sie nach Torbalı - und hat seitdem schon Tomaten, Gurken und grüne Paprikas gepflückt. Während der zehnstündigen Schichten hat sie nur dreißig Minuten Pause. Sie isst dann mit den anderen Arbeiterinnen die Brotzeit, die sie von zu Hause mitgenommen hat. Die Aufseher schenken nur Wasser aus. Keine wagt, sich zu beklagen, denn: "Wenn du den Befehlen nicht folgst, bist du sofort raus", sagt Iman. Rauszufliegen würde für sie heißen, dass ihre Familie verhungern würde. Nur sie und ihr 14-jähriger Bruder bringen Geld nach Hause.
Die Türkei ist im Landwirtschaftssektor der stärkste Produzent in Europa mit dem größten Volumen. Deutschland ist oft an Platz zwei in der Ranglister der Exportländer. Deutschland importierte im ersten Halbjahr 2016 Obst- und Gemüse aus der Türkei im Wert von 110 Millionen US-Dollar.
"Die Landwirtschaft ist ein strategischer Sektor und wir handeln dementsprechend", hatte 2012 der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan gesagt. Seit dem Sieg seiner Partei AKP stiegen die Zahlen des Obst- und Gemüseexportes stark an: 2015 im Wert von 12,3 Milliarden US Dollar; 2002 waren es nur drei Milliarden.
Die Landbesitzer beuten die Situation aus
Eine große Nachfrage fordert immer mehr Arbeitnehmer, die im besten Fall bereit sind, für wenig Geld zu schuften. Der Krieg in Syrien hat um die 2,7 Millionen Menschen in die Türkei vertrieben – und somit jede Menge billige Arbeitskräfte beschaffen. Die Flüchtlinge, die in den staatlichen Lagern untergebracht sind, erhalten eine Grundversorgung. Aber die mehr als zwei Millionen Menschen, die außerhalb der Camps leben, sind auf sich selbst gestellt. Seit Januar 2016 dürfen Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis erhalten, allerdings müssen sie dafür seit sechs Monaten in der Türkei leben.
Die Erlaubnis gilt weiterhin nur an dem Ort, an dem die Flüchtlinge registriert wurden – ganz unabhängig davon, ob sie dort bleiben möchten und ob es dort überhaupt Arbeitsplätze gibt. Die Landbesitzer und die Mittelmänner wissen, unter welchen prekären und verzweifelten Konditionen die syrische Bevölkerung in der Türkei lebt. Sie beuten die Situation aus. Landwirtschaftsarbeiter würden um die 20 Euro pro Tag verdienen, die Flüchtlinge bekommen die Hälfte davon – und arbeiten dazu ohne jegliche soziale Absicherung. Jungen Mädchen und Frauen wird sogar noch weniger gezahlt als den Jungen und Männern, deshalb werden sie bevorzugt beschäftigt.
Ein Schotterweg führt von der Hauptstraße zu einem der vielen Felder rund um Torbalı. Fünfzehn Frauen hocken auf dem Boden und pflücken Tomaten. Medina (15) ist eine von ihnen. Sie kommt aus Aleppo und arbeitet in der Türkei seit sie 13 ist. Ein gelb-schwarzes Tuch bedeckt ihr Gesicht, das sie zusätzlich mit einer Schirmmütze schützt. Medina und ihr Bruder Hüseyin (30), verdienen zehn Euro pro Tag. Neulich haben die Aufseher den beiden versprochen, ihren Lohn um zwei Euro zu erhöhen. Medina freut sich drauf – aber nur bedingt: "Ich habe keine Wünsche mehr für mein Leben. Ich will nur irgendwann nach Aleppo zurück", sagt sie. Die Tomaten, die Medina und die anderen Arbeiterinnen pflücken, gehen zu einem Lokalunternehmer in Torbalı, der sie trocknet und dann exportiert. Nach Großbritannien, Australien und nach Deutschland.
"Sie sind Kinder, die Nächte sind zu hart für sie"
Die Arbeiter wissen meistens, wohin die Früchte und Gemüse gehen, die sie pflücken: "Die Aufseher sagen uns: 'Diese Ladung geht nach Deutschland', oder: 'Pflückt nur die besten Tomaten für Europa'", sagt Djaziyes Mutter Fatma.
Ahmed (45), der in seiner Heimat Efrin Schulleiter war und nun in einer Fabrik arbeitet, die in Torbalı Tomatensauce produziert, erzählt, dass er Etiketten auf Deutsch, Englisch und Russisch auf die Dosen klebt. Er berichtet auch von syrischen Kindern, die mit ihm in der Fabrik arbeiten und während der Nachtschicht ohnmächtig werden: "Sie sind Kinder, die Nächte sind zu hart für sie", sagt er. Laut Artikel 73 des türkischen Arbeitsgesetzes ist es eigentlich nicht erlaubt, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren für Nachtschichten einzusetzen.
Experten fürchten, dass aus den arbeitenden Kindern eine verstörte Generation entstehen wird. "Wir nennen sie verlorene Generation", sagt Professor Cem Terzi auf dem Balkon einer Wohnung in Izmir. Terzi ist Vorsitzender des Vereins Halkların Köprüsü, der sich für syrische Flüchtlinge einsetzt. "Diese Kinder sind vom Krieg traumatisiert, haben aber keinen Raum, um dieses Trauma aufzuarbeiten", sagt er. Man wisse nicht, was in zehn Jahren aus ihnen werde. Auch Sozialarbeiter Muhammed Salih, der in einer Izmirer Gasse ein Zentrum für syrische Frauen und Kinder betreibt, ist sich sicher: "Aus verstörten Kindern werden verstörte Erwachsene."
Kaum ein Flüchtlingskind hat Zugang zu Bildung
Vor dem Krieg lag die Einschulungsquote für syrische Kinder im Grundschulalter bei 99 Prozent. Obwohl die türkische Regierung sich seit 2014 bemüht, Flüchtlingskindern einen einfacheren Zugang zur Bildung zu verschaffen, gingen im Schuljahr 2015/2016 nur 25 Prozent der syrischen Kinder außerhalb der Lager zur Schule.
Die wenigen Einrichtungen, die gleichzeitig auf Arabisch und Türkisch unterrichten, in großen Städten. Die Kinder in ländlichen Gebieten haben keinen Zugang zur Bildung. Die Eltern beklagen sich selten: "Keiner interessiert sich für Schulen, wenn sie nichts zum Essen haben", sagt Sozialarbeiter Salih.
Der ehemalige Schulleiter Ahmed versucht gerade, diese Situation zu lösen: "Ich war schon bei allen möglichen Behörden, um eine Schule für Flüchtlinge hier in Torbalı zu eröffnen, aber man sagt mir, es fehle dafür ein passender Raum", sagt er. Ahmed ist sich sicher: Wenn die syrischen Kinder in Torbalı in die Schule gehen würden, hätten sie eine bessere Zukunft, statt als billige Arbeitskräfte auf den Feldern zu arbeiten.
Deutschland ist mit der wichtigste Abnehmer
Im März 2016 ist das Türkei-EU-Flüchtlingsabkommen in Kraft getreten. Während die europäische Union und die Türkei sich weiterhin über das Abkommen und seine Effektivität streiten, sind Tausende von Familien auf sich gestellt, in einem Land, in dem die Hälfte der Arbeiter in der Landwirtschaft Kinder sind.
In Menemen, eine Autostunde von Torbalı entfernt, sitzen die Geschwister Imhan, 13, und Suad, 14, auf dem Boden ihres Wohnzimmers. Sie haben ihre Heimat Kobane vor zwei Jahren verlassen, als Kämpfer des Islamischen Staates ihr Haus in Brand steckten. Imhan, die in Syrien gerne Ärztin geworden wäre, hat heute zehn Stunden lang Tomaten gepflückt. Fragt man sie, ob sie im Herbst in die Schule gehen wird, sagt sie: "Natürlich nicht. Herbst, das ist die Weintraubensaison". Aus den Weintrauben, die in Menemen wachsen, werden hauptsächlich Rosinen gemacht, die dann in die EU exportiert werden. Die drei wichtigsten Hauptabnehmer sind auch dieses Jahr Großbritannien, die Niederlande und Deutschland.