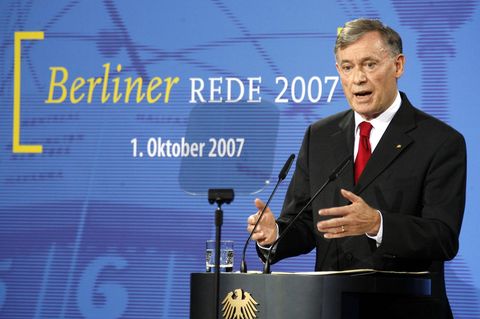Bundespräsident Horst Köhler hat die von den Nazis als Verräter gebrandmarkten Widerständler vom 20. Juli 1944 als Patrioten gewürdigt. Den Tag des Attentats auf Adolf Hitler nannte Köhler ein "Ehrendatum der deutschen Geschichte". Am Dienstag gedenkt die Bundesregierung in einer zentralen Feierstunde mit Köhler und Kanzler Gerhard Schröder den Ermordeten des Widerstands gegen die NS-Gewaltherrschaft. Am Montagabend fand im Berliner Bendlerblock ein feierliches Soldatengelöbnis statt.
"Sie haben das, was sie getan haben, für Deutschland getan"
Anlässlich des 60. Jahrestags des Umsturzversuchs empfing Köhler Angehörige des Widerstands gegen das nationalsozialistische Regime. Er erklärte, der 20. Juli 1944 zeige, dass sich "längst nicht alle in Deutschland mit Diktatur, Barbarei und Völkermord abfinden wollten". Der Bundespräsident würdigte die Männer und Frauen um den Attentäter Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Patrioten. "Sie haben das, was sie getan und was sie auf sich genommen haben, für Deutschland getan - für die Selbstachtung unseres Landes und für eine bessere Zukunft".
Köhler nannte es richtig, dass sich die Bundeswehr in die Tradition des 20. Julis stelle. Deshalb finde der feierliche Appell im Bendlerblock statt. In den Gebäuden am Landwehrkanal, heute Berliner Dienstsitz des Verteidigungsministers, war im Zweiten Weltkrieg das Allgemeine Heeresamt untergebracht. Dort arbeitete Stauffenberg. Im Hof wurden er und seine engsten Vertrauten noch in der Nacht nach dem Umsturzversuch hingerichtet.
Wachsender zeitlicher Abstand
Mit wachsendem zeitlichen Abstand rückten die Männer und Frauen des Widerstands gegen Adolf Hitler scheinbar näher, sagte Kulturstaatsministerin Christina Weiss. Sie eröffnete im Bendlerblock eine Ausstellung, die an die Motive, Intentionen und Ziele der Menschen erinnern will, die den Umsturz planten.
Weiss verwies auf eine "Spiegel"-Umfrage, wonach 33 Prozent der Bundesbürger den Widerständlern mit Bewunderung und weitere 40 Prozent mit Achtung begegneten. Eine solche Befragung wäre in den 50er und 60er Jahren eindeutig anders ausgefallen. Die von den Nazis ausgegebene Parole von den Verrätern habe lange nachgewirkt.
"Im kollektiven Gedächtnis der Deutschen angekommen"
Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Bendlerblock, sagte, in den 50er Jahren habe man keine Straße nach Stauffenberg benennen können. Inzwischen sei der 20. Juli 1944 "im kollektiven Gedächtnis der Deutschen angekommen".
Die Kulturstaatsministerin räumte ein, dass auch heute noch eine "geistige Grenze" zu den Attentätern bestehe. So seien als Stauffenbergs letzte Worte vor seiner Erschießung am 20. Juli 1944 im Hof des Bendlerblocks überliefert: "Es lebe das heilige Deutschland." Heiligkeit werde heute aber eher mit Scheinheiligkeit in Verbindung gebracht als mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das bis 1806 bestanden habe.
Wissenslücke bei den Jüngeren
Nach einer Allensbach-Umfrage verschwindet der Tag des Attentats auf Hitler allerdings allmählich aus dem Bewusstsein: Nur noch 54 Prozent der Deutschen wissen, was sich damals ereignet hat. Besonders die junge Generation kann mit dem 20. Juli 1944 sehr wenig anfangen: In der Altersgruppe von 16 bis 29 Jahren konnte nur noch jeder Vierte (27 Prozent) sagen, woran das Datum erinnern soll.