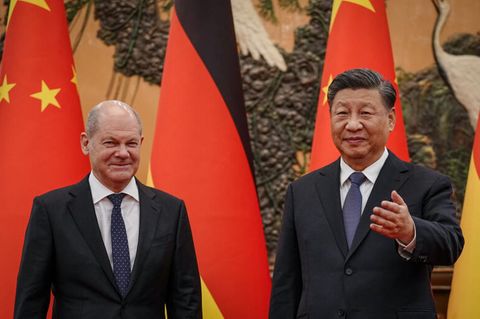Professor Snower, können Sie als Ökonom die Wut der Opel-Arbeiter verstehen?
Die kann ich sogar sehr gut verstehen, denn die ist aus deren Sicht berechtigt. Ich kann allerdings auch den Wunsch der General-Motors-Manager verstehen, Fabriken wettbewerbsfähig zu machen, mit denen sie seit vielen Jahren viel Geld verlieren.
Unternehmen wie Volkswagen oder Daimler verhandeln zumindest mit ihren Belegschaften über notwendige Kosteneinsparungen. GM kippt den Leuten als Erstes die Drohung vor die Füße, 12 000 Jobs zu streichen. Ist das der spezielle amerikanische Stil?
Ach nein, auch in Amerika ist es mal so, mal so: Machmal wird gleich gedroht, manchmal wird erst mal nett geredet. Es ist auch nicht so entscheidend, ob man früher oder später böse wird. Entscheidend ist, dass man zu den wirklich wichtigen Dingen kommt.
Dennis J. Snower
Dennis J. Snower ist seit dem 1. Oktober Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. Der 54-Jährige, Sohn eines Amerikaners und einer Österreicherin und in Wien geboren, ist US-Bürger, hat aber viele Jahre in Europa gelebt. Seine Ausbildung begann er in Oxford und Princeton. Seither hat er an vielen Universitäten in den USA, in Europa und Israel gelehrt. Das IfW ist eine der ersten Adressen der deutschen Wirtschaftsforschung und hat unter den früheren Präsidenten Herbert Giersch und Horst Siebert eine streng marktwirtschaftliche Politik vertreten. Snower gilt hingegen als Pragmatiker, der keiner Ideologie anhängt
Die wären?
Wie kann man das berechtigte Interesse der Beschäftigten an Sicherheit erfüllen und zugleich effizient wirtschaften? Mehr denn je bestimmen heute die Kunden den Markt. Von ihrer Nachfrage hängt es ab, wie die Arbeit zu organisieren ist - und der Flexibilität der Arbeit muss auch die Flexibilität der Löhne folgen. Das muss nicht heißen, dass die Arbeiter ständig Lohnschwankungen hinnehmen müssen. Aber die Arbeit wird immer heterogener, und der Einheitslohn für einen Beruf in einem ganzen Land ist weder effizient noch zeitgemäß. Heute würde, anders als nach dem Krieg, die Idee völlig absurd erscheinen, für bestimmte Produkte einheitliche Preise vorzugeben - aber bei den Löhnen machen wir das. Wenn GM selbst mit Fabriken in einem Land wie Frankreich Hunderte Millionen sparen könnte, haben die deutschen Opel-Arbeiter offensichtlich ein Problem.
Soll heißen: Der Flächentarifvertrag, der den Beschäftigten immerhin ein bisschen Sicherheit gibt, ist von gestern.
Langfristig sicher am Flächentarif ist nur, dass die Leute irgendwann ihren Job verlieren, wenn sie zu teuer sind. Was ist denn das für eine Sicherheit? In erfolgreicheren Industrieländern werden die Löhne heute betriebsbezogen oder sogar individuell ausgehandelt.
In Deutschland macht sich eine gefährlich düstere Stimmung breit: Dieser brutale Standortwettbewerb sei ohnehin nicht mehr zu gewinnen. Ist diese Depressivität berechtigt?
Offen gestanden ist die total berechtigt - unter den gegebenen wirtschaftspolitischen Umständen. Aber es geht mir gar nicht darum, den puren Markt zu propagieren. Die Deutschen sind im Vergleich zu den Amerikanern risikoscheu, sie wollen viel Sicherheit. Das ist ein Auftrag an die Politik, die muss das berücksichtigen. Aber sie muss moderne Formen der Sicherheit finden, und sie muss positive Anreize setzen.
Ein Beispiel, bitte.
Wir brauchen Beschäftigungskonten. Jeder Arbeitnehmer zahlt auf ein individuelles Konto und dafür weniger Steuern. Wird er arbeitslos, kann er daraus Geld entnehmen. Behält er seinen Job, kann er sich später im Alter die Rente daraus aufstocken. Das wäre ein echter positiver Anreiz. Man kann auch in einem solchen System umverteilen, indem etwa die Konten der Reichen besteuert und die der Armen subventioniert werden. Aber das Ganze ist sehr viel effizienter als die anonyme Arbeitslosenversicherung, die absolut keine positiven Anreize setzt, im Gegenteil: Je länger einer arbeitslos ist, desto mehr Geld bekommt er auf die Dauer vom Staat.
Die deutschen Opel-Arbeiter haben vor allem deshalb ein Problem, weil sie für das Unternehmen teurer sind als etwa die Kollegen in Schweden, obwohl die netto kaum weniger verdienen. Der Grund ist, dass die Kosten des deutschen Sozialstaats zu großen Teilen der Arbeit aufgebürdet werden. Kann das so weitergehen?
Nein, das darf auf keinen Fall so weitergehen. Die skandinavischen und die angelsächsischen Länder sind da viel besser organisiert. Und die so genannten deutschen Sozialversicherungen sind auch überhaupt keine Versicherungen, da macht man den Bürgern etwas vor. Das Wesen einer Versicherung ist, dass derjenige mehr bezahlt, der ein höheres Risiko hat - etwa beim Autofahren. Das ist ein effizientes System.
Das heißt, der Kranke soll mehr bezahlen als der Gesunde?
Im Prinzip ja. Aber gut, die Deutschen lieben die Umverteilung. Sollen sie haben; der Kranke, der Behinderte, der Arme soll auch weiterhin geschützt werden. Aber die Umverteilung lässt sich viel effizienter und moderner organisieren, und es sind auch im Gesundheitswesen positive Anreize notwendig, Geld zu sparen. In Deutschland schmeißen wir unglaublich viel Geld zum Fenster hinaus. In der aktuellen Debatte um die Reform des Gesundheitswesens - Stichwort Kopfpauschale versus Bürgerversicherung - geht es im Kern darum, ob zur Finanzierung die Einkommensteuer erhöht werden soll. Aber dann soll man das doch offen sagen! Und trotz Hartz IV und all der anderen Reformen machen sich die Deutschen noch immer zu wenig Gedanken über ein effizientes System. Sie leiden darunter, dass sie nun im Notfall weniger bekämen, sie ängstigen sich um die Sparkonten ihrer Kinder. Aber sie stellen nicht die wirklich wichtigen Fragen: Was zum Beispiel hat einer davon, wieder zu arbeiten? Schaut man sich da die Realität an, wird man wirklich depressiv.
Was macht Sie denn da so fertig?
Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Nehmen wir einen Langzeitarbeitslosen, der einen Teilzeitjob von monatlich 50 Stunden à acht Euro findet. Effektiv bleiben ihm davon wegen der geltenden Anrechnungsbestimmungen ungefähr 2,45 Euro pro Stunde. Dann findet er sogar eine bessere Stelle: 100 Stunden statt 50. Nun bleiben ihm pro Stunde noch 34 Cent. Das ist doch zum Heulen! Was ist das für ein Anreiz?
In der Realität findet unser Langzeitarbeitsloser dummerweise gar keinen Job.
Deshalb müssen wir auch Anreize bieten, überhaupt Jobs zu schaffen. Dazu können wir zum Beispiel einen Teil der Milliarden einsetzen, mit denen wir heute die Arbeitslosigkeit finanzieren. Und zwar durch Beschäftigungsgutscheine: Wir geben den Arbeitslosen das Recht, einen Teil ihrer Unterstützung für die Jobsuche einzusetzen, indem das Geld der neue Arbeitgeber bekommt.
Ach so, die guten alten Lohnkostenzuschüsse.
Aber die fallen umso höher aus, je länger einer arbeitslos ist. Weil das Unternehmen dadurch niedrigere Kosten hat, kann es dem neuen Mitarbeiter einen höheren Lohn zahlen: Beide haben einen Anreiz, für beide lohnt es sich. Das Beispiel zeigt: Wir brauchen heute einen Mix aus Nachfrage- und Angebotspolitik, der alte Streit der Ideologien ist nun wirklich passé. Wir sollten weniger Geld umverteilen, wir sollten Anreize umverteilen.
Sie schlagen einen grundlegenden Wandel in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik vor. Aber die Bundesbürger sind der Veränderungen müde, weil die nach ihrer Empfindung doch nur auf ihre Kosten gehen. Lassen sich grundlegende Reformen gegen die Menschen durchsetzen?
Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Ich hatte kürzlich einen medizinischen Eingriff an der Schulter, er wurde mit modernster Lasertechnik durchgeführt. Ich habe nicht gesagt: Nein, ich möchte lieber eine alte Operation wie früher mit einem langen Schnitt und großen Schmerzen. Diese Entscheidung habe ich selbstverständlich den Experten überlassen. Doch geht es um Ökonomie, gelten diese Regeln nicht. Da rufen alle Laien durcheinander: Nein, nehmt nicht das Skalpell, nehmt lieber das andere! Selbstverständlich muss die Politik die Wünsche der Menschen etwa nach Sicherheit und Umverteilung berücksichtigen. Aber wenn es darum geht, wie diese Wünsche am besten zu erreichen sind, sollten die Menschen dann auch ein bisschen mehr Vertrauen in die Experten haben.
Sie sind lustig: Die Experten sind sich doch selbst nicht einig.
Sie sind zuweilen uneins über den taktisch richtigen Weg: Wie lassen sich am ehesten politische Widerstände überwinden, wie viele Rücksichten müssen genommen werden? In den grundlegenden Befunden sind sich die Experten aber ziemlich einig - etwa, dass es Anreize für Beschäftigung geben muss. Allerdings reden zum Beispiel in der Politik auch viele mit, die sich als Experten ausgeben, aber tatsächlich keine Ahnung haben. Dadurch entsteht der Eindruck der Uneinigkeit.
Eine Frage aber bleibt: Wo entstehen die Jobs der Zukunft?
Nach dem Zweiten Weltkrieg dachten viele Experten, die Märkte seien gesättigt, es gebe keinen Bedarf an neuen Gütern. Der Boom bei Computern, Mobiltelefonen, Gameboys: Niemand hat ihn nur geahnt. Mit dieser Frage sollten wir uns nicht beschäftigen. Das ist der Job des Marktes. Unsere Aufgabe ist es, Anreize zu schaffen, damit der Markt diesen Job erledigen kann.
Schade, Sie haben die Antwort also auch nicht.
Es gibt nur einen Typus, der diese Antwort zu haben glaubte und deswegen befahl: Investiert hier und dort, macht dies und das. Das waren die Kommunisten.