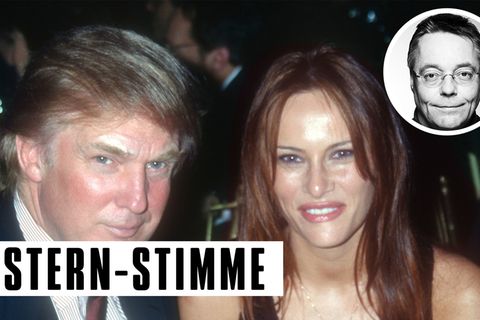Mehr als 60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs bekommt Deutschland ein Dokumentationszentrum zu Flucht und Vertreibung. Das Bundeskabinett stimmte einem entsprechenden Konzept von Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) zu. Gegen das vom Bund der Vertriebenen initiierte Vorhaben hatte es jahrelangen heftigen Widerstand vor allem aus Polen gegeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte das im Koalitionsvertrag vereinbarte "Sichtbare Zeichen gegen Flucht und Vertreibung" aber besonders unterstützt.
Das Dokumentationszentrum wird unter dem Dach des Deutschen Historischen Museums in Berlin angesiedelt. Es soll Erinnerung und Gedenken an das "Jahrhundert der Vertreibungen" und das damit verbundene tiefe menschliche Leid in Europa wachhalten und zur Versöhnung beitragen. Dabei sollen "der historische Kontext, Ursachen und Beweggründe von Flucht und Vertreibung differenziert dargestellt werden". Geplant ist auch die Dokumentation persönlicher Einzelschicksale der 12 bis 14 Millionen deutschen Vertriebenen sowie der Angehörigen anderer Völker, deren Vertreibung von deutscher Seite verursacht wurde - etwa der 1,5 Millionen Polen, die nach dem Krieg aus dem sowjetisch annektierten Ostpolen nach Westen geschickt wurden.
Auch Nazi-Verbrechen dokumentieren
"Ausreichend dokumentiert" werden sollen dabei die nationalsozialistischen Verbrechen besonders in Polen und Tschechien, den anderen Ländern Ostmitteleuropas und der Sowjetunion, die Flucht und Vertreibung während und nach dem Zweiten Weltkrieg vorausgegangen waren. Aber auch die Jahrhunderte währende Siedlungs- und Kulturgeschichte der Deutschen in diesen Gebieten soll einbezogen werden.
Staatsminister Neumann sprach von einem wichtigen Schritt zur "Aufarbeitung eines schmerzlichen Teils deutscher und europäischer Geschichte" des 20. Jahrhunderts". Das herausragende historische Gedenkprojekt sei eine der schwierigsten Aufgaben seiner Amtszeit. "Es war mir auch ein großes Anliegen, die Unstimmigkeiten mit unserem Nachbarn Polen in der Frage des Gedenkens an Flucht und Vertreibung beizulegen."
Die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen (BdV), die CDU- Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach, begrüßte die "wichtige und längst überfällige Entscheidung" für ein würdevolles Dokumentationszentrum. Das Schicksal der Vertriebenen erhalte "einen festen Ort im kollektiven Gedächtnis unseres Vaterlandes". Steinbach geht davon aus, dass sie auch in den Gremien des Zentrums mitarbeiten wird. Für die Grünen- Fraktion im Bundestag ist dieser Punkt noch ungeklärt. Die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen des BdV bleibt laut Steinbach mit ihren Aktivitäten und Veranstaltungen unberührt, auch wenn jetzt kein eigenes Museum mehr nötig ist.
Sudentendeutsche begrüßen Einigung
Auch die Sudetendeutschen haben die Entscheidung begrüßt. "Das ist ein wichtiger Durchbruch in der Vertriebenenpolitik", erklärte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und EU-Parlamentarier Bernd Posselt (CSU) am Mittwoch in München. Vom früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) seien sie als Randgruppe abqualifiziert worden. Nun erhielten die deutschen Heimatvertriebenen und ihre Nachkommen eine Dokumentationsstätte ihres Schicksals in der Hauptstadt. "Nun müssen wir darauf achten, dass diese Initiative nicht verfälscht oder zweckentfremdet wird."
Das als Bundesstiftung angelegte Projekt wird 29 Millionen Euro kosten und jährlich weitere 2,4 Millionen Euro für den laufenden Betrieb. Kern wird eine Dauerausstellung im Deutschlandhaus am Anhalter Bahnhof in Berlin sein. Außerdem sind Wechselausstellungen, Publikationen und Veranstaltungen geplant. So soll noch in diesem Jahr eine internationale Historikerkonferenz stattfinden.
"Kein Verdacht des Revanchismus"
In den Gremien des Dokumentationszentrums werden Vertreter der Bundesregierung, des Bundestages sowie der Vertriebenen und anderer Gruppen mitarbeiten. Die Bundesregierung erwartet im wissenschaftlichen Beirat auch die Mitarbeit ausländischer Experten besonders aus den europäischen Nachbarländern wie Polen, Ungarn und Tschechien. Noch bis vor kurzem hatte sich Polen heftig gegen das Zentrum gewehrt, weil befürchtet wurde, die Deutschen wollten die Verantwortung für die Vertreibungen relativieren. Erst nach dem Regierungswechsel in Polen hatte ein Treffen Neumanns mit dem polnischen Deutschland-Beauftragten Wladyslaw Bartoszewski Anfang Februar in Warschau den Durchbruch gebracht: Polen geht nun von einer deutschen Angelegenheit aus und nicht mehr von einem Affront. Die SPD-Bundestagsfraktion hob hervor, das Dokumentationszentrum werde bei den Nachbarn keinen "Verdacht des Revanchismus" hervorrufen.