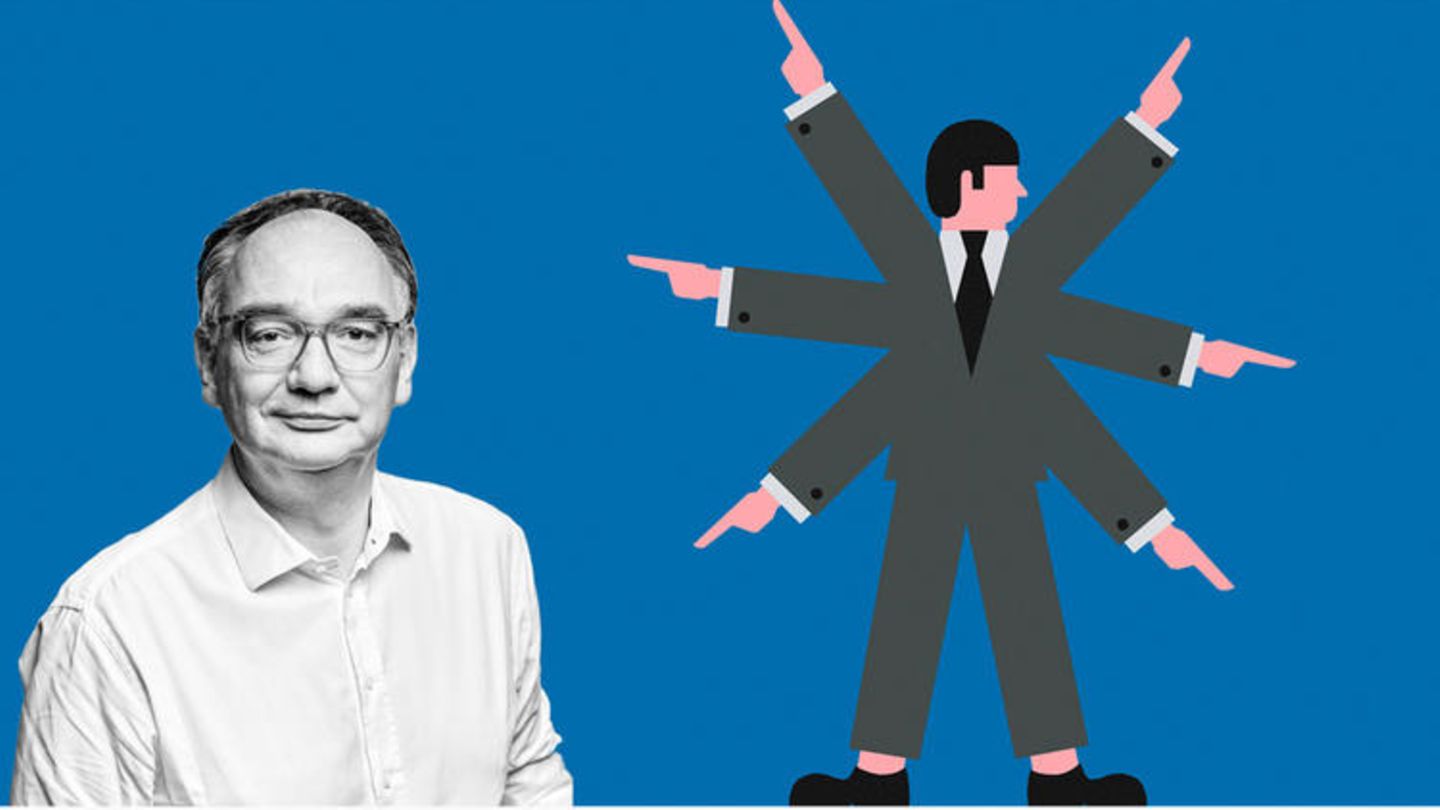Hubert Aiwanger, Bayerns Vize-Ministerpräsident, ist wegen eines widerwärtigen Flugblatts unter Druck geraten. Das Pamphlet, in dem ein fingierter Wettbewerb mit einem Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz als Preis ausgeschrieben wurde, hatte man vor 35 Jahren bei Aiwanger gefunden. Kaum waren die Vorwürfe jetzt bekannt, riefen Verteidiger Aiwangers den Fall eines anderen Politikers auf, der sich wegen seiner Vergangenheit erklären musste: Joschka Fischer.
Diese Reaktion nennt man heute "Whataboutism". Das bedeutet, dass bei Kritik an einer Person deren Verteidiger zum Zwecke der Relativierung die Kritik an einer anderen Person bemühen. Sie fragen: "What about …?", zu Deutsch: "Was ist mit …?" Ziel ist es, den Kritikern zweierlei Maß nachzuweisen: Den einen bestraft ihr, den anderen lasst ihr laufen. Richtig ist, dass Whataboutism oft ein Ablenkungsmanöver ist, um sich mit dem Kern der Vorwürfe nicht befassen zu müssen. Richtig ist aber auch, dass Whataboutism heute bisweilen als Schlagwort benutzt wird, um eine Diskussion abzuwürgen, die sich durchaus lohnen könnte – wie über Aiwanger und Fischer.
Aiwanger entzieht sich dem Druck
So könnte man sich mit Aiwangers möglichem Vergehen und seiner Bedeutung für heute gut auseinandersetzen – würde er es denn selbst tun. Doch alles, was Aiwanger bis Anfang der Woche beschrieben hatte, lief darauf hinaus, sich dem Druck zu entziehen, nicht darauf, zu erklären, was passiert ist, als er 16 war, und warum.
Joschka Fischer, der zur Zeit seiner Karriere als Demonstrant und Steinewerfer schon erwachsen war, hatte sich bereits vor seiner Zeit als Außenminister zu seiner Vergangenheit bekannt, zumindest allgemein. Nach 2001, als der stern Bilder druckte, die ihn bei der Misshandlung eines Polizisten zeigten, erklärte sich Fischer weiter – mal mit konkreten Erinnerungen, mal mit Lücken in der Erinnerung, mal überzeugend, mal weniger überzeugend. Aber zumindest konnte man seine Darstellung diskutieren und bewerten, was auch wochenlang höchst kontrovers geschah.
Fischer hat einen Irrtum rechtzeitig erkannt
In der Debatte um Fischer war die Integrationsfähigkeit der Demokratie ein großes Thema. Die hatte bis dahin einen ambivalenten Ruf, weil sie auch einem Nazi wie Hans Globke die Fortsetzung seiner Karriere im Kanzleramt ermöglicht hatte. In der Person Fischer zeigte sich hingegen positiv, dass auch Möchtegern-Revolutionäre zu Demokraten werden können.
Bei Hubert Aiwanger liegt der Fall insofern anders, weil die gegenwärtige Demokratie bei ihm kein hohes Ansehen genießt. Jüngst rief er die Zuhörer einer Kundgebung dazu auf, sich die Demokratie zurückzuholen, kurz darauf bezeichnete er sie als nur noch "formal". Es ist also zweifelhaft, ob Aiwanger gerade auf die Integrationskraft dieser Demokratie Wert legt oder sich gerade aus der bewussten Distanzierung persönlich mehr verspricht.
Der größte Unterschied der beiden Fälle liegt in ihrer historischen Einordnung: Fischers Straßenkämpfertum stand am Anfang einer Radikalisierung der Linken, von der er sich spät, aber glaubwürdig und dauerhaft distanzierte, als sie im RAF-Terrorismus und der Ermordung Hanns Martin Schleyers "die Genickschuss-Sprache der Nazis" übernahm, wie er es formuliert hat. Fischer hat einen Irrtum rechtzeitig erkannt. Das Flugblatt aus dem Hause Aiwanger aber nimmt Bezug auf eine Geschichte, deren Bestialität vor 35 Jahren längst in jeder Hinsicht bekannt war. Damit provokante Späße zu machen war schon 1987 kein Irrtum mehr, sondern nur noch ein Irrwitz.