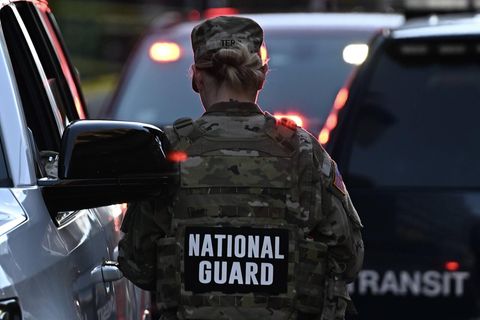Das öffentliche Trauern ist jetzt Chefsache. Der zuständige Ressortchef Karl-Theodor zu Guttenberg - zumindest umgangssprachlich darf er inzwischen, seiner eigenen Logik folgend, Kriegsminister genannt werden - ist aus dem Urlaub im fernen Südafrika herbeigeeilt. Nun folgt ihm auch die Kanzlerin aus dem warmen Gomera ins kühle Niedersachsen. Höchste Betroffenheit ist befohlen.
Es gibt drei weitere Tote unter den deutschen Soldaten im Afghanistankrieg. Und Angela Merkel weiß, dass der Tod eigener Soldaten in Deutschland noch nicht als Normalfall betrachtet wird. Auch wenn in den acht Jahren seit Beginn des Einsatzes nun schon 39 Bundeswehr-Soldaten in Afghanistan gestorben sind.
Als Krieger fühlen sich die Deutschen nach wie vor unwohl. Schießen und Sterben sind für die deutsche Öffentlichkeit keine Routine. Die Mehrheit der Deutschen ist im Frieden groß geworden. Und für diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg noch selbst erlebt haben, ist der Einsatz von Militär vor allem als Weg in eine selbst verschuldete Katastrophe in Erinnerung geblieben. Die politisch gewollte Normalisierung - nämlich den Krieg wieder als Mittel der Politik zu akzeptieren - geht nur sehr schleppend voran. Vor allem deshalb fürchteten sich die Bundesregierungen aller Couleur so lange, den Krieg in Afghanistan auch als solchen zu benennen.
Der Eindruck der Vermeidbarkeit
Um die toten deutschen Soldaten machte die Politik einen großen Bogen. Von einer Friedensmission war die Rede, von einem "Stabilisierungseinsatz". Die Gefallenen existierten zunächst nur als Statistik. Inzwischen werden auch die Namen veröffentlicht. Damit bekommt der Krieg ein Gesicht und dieses Gesicht ist erschreckend. Kanzlerin Angela Merkel jedenfalls ließ sich bislang nur auf einer Ordensverleihung für Soldaten im Afghanistan-Einsatz blicken, Trauerfeiern mied sie. Das fand selbst die sonst so regierungstreue "Bild" unredlich und forderte Merkel diese Woche in großen Lettern auf, nach Selsingen zu fahren. Hastig schob Merkel die Erklärung nach, die Teilnahme an der Trauerfeier sei ihr eine Herzensangelegenheit.
Von Herzensangelegenheiten jedoch war in den letzten Tagen keine Rede. Im Gegenteil: Die Debatte über die drei gefallenen Soldaten zeugt einmal mehr von systematischer Realitätsverdrängung, Verlogenheit und verantwortungsloser Naivität. Denn die täglich artikulierten Forderungen von Ex-Ministern, Talkshow-Generälen und Wehrpolitikern hatten eines gemeinsam: Sie unterstellten die Möglichkeit eines sauberen, für die Nato-Truppen risikolosen Krieges. Da es nun doch wieder Tote in den eigenen Reihen gab, so die verquere Logik, musste irgendetwas falsch gelaufen sein.
Ob mit Klagen über mangelnde Aufklärungsmittel der Bundeswehr, über unzureichende Ausbildung an eingesetzten Fahrzeugen, über fehlende Hubschrauber oder mit dem Ruf nach dem Einsatz schwerer Leopard-2-Panzer in Afghanistan – es geht durchweg darum, den Eindruck zu erwecken, die Opfer wären vermeidbar gewesen.
Auch das Gerede Guttenbergs von einer "heimtückischen Aktion" der Taliban gegen die Bundeswehr zeigt, dass der Krieg offensichtlich nur dann als solcher wahrgenommen werden soll, wenn es hilft, gegnerische Tote zu legitimieren. Der Verteidigungsminister will für sich das Beste beider Welten. Sobald der Krieg deutsche Opfer fordert, ist es irgendwie doch kein richtiger Krieg – und die Kriegsgegner werden wieder zu gewöhnlichen Verbrechern.
Abschied von einem Mythos
Tatsächlich trauert das politische Berlin nicht um drei tote junge Menschen. Betrauert wird der langsame und quälende Abschied von der Illusion, die Kriege der Bundeswehr würden irgendwie anderen Regeln unterliegen als die Kriege anderer Streitkräfte. Vor allem ist der arrogante Anspruch in sich zusammengefallen, die Bundeswehr agiere klüger und sensibler als ihre Verbündeten.
Acht Jahre lang hatten sich deutsche Wehrpolitiker über die vermeintlich rüpelhaften US-Amerikaner in Afghanistan echauffiert. Sich selbst lobte die Regierung gerne für die angeblich großen Erfolge im Norden des Landes. Dann kam der 4. September 2009, an dem ausgerechnet ein deutscher Oberst einen Luftangriff auf eine Menschenmenge bei Kundus anordnete. Der Gutkrieger-Mythos brach endgültig zusammen. Er wird auch nicht mehr zu retten sein. Denn die Bereitschaft, schneller zu bomben und zu schießen, wird zunehmen. Fühlt sich die Bundeswehr durch gezielte Angriffe bedroht, werden im Zweifelsfall, wie am Osterwochenende geschehen, sogar tödliche Schüsse auf verbündete afghanische Soldaten abgegeben.
Das Risiko steigt
Das deutet schon an, dass die neue Nato-Strategie, die auf einen verstärkten zivilen Aufbau abzielt, die Lage der Soldaten nicht verbessern wird. Tatsächlich beschlossen hat der Bundestag im Februar nicht eine Abkehr vom militärischen Vorgehen, sondern eine abermalige Aufstockung der deutschen Truppen in Afghanistan. Und wenn es etwas Neues an der Strategie der Nato und der Bundeswehr gibt, dann ist es der Plan, künftig ein noch viel höheres Risiko einzugehen als bisher. Denn die Ausbildung der afghanischen Armee durch die Bundeswehr – die neuerdings von allen deutschen Befürwortern des Einsatzes als goldener Weg zum Abzug gepriesen wird – soll ja nicht in verbunkerten Schulungsräumen stattfinden, sondern vor Ort: Beim sogenannten "Partnering" werden deutsche und afghanische Soldaten schon bald gemeinsam auf Patrouille durch entlegene Teile des Landes gehen. Also werden sie auch gemeinsam in Gefechten stehen. Das tödliche Bedrohung deutscher Soldaten, die sich bislang praktisch ausschließlich auf Selbstschutz beschränkten, wird erheblich zunehmen. Weitere Tote und Schwerverletzte sind fest einkalkuliert. Wir dürfen gespannt sein, ob die Kanzlerin auch bei diesen Toten jedes Mal an Trauerfeiern teilnimmt. Denn das ist die Lehre dieser Woche: Der Tod deutscher Soldaten ist keine technisch vermeidbare Ausnahme, die durch ein einmaliges öffentliches Gedenken betrauert und vergessen werden kann. Der Tod deutscher Soldaten ist vielmehr die logische Konsequenz des Krieges in Afghanistan. Wer sich weiterhin betroffen darüber zeigt, dass es in einem Krieg tote Soldaten gibt, macht sich lächerlich – und handelt verantwortungslos.
Eric Chauvistré ist der Autor des Buches: "Wir Gutkrieger. Warum die Bundeswehr im Ausland scheitern wird", erschienen im Campus Verlag 2009