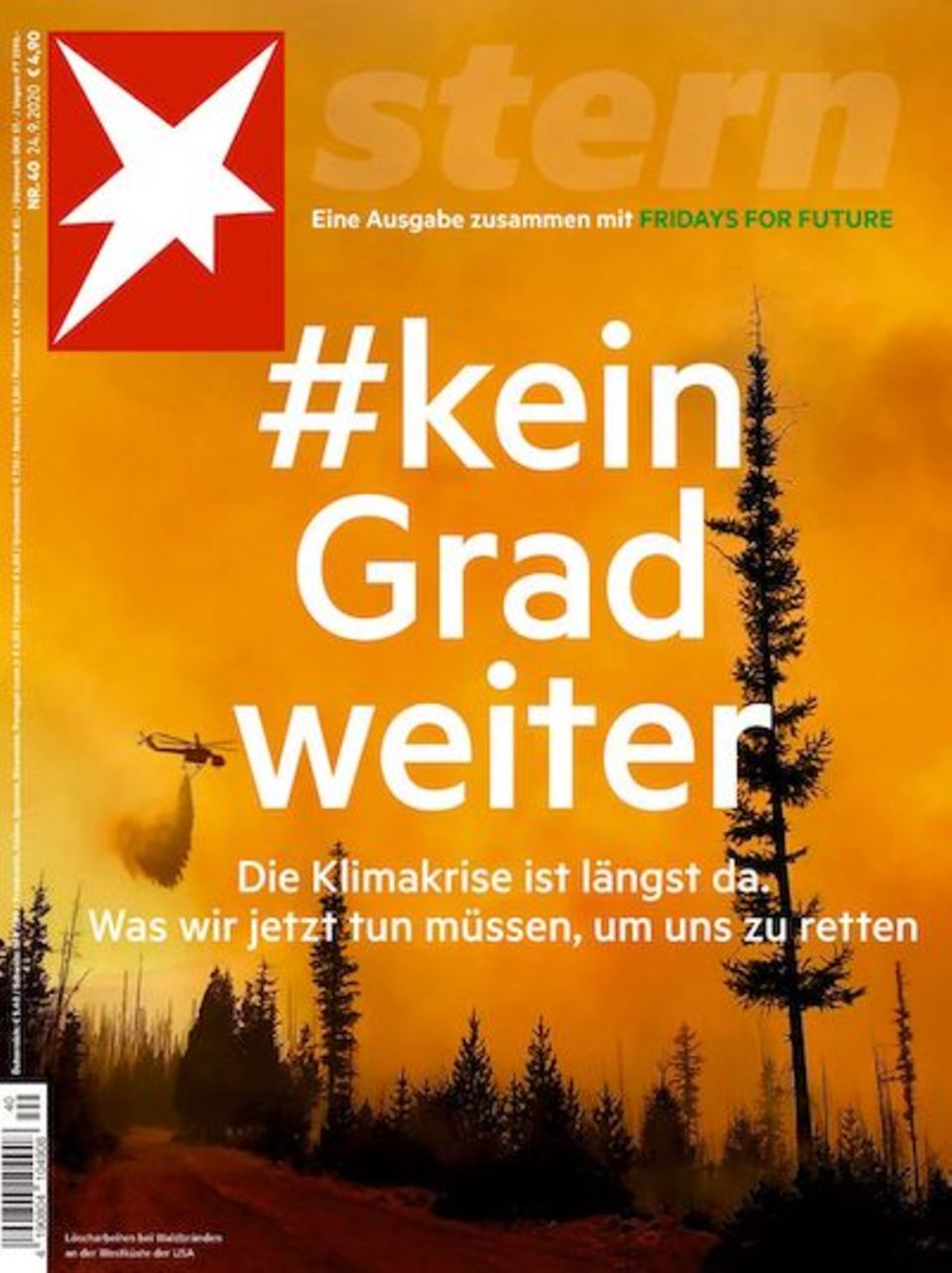Vor ziemlich genau einem Jahr hat Greta Thunberg mit einer kurzen, großen Frage die Öffentlichkeit polarisiert: How dare you – wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr es wagen, die Klimakrise nicht zu stoppen? Wie könnt ihr es wagen, wissentlich so viel Leid von Menschen zuzulassen? Wie könnt ihr es wagen, zu sagen, dass die Kinder eure Hoffnung seien – und nebenbei ihre Zukunft zu zerstören? Und schließlich: Wie könnt ihr es wagen, vor allem diejenigen zu gefährden, die der Bedrohung besonders wenig entgegenzusetzen haben?
Ja, wie eigentlich? Wie können sie es wagen? Und: Wie ändern wir das? Genau darum soll es hier gehen.
Kurz zur Ausgangslage: Mit der Klimakrise hat die Menschheit erstmals ein Problem, dessen Spielregeln von der Physik bestimmt werden. Es ist nicht zu übersehen, dass wir bisher nicht wirklich gut darin sind, uns an physikalische Regeln zu halten. Seit 1990 ist das Wichtigste über die Klimakrise bekannt, und trotzdem wurde in den vergangenen 30 Jahren mehr als die Hälfte der jemals von Menschen verursachten Emissionen ausgestoßen. Wissentlich wurde mehr emittiert als unwissentlich.

An mangelnden Informationen kann es nicht liegen – nein, man wollte nichts ändern, jedenfalls wollten die es nicht, die etwas hätten ändern können. Die Mächtigen waren ohne Willen, die Willigen ohne Macht. Sonst sähe es heute nicht so düster aus. Die Klimakrise ist kein Missgeschick.
Und auch wenn sie den ganzen Planeten betrifft, trifft sie die Menschen keinesfalls in gleicher Art und Weise. Ganz im Gegenteil. Die Klimakrise hat eine globale Ungerechtigkeit produziert, die größer und gewaltiger und komplexer ist als das, was Menschen bisher erlebt oder gar überwunden haben. Sie hat viele verschiedene Facetten, nur einige erschließen sich auf den ersten Blick.
Für junge Menschen in Deutschland zum Beispiel ist die Krise sehr offensichtlich eine ungerechte Angelegenheit. Emissionen, die gestern ausgestoßen wurden, werden in ihrer kumulierten Wirkung morgen Schäden anrichten, die wir, die Jungen, zwar nicht zu verantworten haben, die wir aber zwangsläufig ausbaden müssen. Wir haben dafür eine einfache Rechnung aufgemacht: Zerstört ihr das Klima, zerstört ihr unsere Zukunft, unser Leben, unsere Chancen. Und so wie uns geht es weltweit Hunderten Millionen von jungen Menschen, die im Jahr 2050 noch keine 60 sind und die mit einer Welt zu kämpfen haben werden, die sich maßgeblich von der unterscheiden wird, die man bisher kennt. Damit erklärt sich übrigens auch, warum man Klimaschutz wichtig finden sollte, selbst wenn man kein Öko ist. Eisbären kann man ignorieren, die Zukunft des eigenen Kindes nicht. Wir fordern dementsprechend Klimagerechtigkeit für unsere Generation: Kümmert euch heute, damit wir morgen noch sicher leben können.
Eine Ungerechtigkeit mit vielen Gesichtern
Aber unser Problem ist nicht mal mehr die Spitze des Eisbergs. Denn global betrachtet sind wir die Privilegierten. Der Zufall steht auf unserer Seite. Es ist einfach Glück, dass wir uns noch entscheiden können, ob wir gegen die Klimakrise mobilisieren. Für andere ist sie Alltag. Das, was uns einmal bevorstehen könnte – andere trifft es schon heute. Vor allem die, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. Es gibt nicht nur eine Ungerechtigkeit zwischen den Generationen, sondern auch eine Ungerechtigkeit der Geografie.
Und es geht weiter: Wenn in Deutschland die Sommerregen ausbleiben, Dürren den Landwirten zu schaffen machen, sind es jene Landwirte, die am schlechtesten versichert sind, die am wenigsten Ersparnisse haben, die zuerst ihre Höfe verkaufen, verkleinern, aufgeben müssen. Sie können nichts dafür, dass durch die Klimakrise kein Verlass mehr ist auf die Jahreszeiten – und sind ihr dennoch ausgesetzt.
An anderen Orten der Welt, an denen Frauen hauptverantwortlich dafür sind, Wasser zu organisieren, sind es ebendiese Frauen, die nun längere Wege laufen müssen. Mädchen können nicht mehr in die Schule gehen, weil sie beim Wasserholen helfen müssen. Keines von ihnen trägt Schuld an der Hitze, den Dürren, den trockenen Zeiten, und doch tragen sie, zwangsläufig, die Last. Es ist gut belegt, dass die Klimakrise Frauen mehr trifft als Männer und dass Frauen weniger oft mit am Tisch sitzen, wenn es um Klimaschutz geht. Die Klimakrise ist sexistisch; auch das Geschlecht bestimmt darüber, wie sehr du unter ihr leiden musst.
Dabei fangen die Ungerechtigkeiten schon bei der Entstehung der Klimakrise an – es kann von einer Gleichverteilung der Lasten keine Rede sein. Es ist kein Zufall, dass Kraftwerke und Pipelines häufiger in der Nähe von ärmeren Siedlungen liegen als bei den Häusern der Reichen. Menschen mit wenig Geld können es sich weniger oft leisten, von Luftverschmutzung und lärmenden Kraftwerken wegzuziehen. Zahlreiche Beispiele zeigen auch, dass Öl- und Gasprojekte gezielt in ärmere Gegenden gesetzt werden, weil man dort weniger Widerstand erwartet. In den USA sind das oftmals die Wohnorte von Schwarzen und People of Color. Sie müssen Abgase und kontaminiertes Trinkwasser ertragen. Man spricht von Umweltrassismus, der hier mit der Klimakrise zusammenkommt. Zum Symbol dafür wurde die Stadt Flint mit ihren rund 100.000 überwiegend schwarzen Einwohnern, die unwissentlich mit Blei belastetes Wasser getrunken haben.
Nur wenige stehen auf der Gewinnerseite
Klimaungerechtigkeit heißt: Arme sind mehr betroffen als Reiche, Frauen mehr als Männer, Schwarze mehr als Weiße, Menschen im globalen Süden mehr als Menschen im globalen Norden, die Generation der Jungen mehr als die der Alten. Für eine junge, schwarze Frau in Uganda wie unsere Freundin Hilda, die auch in diesem Heft zu Wort kommt, kommen verschiedene Facetten der Ungerechtigkeit zusammen.
Und wer steht auf der Gewinnerseite? Wenn 71 Prozent der Emissionen von 100 Unternehmen verursacht werden, wird schnell deutlich, wie es hier um die Gerechtigkeit bestellt ist. Zwar wurden und werden durch die massive Förderung von Kohle, Öl und Gas weltweit Wirtschaften befeuert, wird Wohlstand erarbeitet. Aber es entstehen eben auch massive Schäden – für die all jene Unternehmen, welche die fossilen Rohstoffe verfeuern, nicht aufkommen müssen. In Deutschland hat die Braunkohleförderung im Jahr 2015 Schäden von etwa 15 Milliarden Euro angerichtet. In keiner anderen Branche werden die betriebsbedingten Kosten so selbstverständlich an die Gesellschaft ausgelagert. Die Rechnung geht etwa so: Je weiter du von einer Position als CEO eines dreckigen Unternehmens entfernt bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du überproportional viel für die Umweltschäden dieses Unternehmens bezahlen musst – etwa durch Steuern, die in Klimaschutzmaßnahmen fließen.
Die Ungerechtigkeiten, die durch die Klimakrise verursacht werden, sind so vielfältig und haben eine so ungeheure Dimension, dass sie kaum zu überblicken sind. Man kann sich die Dimensionen an produziertem Leid in ihrer Gänze nicht vorstellen. Dennoch merken immer mehr Menschen: Es stimmt etwas nicht. Man ahnt, wie unverschämt gut es einem geht im Vergleich zu den vielen, die rein zufällig mit einer anderen Hautfarbe in einem anderen Teil der Welt geboren sind. Man ahnt, dass man nicht erklären kann, warum das so ist. Noch viel weniger kann man erklären, warum die vielen vergleichsweise Privilegierten aus den reichen Regionen und Ländern das alles zulassen.
Handeln statt zu verdrängen
In einer Krise, von der wir wissen, dass alles immer schneller immer schlimmer wird, wenn man weitermacht wie bisher, ist es schwer, sich nicht ununterbrochen schuldig zu fühlen. Weil das aber kaum auszuhalten wäre, wird verdrängt. Man sucht andere, die noch mehr tun könnten oder müssten als man selbst ("Das müssen die in der Politik machen"), man überträgt den Leidtragenden die Verantwortung ("Toll, Kinder, geht mal alle in die Politik und regelt die Dinge selbst"), man relativiert das Leid ("Ihr habt so viele Möglichkeiten, was beschwert ihr euch jetzt über das Klima?"). Man erklärt, das Problem sei zu groß. Denn wo soll man da anfangen? Bei den Kindern in Deutschland, bei den Geflüchteten aus Nordafrika, bei den Inselbewohner*innen im Pazifik, bei den Indigenen in Nordamerika?
Es ist einfach und vielleicht sogar logisch, intuitiv diese großen Ungerechtigkeiten von sich wegzuschieben. Die Frage aber, wie man die Probleme je in den Griff kriegen soll, lässt sich so nicht beantworten. Nur, wie kommt man über Generationen, soziale Hintergründe, Hautfarben und Weltregionen hinweg zusammen, wenn man sich kaum in die Augen schauen kann, weil die einen unverdiente Privilegien haben, die anderen unverschuldetes Leid? Und ein Zusammenkommen, so viel ist gewiss, braucht es. Von "How dare you?" müssen wir kommen zu "How did we – change this?".
Der wichtigste Schritt hin zu einer klimagerechten Welt ist leicht: Wir müssen einen Zustand erreichen, in dem wir alle wieder in der Lage sind, uns in die Augen zu schauen. In dem wir uns nicht lähmen lassen von der Schwere der Ungerechtigkeiten, sondern füreinander einstehen – wo und wie auch immer wir es können. Das beschreibt das Ende der toxischen Gleichgültigkeit.
Aufrichtig, selbstbewusst, weltbewusst. Erst, wenn wir unsere Energie nicht mehr für Ausreden verwenden, sondern für Reden, wenn wir hinschauen, statt auszuweichen, wenn wir Verantwortung ernst nehmen, statt sie von uns zu schieben – erst dann sind wir in der Lage, es mit der physikalischen Realität aufzunehmen. Klimagerechtigkeit ist auch der Grundstein einer demokratischen Gesellschaft, einer demokratischen Weltgemeinschaft. Auch dafür kämpfen wir.