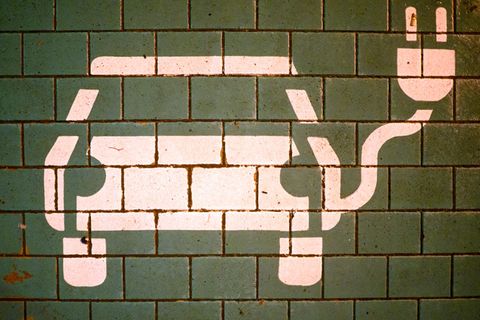Die Zukunft des Automobils offenbart sich im Museum. Genauer: im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart-Cannstatt. Die Ausstellung beginnt mit dem ersten motorisierten Dreirad von Carl Benz. Am 29. Januar 1886 meldete er seine Erfindung beim Kaiserlichen Patentamt an. Das Dokument mit der Nummer 37435 gilt als Geburtsurkunde des Automobils. Die Schau zeigt jeden Entwicklungsschritt bis zum letzten Höhepunkt: dem OM 654. Es ist der neuste Motor aus dem Mercedes-Labor; der vermutlich sauberste Dieselmotor, der jemals gebaut wurde.
Fünf Jahre hat sich der Konzern für die Entwicklung des OM 654 Zeit gelassen und dabei 2,6 Milliarden Euro ausgegeben. Die Manager hoffen, die Investition in eine 130 Jahre alte Technologie möge sich noch einmal rentieren. Ein letztes Mal, denn das Unternehmen wird nicht noch einmal Milliarden für einen Verbrennungsmotor ausgeben. Die immer strengeren Abgaswerte in den USA, in Europa und vor allen Dingen in China sind nur elektrisch zu erreichen. "Bis 2025 rechnen wir mit bis zu 25 Prozent Elektroanteil in unserer Produktion", sagt Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius, der Kronprinz von Daimler-Chef Dieter Zetsche.
Der letzte seiner Art
Im Klartext heißt das: Mercedes wird keinen Verbrennungsmotor mehr komplett neu entwickeln. Der OM 654 ist ein Dinosaurier auf der höchsten Entwicklungsstufe. Darum ist das Museum der passende Ort für Verbrenner, es zeigt den ersten und den letzten. Der Kreis schließt sich. Die Geschichte des Verbrennungsmotors ist abgeschlossen.
Keine andere Erfindung hat Deutschland so geprägt. Seit 130 Jahren ist der Motor die Grundlage des gesamten Wohlstands dieses Landes. Nicht nur die eine Million Beschäftigten der deutschen Autoindustrie, die gesamte Volkswirtschaft lebt vom Verbrennungsmotor. Ohne ihn gäbe es kein "Made in Germany" und keinen Exportweltmeister Deutschland. Nun endet das Zeitalter der deutschen Maschine. In den kommenden Jahren entscheidet sich die Zukunft von Autoherstellern, Zulieferbetrieben und Millionen Arbeitnehmern.
Abgase bedeuten das Aus
Die Abgase drehen Diesel und Benzinern die Luft ab. Ausgerechnet in Stuttgart, der Heimat des Verbrenners, sind für diesen Sommer die ersten Diesel-Fahrverbote angekündigt, München, Düsseldorf und Hamburg könnten bald folgen. In 80 deutschen Städten übersteigt die Schadstoffbelastung der Atemluft die gesetzlichen Grenzwerte teilweise um das Doppelte. Nicht hin und wieder, sondern im Schnitt. Rund 60 Prozent der Deutschen befürwortet darum zeitweilige Fahrverbote in den Städten. Die Verwaltungen blieben bislang weitgehend untätig, doch jetzt zwingen Gerichtsurteile sie zum Handeln. In unzähligen Rathäusern werden nun Pläne für Fahrverbote ausgearbeitet. Schon sehr bald trifft es die alten Diesel, ganz am Ende auch die jungen Benziner. Geht es nach den Grünen, werden ab 2030 generell keine Autos mit Auspuff mehr neu zugelassen.
Die Zukunft ist elektrisch.
Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Wissenschaftler, Ingenieure, Naturschützer und viele Politiker sind schon seit Jahren davon überzeugt. Aber nicht die Manager der Automobilindustrie. Mit ganzer Macht verteidigten sie ihr altes Produkt, solange es ging. Doch die globale Realität ist stärker. Nicht nur in Deutschland, auch in Paris, Peking, Delhi oder Mexico-City ringen die Menschen nach Luft und wehren sich gegen den gelben Nebel. Der Abgasskandal "Dieselgate" ist nur der letzte Anlass, der die Bosse zum Umdenken gezwungen hat. Oder entmachtet, wie den langjährigen VW-Autokraten Martin Winterkorn, Deutschlands mächtigsten Bremser der E-Autos.
Sein Nachfolger, Matthias Müller, hat das Steuer herumgerissen und für das Jahr 2025 angekündigt, "dass wir dann zwei bis drei Millionen vollelektrische Fahrzeuge verkaufen werden". Das wäre jeder dritte VW, Audi, Škoda oder Seat. In acht Jahren. Mercedes hat kürzlich seine gesamte Produktion einem Stresstest unterzogen, um herauszufinden, was passiert, wenn man plötzlich die Hälfte aller Fahrzeuge mit Elektroantrieb bauen müsste. Die Stuttgarter halten das für ein denkbares Szenario. In den kommenden vier Jahren werden insgesamt 170 neue E-Modelle auf den Markt kommen. Die Frage ist nicht mehr, ob es eine Autowende geben wird, sondern lediglich, wie lange es dauert, bis sie vollzogen ist. Wann sie beginnt, ist bereits klar: genau jetzt.
China verschärft das Tempo
Die Vorbehalte deutscher Kunden gegen Elektroautos sind für die heimische Industrie keine Überlebensfrage. Rund 90 Prozent all ihrer Fahrzeuge werden im Ausland verkauft. Über die Zukunft der Mobilität wird in China entschieden. Schon heute ist der chinesische Markt siebenmal größer als der deutsche. Und die Staatslenker haben entschieden: Die Elektromobilität wird mit der Durchsetzungskraft einer gelenkten Wirtschaft ausgebaut. Gleichzeitig werden Motoren, die Abgase erzeugen, mit derselben Entschlossenheit bekämpft. Bis 2023 verschärfen sich die Abgasgrenzwerte brutal, sie können allenfalls mit aufwendiger Technik eingehalten werden. Das wird teuer. Autos ohne E-Motor sind bald auf dem weltgrößten Fahrzeugmarkt praktisch unverkäuflich. "Durch die bereits beschlossene Gesetzgebung kommt man in China in den nächsten Jahren nicht um die Elektrifizierung herum", sagt Ola Källenius von Daimler.
Für die deutsche Volkswirtschaft bedeutet das eine revolutionsartige Umwälzung. Elektromobilität heißt nicht: Unter der Motorhaube arbeitet ein batteriegetriebener Motor, ansonsten bleibt alles wie gehabt. Die Autowende wird das ganze Land so radikal verändern wie einst das Ende des Steinkohlebergbaus das Ruhrgebiet. "Mobilität wird gerade neu definiert" , sagt VW-Chef Müller. "Der bevorstehende Umbruch in der Industrie hat das Potenzial, selbst große Konzerne zu gefährden", warnt der Strategie-Chef eines Autoherstellers.

Menetekel Energieversorger
Das Schicksal der Energieversorger ist den Autobauern eine Warnung. Über Jahrzehnte waren das uneinnehmbare Festungen. Dann haben die Manager den Wandel zu erneuerbarer Energie zuerst verschlafen und dann bekämpft. Doch der Fortschritt ließ sich nicht aufhalten. RWE und Eon schrieben Milliardenverluste und wurden in verschiedene Unternehmen aufgespalten. Droht den Autoherstellern ein ähnliches Schicksal?
An dieser Frage entscheidet sich die Zukunft von Gina Hundelmann und Matthias Fritsche. Beide sind 26 Jahre alt, beide arbeiten im VW-Werk in Salzgitter, beide bauen gerade ein Haus. Hundelmann zieht bald ein, bei Fritsche dauert es etwas länger. Das eigene Haus mit Mitte 20, das ist hier ganz normal. Ein Job bei VW, was soll da schiefgehen?
Wer baut die Motoren?
Das Werk in Salzgitter ist das größte Motorenwerk Deutschlands, das zweitgrößte der Welt. Hundelmann und Fritsche bauen den 2-Liter-Turbodiesel zusammen, für den Golf, den Passat und den Tiguan. Alle 41 Sekunden schiebt das Fließband einen neuen, silbernen Motorblock vor Gina Hundelmann. Heute schraubt sie den Ölfilter an. Nach 41 Sekunden sind fünf Schrauben fest. Der Motor ruckelt weiter zu Matthias Fritsche. Der bringt ein Hitzeschutzblech an und den Stutzen für das Kühlwasser. 41 Sekunden, weiter geht’s.
Das Motorenwerk beschäftigt 7500 Arbeitnehmer und ernährt eine ganze Region. Wie lange werden die Motoren aus Salzgitter noch gebraucht? "Ich will hier bis zur Rente bleiben", sagt Gina Hundelmann. Und schiebt trotzig nach: "Wir werden genug Arbeit haben." Matthias Fritsche hat da Zweifel. Er macht zwar dieselbe Arbeit wie alle Kollegen am Band, aber er ist ein Leiharbeiter mit Zeitvertrag. Von einem Arbeitsplatzabbau wäre er zuerst betroffen. Seine Hoffnungen beruhen auf seiner Ausbildung: Er ist Elektrotechniker. "Ich kann auch Batterien bauen", sagt er.
Wenn Wissen wertlos wird
VW-Chef Müller hat angekündigt, in Salzgitter ein Forschungsprojekt zur Entwicklung neuer Batterietechnik zu starten. Doch ob die Zellen in Salzgitter gefertigt werden, ist noch unklar. Batterien sind schwer, die Transportkosten hoch. Müller überlegt, "ob wir die Fertigmontage nicht dorthin verlagern, wo die Autos gebaut werden".
Andreas Blechner kämpft für ein Batteriewerk in Salzgitter, er ist Betriebsratsvorsitzender des größten deutschen Motorenwerks. "Wir werden hier noch eine ganze Zeit lang Motoren bauen", sagt er, "aber es werden weniger – und der Rückgang beschleunigt sich."
In einem "Zukunftspakt" hat der VW-Vorstand mit dem Konzernbetriebsrat den Abbau von mindestens 20 000 Stellen in Deutschland vereinbart. Blechner weiß: Salzgitter wird es dabei hart treffen. Ein Batteriewerk könnte den Arbeitsplatzverlust nur zu einem kleinen Teil kompensieren. Batterien werden in sogenannten Reinräumen produziert, in denen etwa Temperatur und Luftdruck konstant gehalten werden. Menschen stören da nur. "Die neue Mobilität sorgt für deutlich weniger Arbeitsplätze" , sagt Blechner. Für die Produktion braucht man nur ein Siebtel der Mitarbeiter.

Sozialverträglicher Abbau
Große Konzerne können solche Umwälzungen sozialverträglich gestalten. Einigermaßen. Die deutsche Automobilindustrie besteht jedoch aus einem Netz mittelständischer Betriebe, die einen Großteil der Komponenten zuliefern. Darunter sind viele hoch spezialisierte Weltmarktführer, die Pleuelstangen oder Ventile herstellen. Sie sind der Stolz der deutschen Wirtschaft. Ihr Kapital ist ihr Know-how. In der E-Mobilität ist dieses Kapital wertlos.
In einem E-Mobil sind nicht lediglich einzelne Teile überflüssig, sondern: die Abgasanlage, der Kühler, das Kraftstoffsystem, das Getriebe und natürlich der Motorblock selbst. Allein bei den Autoherstellern und bei den vier größten Zulieferern arbeiten rund 750 000 Menschen in der Fertigung (siehe Karte Seite 65). Hinzu kommen etwa 300 000 Beschäftigte bei kleinen und mittelgroßen Zulieferern. Nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts hängt also gut eine Million Arbeitsplätze an der Produktion von Benzinern oder Dieselfahrzeugen. Alle Standorte und alle Beschäftigten sind von der Autowende unmittelbar betroffen. In den kommenden zwei Jahrzehnten werden nicht Tausende, nicht Zehntausende, sondern eher Hunderttausende Arbeitsplätze wegfallen.
Im besten Fall. Denn dieses Szenario geht davon aus, dass die heimische Industrie auch in Zukunft so viele Fahrzeuge bauen und verkaufen wird wie heute. Doch das ist nur eine Hoffnung. Beim Verbrennungsmotor hatte Deutschland einen Vorsprung. Ins Rennen um die Elektromobilität geht das Land mit gehörigem Rückstand.
Der Markt lockt Neulinge
Bei den Luxus-Elektroautos hat der kalifornische Hersteller Tesla bereits die Marktführerschaft erobert. Bei den batteriegetriebenen Kleinwagen rangeln Renault und Nissan in Europa um Platz eins. Die gefährlichste Konkurrenz ist jedoch die chinesische Industrie. Dort produzieren bereits Dutzende Unternehmen Elektromodelle. Nicht alle genügen internationalen Standards. Aber einige schon. Verglichen mit Verbrennern ist ein Elektromotor eine simple Maschine. Inzwischen haben sogar einige Branchenneulinge alltagstaugliche Elektroautos entwickelt.
Die Fahrzeuge müssen jedoch nicht nur entwickelt, sondern auch hergestellt werden, millionenfach, in gleichbleibender Qualität – ein hochkomplexer Vorgang, der viel Erfahrung erfordert. Das muss augenblicklich auch Tesla lernen. Bislang hat das Unternehmen nur in kleiner Stückzahl gebaut und dabei keinen Cent Gewinn gemacht. Um Geld zu verdienen, will es nun in die Massenproduktion einsteigen. Doch da hakt es. Die Auslieferung musste verschoben werden. Autos entwickeln können die Kalifornier. Autos bauen und dabei Geld verdienen, das müssen sie mühsam lernen.
Genau das, Massenfertigung in höchster Qualität, ist die Stärke des Standorts Deutschland. Hersteller und Zulieferer sind aufeinander eingespielt. Die meisten der etwa 100 000 Ingenieure konstruieren gar keine neuen Fahrzeuge. Sie entwickeln Lösungen für deren Fertigung. Womöglich kann die deutsche Autoindustrie dank ihrer alten Stärke den Rückstand noch aufholen. Vielleicht lassen sich so Arbeitsplätze retten. Einige zumindest.
Die Revolution bleibt aber nicht auf die Fabriken begrenzt. Wer heute ein Autohaus besucht, dem wird es schwerfallen, den Händler zum Verkauf eines der neuen E-Modelle zu überreden. "Für uns ist das ein ganz problematisches Produkt" , sagt der Geschäftsführer eines der größten deutschen Autohäuser. Er will nicht, dass sein Name genannt wird. "Aus Rücksicht vor meinen Mitarbeitern. Die Wahrheit ist so brutal, die sollen sie nicht aus dem stern erfahren."
Kaum Service notwendig
Autohäuser leben nicht nur vom Verkauf der Pkws, sondern auch von deren Wartung und Reparatur. "Bei Elektroautos ist das eine ganz schmale Nummer: Software-Update, Scheibenwischer, Reifenwechsel, mehr ist da nicht zu machen", sagt der Händler. Um Ölwechsel, Keilriemen, Zündung oder Auspuff muss sich keine Werkstatt kümmern. Bremsbeläge sind manchmal nur alle 200 000 Kilometer dran, weil ein E-Mobil vorwiegend mit dem Motor bremst, um die Batterie zu laden. "Ohne die Einnahmen aus der Werkstatt kann ich den Laden dichtmachen", sagt der Händler. Bei Tesla ist das heute schon so: Probesitzen in einem Showroom in der Innenstadt, gekauft wird meistens online. Autohäuser mit Service und Werkstatt kennen die Kalifornier nicht.
Etwa 70 000 Menschen verkaufen in Deutschland von Beruf Autos. Rund 390 000 machen sich die Finger in den Werkstätten schmutzig. "Davon wird eine ganze Menge wegfallen", prophezeit der Geschäftsführer. "Ich würde heute niemandem mehr raten, Kfz-Mechatroniker zu werden." Nicht nur viele Werkstätten werden verschwinden, auch die meisten der rund 14 500 Tankstellen mit ihren 100 000 Mitarbeitern werden in der neuen Zeit nicht mehr gebraucht.
Statt Autos Mobilität verkaufen
Viel Zeit für eine sanfte Umstellung wird der deutschen Wirtschaft nicht gewährt. Mächtige Mitspieler drücken aufs Tempo. Da sind zuerst die Ingenieure und Entwickler. Die Fortschrittskurve in der Akku-Technik ist ähnlich steil wie in der Kommunikationstechnik vor der Jahrtausendwende. Das Kapital, das für die Entwicklung der Batterietechnik sowie für den Ausbau der Lade-Infrastruktur gebraucht wird, ist ein weiterer Beschleunigungsfaktor. Elektromobilität entwickelt sich gerade zum Darling der größten Anlagefonds. Der dritte Motor der Autowende ist die Energiewende. Strom aus Windrädern und Sonnenkollektoren hat einen Nachteil: Er kann bislang nicht gespeichert werden. Millionen Autobatterien werden künftig zum Speicher der Energie. Die notwendigen intelligenten Systeme sind längst entwickelt.
Die neue Welt der Mobilität wird nicht nur von der Elektrifizierung vorangetrieben, sondern auch vom Carsharing und vom autonomen Fahren. Diese drei Veränderungen beschleunigen sich gegenseitig. Auf der ganzen Welt arbeiten die besten Entwickler an Systemen für autonomes Fahren. Auch Google und Apple investieren viele Milliarden und die Ideen ihrer genialsten Köpfe in die neue Mobilität. "Ich habe lange nicht geglaubt, dass das bald serienreif ist", gesteht VW-Chef Müller. "Aber inzwischen habe ich nicht den geringsten Zweifel daran, dass diese revolutionäre Technologie innerhalb weniger Jahre zur Realität wird."
Die neue Mobilität wird das Leben so schnell und so intensiv verändern wie zuvor das Internet, durch das in nur einem Jahrzehnt vollkommen neue Branchen und neue Giganten der Weltwirtschaft entstanden sind. Dieses Potenzial birgt auch die Autowende. Derzeit schließen Nahverkehrs-, Bahn-, Mietwagen- und Carsharingfirmen Kooperationen und bieten ihre Dienste im Paket an. Bald werden wohl auch die Airlines dabei sein. Neue Anbieter entstehen: Mobilitäts-Provider.
Ende des Schmutzzeitalters
Welche Unternehmen werden das sein? Autohersteller? Oder Stromkonzerne, die Bahn, Apple, Google, Banken, Investoren aus China? Vielleicht auch Unternehmen, die es jetzt noch gar nicht gibt.
Jugendliche können sich heute kaum vorstellen, unter welch primitiven Bedingungen ihre Eltern einmal kommunizieren mussten: ohne Smartphone, über Telefone mit Wählscheibe im Flur. In 20 Jahren werden sie ihren staunenden Kindern erzählen, wie sie selbst sich fortbewegten: Es gab zwar schon Autos, aber die musste man selbst steuern. Um sie in Bewegung zu setzen, musste der Motor gewaltige Mengen Öl verbrennen. Das machte einen Höllenlärm, und aus einem Rohr am Heck wurde giftiger Qualm in die Luft geblasen. Auf diese Dreckschleudern waren die Eltern auch noch stolz. Und das sollen die Kinder glauben.