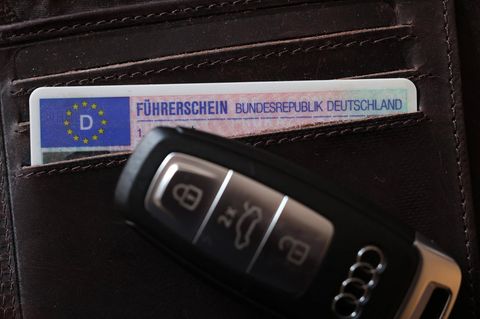Wer den gebürtigen Schweizer Robert "Bob" Lutz je erlebt hat, wird ihn wohl kaum vergessen. Fast zwei Meter groß, gutaussehend, volles Haar (inzwischen silbern), oft eine dicke Zigarre qualmend und gelegentlich bei offiziellen Terminen Cowboy-Stiefel tragend. Sein prägnantestes Merkmal aber ist die Neigung zu deutlichen Worten zusammen mit einem dröhnenden Lachen - gerne auf Kosten anderer.
Jetzt hat der inzwischen 82-jährige ehemalige Top-Manager mit einem Buch über das Gehabe von Vorständen zugeschlagen. In deftigen Worten. Das Buch trägt den Titel "Idole und Idioten: Haarsträubende Erlebnisse auf der Chefetage".
Lutz, der selbst Jahrzehnte in den Vorstandsetagen von General Motors, BMW, Ford, Chrysler und am Ende seiner Karriere wieder bei General Motors die Geschicke der Konzerne mitbestimmte, schildert seine Erlebnisse mit zehn ehemaligen Chefs. Die meisten entzaubert er. Süffig plaudert er aus dem Nähkästchen, wie nach heftigem Hickhack der Verantwortlichen dann häufig weitreichende (Fehl)Entscheidungen getroffen wurden. Und auch, dass die vermeintlich allmächtigen Bosse oft hauptsächlich damit beschäftigt waren, ihre Eitelkeiten auszuleben und Schrullen zu pflegen, statt ihre Multi-Millionen-Jobs zu machen.
Bob Lutz "Idole und Idioten: Haarsträubende Erlebnisse auf der Chefetage" (Campus, 24,99 Euro)
Bechern bis zur Bewusstlosigkeit
Zum Beispiel Ralph Mason, von 1966 bis 1970 Chef der GM-Tochter Opel, der offenbar stets ziemlich benebelt war. Lutz nennt ihn einen "kapitalen Alkoholiker". Als Beleg dafür schildert er den Verlauf eines Geschäftsessens Masons mit deutschen Opelhändlern, "bei dem sich Ralph bis zu Besinnungslosigkeit betrank. Zwei meiner kräftigeren Bezirksleiter aus meiner Vertriebsmannschaft mussten ihn in den Hotelaufzug schleppen, während die Kappen seiner teuren Budapester-Schuhe über den Steinboden schrappten."
Dass Mason der Trunksucht verfallen war, macht Lutz auch an einem anderen Punkt fest. Mason verließ nämlich stets um 16 Uhr das Unternehmen in Rüsselsheim mit dem Hinweis: "Ich muss los meine Herren, hab' noch einen wichtigen Termin in der Stadt." Der entpuppte sich als Treffen mit Masons Ehefrau Rina in der damals angesagten Frankfurter Bar "New Jimmy’s". Dort wurde bis an die Grenze der Bewusstlosigkeit gebechert. Lutz: "Hier betranken sich Ralph und Rina jeden Abend hoffnungslos, wurden dann heimgefahren und von ihrem Chauffeur und den Wachleuten ins Haus verfrachtet."
Die unzähligen Gelage des Ehepaars Mason in der Bar endeten schließlich nach einem Eklat wegen der angeblich gestohlenen Handtasche von Rina Mason. Die jedoch hatte sie bloß verlegt und im Vollsuff nicht mehr gefunden. Daraufhin erteilte der Barbesitzer den beiden Amerikanern Lokalverbot. Irgendwann war Mason wegen seiner Eskapaden nicht mehr haltbar und wurde auf den repräsentativen Posten des Chairman GM Europe mit Sitz in London "befördert" - dem Sonnenuntergang entgegen, wie solche Versetzungen laut Lutz bei GM genannt wurden.
Eine delikate Mission bei Daimler
Von ganz anderem Schlag und stets besonders klar im Kopf war nach Lutz' Einschätzung Freiherr Eberhard von Kuenheim, der legendäre Boss von BMW, dort von 1970 bis 1993 im Amt. Kuenheim deckte gleich zu Anfang seiner Karriere einen gigantischen internen Betrug des damaligen BMW-Verkaufschefs Paul Hahnemann auf, von dem nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Hahnemann hatte mit Hilfe einer willfährigen Werbeagentur und fingierten Rechnungen für nie erbrachte Leistungen Millionen Mark auf sein Konto umleiten lassen. Geschickt verstand es BMW, den Millionen-Beschiss als verlorenen Machtkampf von Hahnemann darzustellen. Denn der wollte anstelle von Eberhard von Kuenheim selbst BMW-Chef werden, was nicht gelang und weswegen er bitter enttäuscht angeblich seinen Rücktritt erklärt habe.
Dass es wohl ganz anders war, deckte Bob Lutz jetzt in seinem Buch auf. Man einigte sich einvernehmlich darauf, dass Hahnemann das Unternehmen geräuschlos verlässt. Lutz wurde von General Motors abgeworben und Hahnemanns Nachfolger. Lutz: "Man durfte sich vom Dauerlächeln, vom jungenhaften Auftreten, von der leisen Stimme und der kultivierten Sprache des jungen Freiherrn nicht täuschen lassen. Er war gerissen und knallhart."
Als wäre es gestern gewesen, erinnert sich Lutz präzise an eine Fahrt mit Kuenheim von München nach Stuttgart zum Daimler-Boss Joachim Zahn. Eine delikate Mission, wie sich herausstellen sollte. Kaum hatte man in Zahns Büro Platz genommen und am gereichten Kaffee genippt, wedelte der aufgebrachte Daimler-Chef mit einem mehrseitigen Dossier, auf dem das avantgardistische Flügeltüren-Turbocoupé zu sehen war, das BMW aus Anlass der Olympischen Spiele 1972 in München vorgestellt hatte. "Das ist ein Unding! Ein Unding!", erregte sich Zahn Lutz zufolge. Und weiter: "BMW hat kein Recht, ein Flügeltürenmodell zu präsentieren! Das haben wir bereits getan mit unserem großartigen Prototypen C111! Das können Sie nicht machen!"
Auf die Frage, ob Mercedes ein Patent oder ein Urheberrecht auf das Design verfüge, entgegnete Zahn barsch: "Das tut nichts zur Sache! BMW hat kein Recht, Mercedes zu kopieren! Herr von Kuenheim, das muss aufhören! Außerdem verkauft Herr Lutz auch viel zu viele große Sechszylinder-Limousinen und -Coupés. Auch das muss aufhören. Sechszylinder sind unsere Spezialität. Sie produzieren gute Vierzylinder. Konzentrieren Sie sich darauf." Lutz glaubte, nicht recht gehört zu haben. Der größte Rivale forderte BMW unverblümt zur illegalen Aufteilung des Marktes auf. Und was von Kuenheim Zahn geantwortet hat, auch das verblüffte Lutz: "Herr Dr. Zahn, gute Beziehungen zwischen unseren Unternehmen sind für uns beide von größter Bedeutung und wir werden nichts tun, was diese belasten könnte."
Auf der Rückfahrt nach München zeigte sich jedoch, das Kuenheims Äußerung eine hohle Höflichkeitsfloskel war. Denn der BMW-Chef sagte zu seinem noch immer konsternierten Vertriebsvorstand: "Was die Sechszylinder angeht, treiben Sie das Geschäft ruhig weiter voran." Das taktische und strategische Geschick von Kuenheims hat Lutz imponiert, wenngleich die beiden bei vielen modellpolitischen Themen oft über Kreuz waren.
Eine Reisetasche voller Marmeladengläschen
Fielen Lutz an der Person Kuenheim das manierierte und arrogante Gehabe auf, waren es am ehemaligen Ford-Boss Philipp Caldwell vor allem drei ausgeprägte Macken. Erstens störte er sich an nicht gleichlangen Schnürsenkeln an Schuhen. Zweitens war er Abstinenzler und trank immer nur britisches Wasser der Marke Malvern Water, das auch auf längeren Dienstreisen mit dem Firmenjet mitgeführt werden musste. Gelegentlich kam es vor, dass Caldwell alle Flaschen rasch geleert hatte und sein Wasser-Favorit nirgends aufzutreiben war. Wie es dann weiterging, schildert in Lutz' Buch eine Flugbegleiterin: "Als sie leer waren, haben wir sie mit irgendwas aufgefüllt."
Und der dritte Spleen schließlich war einer, der einen die Stirn runzeln lässt. Eines Tages war Caldwell auf Deutschlandtour bei Ford in Köln, wo Bob Lutz zu dem Zeitpunkt Chef war. Großzügig gab der seinen Chauffeur an Caldwell ab. Als der große Boss aus Amerika nach einem mehrtätigen Besuch wieder weg war, zog der Chauffeur Lutz ins Vertrauen und erzählte ihm eine putzige Geschichte: Er musste eine schwere, verschlossene Tasche, die er beim Chef des Hotels abgeholt hatte, in dem Caldwell abgestiegen war, dem Piloten des Firmenjets am Flughafen Köln/Bonn aushändigen. Der kannte das Ritual offenbar schon und machte keine Anstalten, die Tasche sofort ins Flugzeug zu bringen. Das mahnte der Fahrer mit den Worten an: "Wir dürfen sie doch nicht irgendwo abstellen." Darauf der Pilot: "Du meine Güte, ich zeige Ihnen mal, was in der verflixten Tasche ist." Er riss den Reisverschluss auf, zum Vorschein kamen Dutzende kleine Marmeladengläschen, wie sie in europäischen Hotels zum Frühstück gereicht werden.