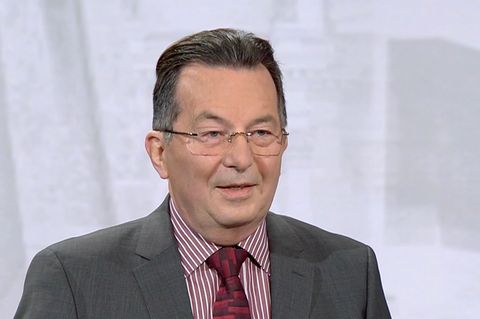Als Putin im Februar 2022 die Ukraine überfiel, sah es ein paar Tage lang aus, als könnte die russische Kriegsmaschine Kiew zermalmen. Doch dann hielten die ukrainischen Soldaten die Invasoren auf. Diese erlitten massive Verluste und mussten einen großen Teil ihrer Eroberungen aufgeben.
Danach atmete man im Westen auf. Viele waren überzeugt, der russischen Kriegsmaschine werde die Puste ausgehen. Die russische Volkswirtschaft galt als klein und wenig leistungsfähig. Mehrere Wellen von Sanktionen sollten Russland vom Weltmarkt abschneiden, finanziell und technisch. Der Westen wollte den Import von Halbleitern verhindern. In wenigen Wochen würden Putin dann Jets, Lenkwaffen und moderne Panzer fehlen.
Russland in einer Art Kriegswirtschaft
Das ist nicht eingetreten. Der Westen hatte den Rest der Welt vergessen, der sich den Sanktionen nicht anschloss. Russland konnte seine Rüstungsproduktion steigern, während der Westen sich von einer Friedensproduktion mit kleinen Kapazitäten bis heute kaum verabschiedet hat. In kurzer Zeit ist Russland dagegen in eine Art von Kriegswirtschaft eingetreten. Mit der Folge, dass sich die Produktion in allen Rüstungsbereichen deutlich erhöht hat. Dazu wurden neue Werke aus dem Boden gestampft, die heute große Mengen an Drohnen jeder Art herstellen.
Das augenfälligste Beispiel ist die Artilleriemunition. Die EU hat Kiew die Lieferung von einer Million Granaten innerhalb eines Jahres zugesichert, wird und dieses Ziel aber weit verfehlen: Bis Ende Oktober wurden nur 300.000 Stück geliefert. Davon stammen die meisten aber nicht aus der aktuellen Produktion, sondern aus Lagerbeständen. Derzeit herrscht an vielen Frontabschnitten ein eklatanter Mangel. Russland hingegen gelingt es, seine Neuproduktion von Granaten auf zwei Millionen Stück im Jahr zu steigern. Dazu kann der Kreml auf die riesigen Vorräte Nordkoreas zurückgreifen. Experten nehmen an, dass Nordkorea sieben Millionen Granaten abgeben könnte, ohne seine Magazine zu entblößen.
Munition aus dem Magazin
Die Unterstützung des Westens wurde größtenteils aus den Vorräten bestritten. Die USA stellen Munition in staatseigenen Betrieben her und konnten ihre Produktion schon massiv steigern. Ende 2025 sollen es 100.000 Schuss im Monat sein. Durch Koproduktion mit US-Unternehmen soll die Waffenproduktion in der Ukraine gesteigert werden. In Deutschland und Europa wartet die privatwirtschaftliche Industrie auf verbindliche Verträge, anders als in den USA können die Fabriken nicht direkt angewiesen werden. Hier müsste sich die Regierung dazu durchringen, Bestellungen von zehn bis 20 Millionen Granaten zu unterschreiben, die über Jahre hinweg geliefert werden.
Neue Anlagen sind notwendig
Die bestehenden Anlagen können den Bedarf nicht decken. Sie sind für eine überschaubare Friedensproduktion ausgelegt. Mit längeren Laufzeiten und Wochenendarbeit lässt sich der Ausstoß etwas steigern, aber nicht vervielfachen. Hinzukommt, dass nicht nur Kiew Munition kaufen will. Der Bedarf ist auch bei anderen in die Höhe gesprungen. Die Magazine sollen wieder aufgefüllt werden, die für die Ukraine geleert wurden. Viele Länder haben entdeckt, dass ihre Munitionsvorräte viel zu klein sind, um einen Krieg zu führen. Nun wollen sie aufstocken.
Im Zweiten Weltkrieg haben die USA gezeigt, zu welchen Leistungen ihre Rüstungsindustrie fähig ist. Doch damit es dazu kommt, muss ihre Kraft entfesselt werden. Für den Bedarf des Ukrainekrieges müssen neue Anlagen gebaut werden. Doch die Industrie kann für einen Sechs-Monats-Auftrag keine neuen Fabriken bauen und entsprechendes Personal ausbilden. Das ist nur möglich, wenn die Abnahme jahrelang garantiert wird. Das finanzielle Risiko muss der Staat übernehmen. Arbeiten in Nachtschichten, mit Hochdruck aufgebaute Anlagen – das wird teuer. Schon jetzt ist der Preis für eine 155-mm-Granate von 2000 Euro auf bis zu 8000 Euro gestiegen. Doch wenn diese Entscheidung nicht gefällt wird, kann Kiew die Kämpfe im Laufe des nächsten Jahres nicht fortsetzen.