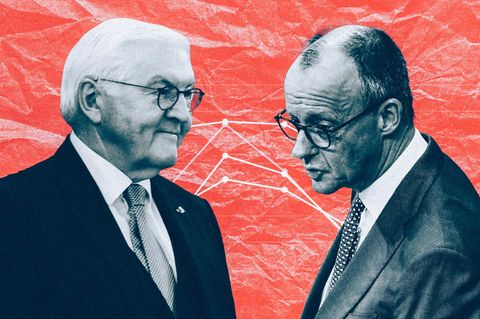Anders als die Bundesregierung wollen die Länder die vorläufig weiterlaufenden neun Atomkraftwerke in mehreren Schritten abschalten. Eine Konzentration der Abschaltung auf die Jahre 2021 und 2022 lehnen sie ab. Das Ausstiegsdatum 2022 soll zudem unumkehrbar sein. Dies machte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Freitag in Berlin nach Beratungen der Ministerpräsidenten deutlich. Am Nachmittag kam Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten im Kanzleramt zusammen, um erneut über die Energiewende zu beraten.
Die Bundesländer lehnen zudem ein Atomkraftwerk als Reserve zur Sicherung der Stromversorgung ab, wie es FDP-Chef und Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler im Koalitionsbeschluss durchgesetzt hatte. Stattdessen wollten die Länder eine Kaltreserve aus Gas- und Kohlekraftwerken, betonte Sachsen-Anhalts Regierungschef. Die Netzbetreiber rechnen mit einem zusätzlichen Strombedarf von bis zu 2000 Megawatt an kalten Wintertagen, weil dann kaum Solar- und Importstrom zur Verfügung stehen.
Länder fordern mehr Mitsprache
Die Länder sprachen sich zudem dafür aus, zur Beschleunigung des Gesetzgebungsverfahrens Bundestag und Bundesrat parallel mit dem Energiepaket zu befassen. Das ist auch notwendig, weil sonst für die endgültige Stilllegung der vorläufig abgeschalteten acht AKW keine gesetzliche Grundlage vorliegt. Die beschleunigte Energiewende verursacht bei den großen deutschen Kernkraftwerk-Betreibern einer Studie zufolge Vermögensschäden bis zu 22 Milliarden Euro.
Die Bundesregierung suche einen Konsens mit den Ländern, auch wenn viele Gesetze nicht zustimmungspflichtig seien, unterstrich Haseloff. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) betonte, die Energiekonzerne hätten Rückstellungen von 20 Milliarden Euro für den Rückbau der AKW. Beim Thema Endlager forderten die Länder eine rasche Lösung.
Niedersachsen pocht auf mehr Mitsprache beim Netzausbau. Nach Ansicht von Ministerpräsident David McAllister (CDU) sollen Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden. Der Bund sei nicht gut beraten, Höchstspannungstrassen selbst zu planen, sagte McAllister im Deutschlandfunk. Das Raumordnungsverfahren könne auf den Bund übertragen werden, die Planfeststellungsverfahren sollten bei den Ländern verbleiben, schlug er vor.
Streitpunkt Reststrommengen
Besonders SPD- und grün-regierte Länder sehen beim Atomausstiegetliche Fragen offen, etwa bei den Daten für die Abschaltung einzelner Meiler. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte: "Wenn die Bundesregierung den Ländern folgt, könnte das ein sehr tragfähiger gesellschaftlicher Kompromiss sein, der auch allen Investoren in alternative Energien Investitionssicherheit gibt."
Die CSU in Bayern zeigte sich überrascht, dass nun doch Reststrommengenübertragungen von allen stillgelegten auf die neun noch laufenden Meiler möglich sein sollen. Das dürfte zu einer Ballung der AKW-Abschaltungen 2021 und 2022 führen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Thomas Oppermann, forderte in der "Berliner Zeitung", den Atomausstieg bis 2022 im Grundgesetz zu verankern.
Über die Übertragbarkeit von Reststrommengen alter Meiler auf neuere wolle die SPD mit der Koalition "kritisch verhandeln", sagte Oppermann. Eine Studie des Öko-Instituts kommt zu dem Schluss, dass wegen der Strommengenübertragung die restlichen neun Meiler wohl alle erst ab 2021 abgeschaltet werden. In Regierungskreisen wird betont, dass es kaum möglich sei, auf die schon beim rot-grünen Ausstieg vor zehn Jahren vereinbarte Übertragung zu verzichten. Streng genommen würde bei einer Streichung der einmal zugestandenen Strommengen in Eigentumsrechte eingegriffen.
SPD pocht auf mehr regenerative Energien
Ministerpräsident Beck sagte im Südwestrundfunk (SWR), beide Seiten seien sich in den vergangenen Tagen ein Stück entgegengekommen. Notwendig sei eine gesetzliche Regelung, dass spätestens 2022 keine Kernenergie mehr produziert werden dürfe und bis 2020 mindestens 40 Prozent der Strommenge aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Die Bundesregierung beharrt auf dem 35-Prozent-Ziel.
Im Streit um die Art und Weise des Ausbaus erneuerbarer Energien deutete Niedersachsen ein Einlenken des Bundes an. Demnach könnte die Subventionierung von Windkraft an Land (Onshore) doch nicht gekürzt werden. Viele Länder fürchten eine zu starke Konzentration auf Windparks in Nord- und Ostsee (Offshore), hierfür soll die Vergütung auf mindestens 15 Cent pro Kilowattstunde steigen.