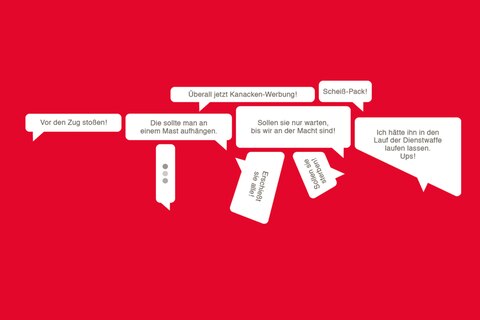Hoyerswerdas Zukunft hat weder Nuancen noch Zwischentöne, auf dem großen Stadtplan dominieren zwei Farben. Schwarze Striche: Diese Häuser bleiben stehen. Blassgraue Striche: Diese Häuser werden bis 2020 abgerissen. Und dann gibt es noch eine orangefarbene Trennlinie. Sie umkreist den inneren Stadtbereich, der zu über 90 Prozent erhalten werden soll. Außerhalb dieser Markierung fahren die Schuttlaster. Später wird es hier Wiesen, Sportplätze, Parks und Schafweiden geben. Keine Wohnungen mehr.
Diplom-Ingenieur Thomas Gröbe ist mit seinem Planungsbüro mitverantwortlich für den Rückbau einer halben Stadt. Bei ihm laufen die Fäden zusammen, hier werden die Karten gezeichnet. Manchmal ist das eine sehr persönliche Sache.
Grafiken zur demografischen Lage
Sehen Sie hier einige ausgewählte Grafiken zur Zukunftsfähigkeit deutscher Regionen aus der Studie "Die demografische Zukunft von Europa", die vom Berlin-Intitut erarbeitet wurde. Darin enthalten ist unter anderem auch eine Übersichtskarte mit den Bevölkerungsprognosen für alle deutschen Regierungsbezirke und Bundesländer.
"Ich komme selbst aus Hoyerswerda", sagt er.
"Wo sind sie denn aufgewachsen?"
"Die ersten Jahre habe ich hier gelebt." Gröbe tippt mit seinem Zeigefinger auf einen schwarzen Balken im Bereich des Wohnkomplexes Nummer vier, errichtet in den frühen 60er Jahren.
"Und dann?"
"Wir sind später etwas weiter in diese Richtung gezogen. Dort habe ich meine gesamte Jugend verbracht." Gröbes Fingerkuppe fährt nach Südwesten und stoppt auf einem von drei Gebäuderiegeln. Sie sind mit der Farbe blassgrau gekennzeichnet.
"Ich habe um diese Häuser gekämpft. Sie prägen das Stadtbild. Wenn man über die Felder Richtung Hoyerswerda geblickt hat, waren sie immer präsent", sagt er. Aber die Entscheidung ist längst gefallen, und nun muss Gröbe helfen, das Haus abzureißen, in dem er seine Jugend verbracht hat. Er wird es tun. Aber ob er sich damit abfinden wird?
Beispielloser Bevölkerungsschwund
Gröbes Heimatstadt wird oft als Musterbeispiel für die demografische Katastrophe im Osten genannt. Sie ist eine der am schnellsten schrumpfenden Kommunen in Deutschland. Zur Wendezeit lebten hier über 70.000 Menschen, mittlerweile sind es noch etwa 39.000 - trotz einiger Eingemeindungen. In zwölf Jahren werden nach verschiedenen Schätzungen etwa 25.000 bis 30.000 Menschen übrig sein. Die eigentliche Kernstadt hätte dann noch gut ein Drittel der Einwohner wie zu DDR-Zeiten. Und auch der Altersdurchschnitt steigt rasant an. Früher war Hoyerswerda die "jüngste" Stadt der Deutschen Demokratischen Republik, wie es damals hieß. Mittlerweile ist der Durchschnittsbürger jenseits der 50. Tendenz: alternd. Die Bevölkerungspyramide gleicht jetzt schon einem Atompilz.
Viele Bürger der Stadt reden wehmütig von "früher". Damals, Ende der 50er Jahre, war Hoyerswerda ein realsozialistisches Prestigeprojekt. Die DDR-Führung entschied sich, vor den Toren der 7.000 Einwohner zählenden Stadt ein riesiges Braunkohleveredelungswerk zu errichten. Von hier aus wurde die gesamte Republik mit Stadtgas versorgt. In Spitzenzeiten malochten 40.000 Menschen in den Fabriken des Kombinats "Schwarze Pumpe". Um Wohnraum für die Arbeiter zu schaffen, wurde Hoyerswerda nach Osten erweitert. Die Neustadt bot Platz für 60.000 Menschen in zehn so genannten Wohnkomplexen.
Gescheiterte Ambitionen
Es war eine Zeit, in der auch die Intellektuellen hofften, dass hier eine menschliche Form des Sozialismus in Form der Architektur Gestalt annehmen könnte. Die Vision scheiterte. Die Schriftstellerin Brigitte Reimann lebte in den 60er Jahren selbst in Hoyerswerda. Sie setzte den städtebaulichen Ambitionen der DDR-Führung ein schriftstellerisches Mahnmal. In ihrem Roman "Franziska Linkerhand" will die Titelheldin als ambitionierte junge Architektin in "Neustadt" eine bessere Gesellschaft aufbauen, mit menschengerechten Wohnungen für die Arbeiter der Kombinate. Sie verzweifelt am Unwillen und am Unverständnis der politischen Führung. In einer Szene blickt der alte Architekt Landauer mit ihr über die Dächer der Wohnsilos und sagt: "Was sie hier sehen, meine junge Freundin, ist die Bankrotterklärung der Architektur. Häuser werden nicht mehr gebaut, sondern produziert wie eine beliebige Ware, und an die Stelle des Architekten ist der Ingenieur getreten." Und: "Wir sind Funktionäre der Bauindustrie geworden, für die Gestaltungswille und Baugesinnung Fremdwörter sind, von Ästhetik ganz zu schweigen."
Damals waren die Wohnkomplexe acht bis zehn noch nicht gebaut. Sie bilden heute das Kerngebiet der Abrisszone: Waschbetonkisten ohne Schmuck, die wie vom Himmel geschmissen an geraden und gleichförmig gebogenen Straßen liegen. Obwohl sie erst 20 Jahre alt sind, rieselt der Sand aus den Fugen, und die grobe Steinkörnung der Fassade ist noch grauer und schmutzfarbener als Zement es jemals sein könnte. Auf einer Wiese im Wohnkomplex neun liegt ein solcher Klotz schon in Trümmern, daneben liegt ein Park mit sauberen Gehwegen und jungen Bäumen, deren Rinde noch glänzt. Auch hier lebten einst Menschen. Bisher sind knapp 6.500 Wohnungen zurückgebaut worden, bis 2020 sollen es insgesamt 10.000 werden.
Die Altstadt hat Zukunft
"Herr Gröbe, ein Architekt lernt doch eigentlich das Bauen, und nicht Abreißen, oder?"
Er überlegt kurz. "Wir haben ja jetzt eine Chance durch den Rückbau. All das, was Franziska Linkerhand bauen wollte, können wir jetzt in den noch verbleibenden Wohngebieten ergänzen."
Gröbe mag seine Stadt. Hochhaus ist für ihn nicht gleich Hochhaus. Wie ein Gärtner betrachtet er Hoyerswerda. Wo muss man jäten, wo muss man pflegen? Er will, dass seine Heimat wieder blüht.
Das Potenzial dazu ist durchaus vorhanden. Was kaum jemand außerhalb Sachsens weiß: Hoyerswerda hat neben urbanen Brachflächen auch eine schöne Altstadt. Es gibt hier ein malerisches Renaissanceschloss und ein fast 700 Jahre altes, weiß gestrichenes Rathaus, das wie eine kleine Bürgerburg am Rande des historischen Marktplatzes liegt. Unter dem Dach, dritte Etage, hat Dietmar Wolf sein Büro. Er ist Dezernent für "technische Dienstleistungen". An seinem Schreibtisch wird der Rückbau organisiert. Hoyerswerdas Hoffnung auf eine bessere Zukunft beginnt hier.
Rückbau als "neue Disziplin" der Stadtplanung
Der Teilabriss von Hoyerswerda-Neustadt ist ein Pilotprojekt. Auch andere Städte leiden unter Bevölkerungsschwund, vielleicht müssen bald sogar im Westen Wohnblocks im großen Stil abgetragen werden, damit zukunftsfähige Städte bleiben, wo einst Industriemetropolen waren. "Es wurde immer gelehrt: Mehr Verkehr, mehr Wohnraum, die Städte müssen wachsen", sagt Wolf. "Aber der Rückbau ist eine neue Disziplin, die erst vor zehn Jahren entstand." In Hoyerswerda habe die Verwaltung in den ersten Jahren nach der Wende auch das Thema "Abriss" gescheut, sagt Wolf. Mitte der 90er Jahre entstand dann ein tragfähiges Konzept. Ein Genesungsplan für eine kranke Stadt, wenn man so will. "Die alte Bevölkerung wird das Schrumpfen der Stadt als Katastrophe empfinden", sagt er. "Wir sehen es als Chance, damit die Stadt mit ihrer künftigen Bevölkerungszahl zukunftsfähig bleibt."
Die Altstadtsanierung läuft parallel zum Abriss in der Neustadt. In kopfsteingepflasterten Gassen und Straßen sind viele Menschen zu sehen, auch junge Leute. Dieser Teil Hoyerswerdas lebt. "In den 90er Jahren sind viele weggezogen, wer keine Arbeit hatte, ist in die alten Bundesländer gegangen", sagt Wolf. "Jetzt merkt man, dass Fachkräfte gesucht werden. Das ist eine Perspektive, besonders für die jungen Leute hier."
Auch die Straßen werden zurückgebaut
Thomas Gröbe fährt mit seinem Auto durch die breiten Straßen der Neustadt. Vier Spuren hatte man damals angelegt, autofreundlich sollte die Siedlung sein. Jetzt werden die äußeren Streifen an vielen Stellen aufgerissen und begrünt. Es gibt hier Hochhäuser, bei denen man die oberen Stockwerke abgetragen hat, Sechsstöcker, die als Dreistöcker weiter existieren dürfen. Plattenbauten stehen am Straßenrand, die dank aufwändiger Sanierungsarbeiten wie moderne Designobjekte aussehen. Gröbe möchte, dass die modernisierten Bereiche der geplanten Neustadt irgendwann einmal als Weltkulturerbe gelten dürfen. Den Vorschlag hat er selbst gemacht.
An der nächsten Kreuzung biegt Gröbe nach links ab, der Mercedes fährt am Wohnkomplex fünf vorbei. Nach einigen Metern passiert der Wagen die orangefarbene Strichellinie, die man hier nicht sehen kann. Rechts beginnt eine Grünfläche, links stehen die drei Wohnriegel, in deren Höfen er seine Jugend verbracht hat. Manche Balkone sind schon leer, an anderen hängen noch Markisen.
"Ich setze mich gerade dafür ein, dass aus dem Schutt der Häuser Pyramiden gebaut werden, die dort stehen bleiben", sagt er. "Die kann man dann begrünen. Das wäre doch ein schönes optisches Signal. So was gibt es sonst noch nirgends." Zerbrochene Steine, dort wo einst Hunderte Menschen wohnten, und Gras und Pflanzen. Aber es würde etwas übrig bleiben. Irgendwas.