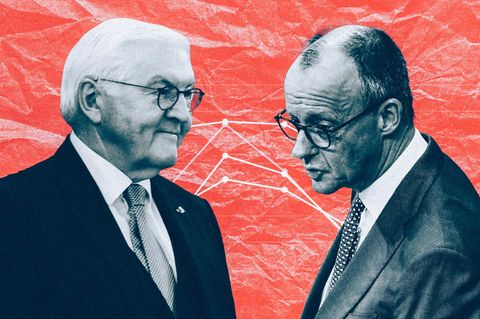Rechtspopulisten in der Regierung: Italien hat sie, Ungarn und Polen schon lange, Schweden und Finnland jetzt auch, in Spanien hat nicht viel gefehlt. Auch in Deutschland wird das bisher undenkbare mittlerweile diskutiert: Kann es sein, dass auch hier früher oder später eine rechtspopulistische Partei in die Regierung kommt, wenn nicht im Bund, dann zumindest in einzelnen Ländern?
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Jedes Land ist anders und die Gründe für den Aufschwung der Rechten in Europa sind genauso unterschiedlich, wie deren Anführer und Geschichte. Aber eines haben alle Länder gemeinsam: Die Wut steigt.
Auch in Deutschland ist sie das vorherrschende Gefühl: Vier von zehn Deutschen sagen im Herbst 2023, dass sie Wut empfinden.
Nun übersetzt sich Wut nicht automatisch in Wählerstimmen für rechte Parteien, aber der Zusammenhang ist augenfällig: Während sich nur zwölf Prozent der Wähler der Grünen als wütend bezeichnen, sind es bei der AfD 67 Prozent. Die AfD ist die Manifestation des Wutbürgers in realer Politik.
Der Trick der Populisten, das Dilemma der Regierung
Dahinter steckt eine Strategie, die bei rechtspopulistischen Parteien europaweit immer dem gleichen Muster folgt: Sie polarisieren und eskalieren Themen, bis der öffentliche Eindruck entsteht, dass ein Problem unfassbar groß ist und die Regierung es nicht lösen kann. Populisten wollen Krisen – im bestehenden institutionellen Rahmen – unlösbar erscheinen lassen. So bestätigen sie die Überforderten und Wütenden zusätzlich in ihrer Gefühlswelt. Unlösbare Krisen zahlen über den Umweg der Wut auf das Wähler-Konto der Populisten ein. Die Krise ernährt die Krise.
Und manchmal wird die Krise auch von denen ernährt, die sie eigentlich lösen wollen. Beispiel Klima: Eine klare Mehrheit der Deutschen hält den Klimawandel nicht nur für eine reale Gefahr, sondern befürwortet auch ein entschlossenes Handeln der Politik, um die Krise zu bewältigen.
Eigentlich gute Voraussetzungen für die angestrebte Neuregelung beim Gebäudeenergiegesetz in diesem Jahr. Doch das Gegenteil ist der Fall: Schon lange war der öffentliche Widerstand nicht mehr so groß wie bei der Heizwende. Fragt man bei den Bundesbürgern nach, dann ist es nicht unbedingt so, dass sie die Erneuerung der Heizungen ablehnen, aber mehr als zwei Drittel geben an, dass sie sich von den geplanten Regelungen überfordert fühlen. Das nächste Futter für die Wut.
Diese Situation ist ein strategisches Dilemma für die Bundesregierung. Geht sie zu entschlossen und schnell die Krisen der Zeit an, kann es leicht passieren, dass die Menschen sich noch weiter überfordert fühlen. Handelt sie nicht, werden die Krisen bleiben und sich verschärfen.
Und nun? Die Vorgänger der heutigen Bundesregierung scheinen dieses strategische Dilemma und die Seelenlage der Deutschen besser verstanden zu haben. Angela Merkel vermied jede Polarisierung, weil sie wusste, Probleme müssen klein und lösbar erscheinen, damit sie die Menschen nicht überfordern.
Oft wurde ihr Agieren als Teflon-Politik gescholten – man konnte sich mit ihr einfach nicht öffentlich streiten, alles perlte an ihr ab. Denn sie schien erkannt zu haben, dass große Probleme nur der Opposition oder im schlimmsten Fall sogar den Rechtspopulisten helfen. Selbst Gerhard Schröder ahnte das – auch wenn er nicht immer so gehandelt hat – und prägte einst den Begriff der "Politik der ruhigen Hand".
Die Ampel gibt ein überfordertes Bild ab
Für die aktuelle Regierung lassen sich daraus drei Grundsätze ableiten: Erstens: Das wichtigste Prinzip muss sein, über Probleme – egal ob Klimawandel oder Wirtschaftswachstum – weniger alarmistisch und konfrontativ zu kommunizieren. Probleme sollten emotional verkraftbar bleiben. Probleme zu eskalieren, hilft vor allem den Rechtspopulisten. Der Kanzler könnte statt von "schwierigen Situationen" ruhig auch mal von "wir schaffen das" sprechen.
Zweitens: Es ist nicht leicht, von außen die innere Dynamik der Koalition zu beurteilen, aber die Causa Lisa Paus scheint ein weiterer Fall in einer längeren Kette von schädlicher Eskalation in der Regierung zu sein. Merkels Politik ohne Polarisierung war auch deshalb möglich, weil die Liste ihrer machtpolitischen Opfer lang ist: Kohl, Schäuble, Koch, Merz, Wulff, Röttgen – um nur die wichtigsten zu nennen. Nur wenige haben sich unter ihr noch getraut, auf dem sprichwörtlichen Tisch zu tanzen.
Olaf Scholz ist das Gegenteil: Er ist so loyal, dass nur noch jeder Fünfte Bundesbürger ihn als führungsstark wahrnimmt. Habeck und Lindner schneiden nicht wesentlich besser ab. Disziplin in einer Dreierkoalition herzustellen, ist eine Herkulesaufgabe, aber ohne wird es nicht gehen.
Drittens: Beim Thema Disziplin kann es helfen, wenn die progressiven Kräfte der Regierung ihre Verantwortung für die Demokratie nicht aus den Augen verlieren. Oft wird unter linken und progressiven Kräften kolportiert, dass es der vermeintliche Flirt der bürgerlichen Parteien ist, der die AfD stark macht.
Das ist mit Sicherheit nur zum Teil richtig: Der Aufstieg der Rechten geht auch auf das überforderte Bild zurück, das die Ampel abgibt. Es macht den Deutschen Angst und viele sind wütend. Politische Führungskräfte, die für führungsschwach gehalten werden und Minister, die sich gegenseitig vor das Schienbein treten, sind die Mischung, aus der die Träume der AfD gemacht sind.
Zum Autor: Gerrit Richter ist Mitgründer und Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Civey.