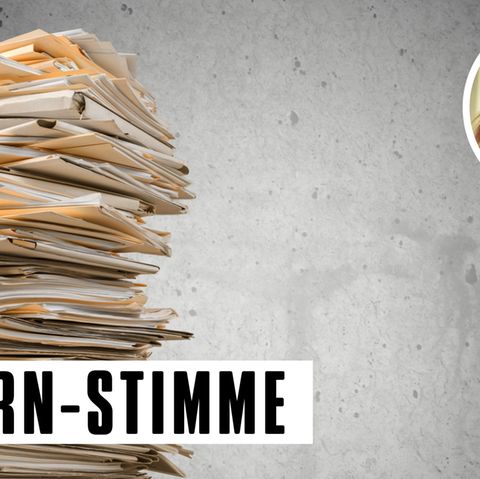An einem Donnerstagmorgen vor vier Jahren begann ich meinen Umzug, am Sonntagabend war ich fertig. So lang, so schweißtreibend? Nein, so gemütlich und so nebenbei. Ich packte, was ich brauchte, in eine blaue Ikea-Tüte – einen großen Topf und einen kleinen, eine Pfanne, vier Teller, vier Gläser, Besteck –, leinte meinen Hund an und spazierte mit ihm und der Tasche in meine neue Wohnung, 300 Meter von der alten entfernt. Nächster Gassigang am Nachmittag: ein paar Jeans, Pullis und T-Shirts, Lieblingsklamotten. Am Morgen danach: Lieblingsbücher, es waren nicht viele, und eine Stehlampe. Zwei Jungs schleppten mir ein Sofa rüber, einen Tisch und zwei Stühle hatte ich günstig online ersteigert, als Bett genügte zunächst eine Matratze. Der letzte Weg: das Hundekörbchen unterm Arm, ein paar Flaschen Rotwein in Geschirrtüchern verpackt, ein Korkenzieher. Das war's. Ich war eingezogen.
Ich wanderte ratlos durch meine absurd große Wohnung, die mir doch mal so wichtig gewesen war
Oder besser: Ich war ausgezogen. Schuld war ein Beziehungsdrama: Irgendwas war kaputtgegangen zwischen mir und meinem alten Leben. Es war mir zu viel geworden. Zu viel Zeug, zu viel Ballast, zu viel Vergangenheit – und eindeutig zu viel Platz. Von 200 Quadratmetern zog ich auf 38, von sechs Zimmern Stuckgewitter in ein nüchternes Ein-Zimmer-Apartment. Das wirst du nicht lange aushalten, unkten meine Freunde, das ist mal wieder eine deiner Schnapsideen. Was soll das überhaupt?
Das wusste ich selbst nicht so genau. Ich war gerade von einer Reise zurückgekehrt, ein Jahr lang hatte ich aus dem Koffer gelebt und dabei nicht das Geringste vermisst. Daheim hingegen war mir alles fremd. Ich wanderte ratlos durch meine absurd große Wohnung, die mir doch mal so wichtig gewesen war und für die ich mich lange so krumm gemacht hatte, starrte die deckenhohen Regale mit Büchern an, die ich garantiert kein zweites Mal lesen würde, zog Schubladen auf, an deren Inhalte ich nur vage Erinnerungen hatte, und fragte mich:
Wer ist die Frau, die sich diesen goldenen Käfig geschweißt hat, warum hat sie all den Krempel angehäuft, was will sie damit? Ich fand keine Antworten. Nur die eine: Ich will hier raus. Ich mag die Unbeschwertheit des Lebens mit leichtem Gepäck nicht mehr missen. Ich will einen Reset. Reinen Tisch machen, zurück auf Los.
Mit dem Bedürfnis bin ich nicht allein, im Gegenteil. Die Sehnsucht nach Einfachheit und Erleichterung treibt derzeit viele um, das Gefühl, dass es so nicht weitergehen kann, dass man sich endlich wieder Luft verschaffen muss. Und Klarheit. Und Kontrolle. Der Zeitgeist kennt derzeit nur eine Vorsilbe: ent-. Entrümpeln, entschleunigen, entgiften, entschlacken, entspannen. Entzug von der Immer-mehr-Droge, an deren Nadel wir so lange und so freudlos gehangen haben. Denn das große Glücksversprechen des Immer-Mehr verwandelt sich irgendwann in einen ebenso großen Kater, wenn man nämlich feststellt, dass auch das 50. Paar Schuhe nicht die Erlösung bringt und man selbst im fettesten SUV nur im gleichen Stau steht wie alle anderen. Es weint sich schöner auf dem Rücksitz eines Rolls-Royce, wie es immer so schön heißt? Vielleicht. Aber wäre Lachen nicht viel schöner?
Ein Runterschalten muss nicht in Askese ausarten
Das Immer-Mehr zieht zudem eine Spirale an Folgekosten nach sich: Schicke Klamotten müssen in die Reinigung, ein großes Auto schluckt mehr Sprit und höhere Versicherungsprämien – und nicht nur die Ausgaben wachsen, sondern auch die Ängste vor Verlust und Abstieg. Wer bin ich, wenn ich all das nicht mehr habe? Möglicherweise ein freierer Mensch. "Irgendwann habe ich nicht mehr eingesehen", sagt eine Münchner Freundin, "dass ich für eine Wohnung schufte, die ich nie sehe, weil ich ihretwegen ja so viel arbeiten muss, und für eine Putzfrau, die diese Wohnung sauber macht, weil ich ja keine Zeit dafür habe." Jetzt wohnt sie ebenfalls in einer Einzimmerwohnung, arbeitet deutlich weniger und geht deutlich öfter am helllichten Tag spazieren. Andere Freunde krempeln ihr Leben in Umbruchsituationen um: Die Kinder sind aus dem Haus, eine Trennung steht an – Gelegenheiten, alles auf den Prüfstand zu stellen. Und zu dem Schluss zu kommen: geht auch einfacher.
Dabei muss ein Runterschalten nicht in Askese ausarten, wie ich festgestellt habe. So klein meine neue Wohnung ist, so fein ist mein Leben darin. Ich besitze nur noch zwei Handtücher, aber die sind von der plüschigsten Luxushotelqualität, die man kriegen kann. Ich koche nur noch auf zwei Platten, dafür auf Induktion. Das Motto ist ganz simpel: weniger, aber besser. Und besser ist das Leben eindeutig geworden. Denn was ich an Geld spare, fließt in jenes Gut, das in den vergangenen Jahren die gigantischste Wertsteigerung erfahren hat – Zeit. Meine Lebenshaltungskosten sind gesunken, also kann ich mir leisten, weniger zu arbeiten. Ich nehme nur noch Aufträge an, die wirklich Spaß machen (wie dieser hier), meine stern-Kolumne habe ich auf zweiwöchentlich reduziert.
Trotz oder wegen gesunkener Einnahmen – wohlhabender als derzeit habe ich mich nie gefühlt, getreu dem Zitat von Nassim Taleb: "Man ist nur dann reich, wenn das Geld, das man ablehnt, besser schmeckt als das Geld, das man annimmt." Seit drei Jahren habe ich keinen Urlaub mehr gemacht, denn: Urlaub wovon? Ich muss mich von nichts erholen. Eine fest angestellte Freundin, die zurzeit ein geplantes Sabbatical durch Lohnverzicht zusammenspart, stellt verblüfft fest, dass sie mit 80 Prozent ihres Gehalts genauso gut klarkommt. "Okay, ich gehe weniger essen und war ewig nicht shoppen. Aber ich weiß ja, wofür." Für sie ist jetzt schon klar, dass sie nach dem Sabbatical nur noch vier Tage die Woche arbeiten will. Und dann spricht sie den weisen Satz: "Von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter."
Zu viel Zeug als Last zu empfinden – ein First-World-Problem, oder?
Von innen – genau das ist das Problem. Wenn man drinsteckt, hat man selten den Überblick. Auch ich brauchte ja ein Jahr Abstand zu meinem Leben, um das Hamsterrad als solches zu erkennen, die Lächerlichkeit des Immer-Mehr: ein neues Handy, wenn man noch nicht mal alle Funktionen des alten kapiert hat? Ein Fernseher mit Ultra HD Blu-ray, das den "Tatort" aber irgendwie auch nicht brillanter macht?
So. Spätestens an dieser Stelle ist Protest fällig. Zu viel Zeug als Last zu empfinden – ein First-World-Problem, oder? Geht es uns einfach zu gut? Ist es in dieser Zeit nicht geradezu obszön, das Zuviel zum Leid-Motiv zu erklären, derweil Milliarden nichts lieber hätten als genau dieses Problem? Absolut. Was an der Unzufriedenheit derjenigen, die an der Spitze der Bedürfnispyramide angekommen sind, allerdings nichts ändert. So richtig doll scheint es den Wohlstandsgeplagten der westlichen Überflussgesellschaft nicht zu gehen, sonst würden nicht so viele klagen über die Überforderung, die Übersättigung und die seltsame Lebensmüdigkeit, die sich daraus ergibt, sonst gäbe es nicht so viele Fluchtfantasien, sonst hätten zum Beispiel Landlust-Magazine nicht diesen verrückten Erfolg, sonst würden die Leute nicht plötzlich auf Barfußschuhe schwören oder auf Steinzeitdiäten. Wie auch immer: Im heiß gelaufenen Getriebe des Turbokapitalismus knirschen die ersten Sandkörnchen, im Überfluss des Warenangebots (ich habe heute die Marmeladensorten in meinem Supermarkt gezählt; bei 150 habe ich aufgehört und war noch längst nicht durch) sind die ersten leisen Stimmen mit einem lange undenkbaren Satz zu hören: Darf's ein bisschen weniger sein?
Denn das hysterische Tempo, mit dem einem jahrzehntelang immer neue Must-haves um die Ohren gehauen, immer neue Bedürfnisse geweckt wurden für Zeug, das kein Mensch braucht, sorgt dafür, dass das Pendel derzeit in die andere Richtung ausschlägt. In allen Lebensbereichen herrscht eine geradezu nostalgische Sehnsucht nach dem Simplen. Retropie statt Utopie: Omas handaufgegossener Filterkaffee statt 24 Geschmacksrichtungen Kapsel-Espresso, Seilspringen und Liegestütze im Park statt Powerplate-Training im Fitnessstudio, Armbanduhren mit Handaufzug statt Atomzeitwecker mit drei Zeitzonen. Sogar die gute alte Stulle wird jetzt in Berliner Butterbrotläden zum Erweckungserlebnis deklariert, ebenso wie der gute alte Eintopf zuvor. Richtig lustig wird es, wenn sogar ein Discounter wie Aldi sein traditionell überschaubares Angebot zum minimalistischen Lifestyle hochjazzen will. In einem Werbespot mit dem Slogan "Einfach ist mehr" hüpfen Zweijährige durch Pfützen, dazu deklamiert eine Kinderstimme: "Wählt doch einfach das Richtige. Und befreit euch vom Rest." Das hätte der Dalai Lama nicht schöner sagen können.
Macht mich das froh? Falls nicht: weg damit
Die Bestsellerlisten füllen seit Monaten Anstiftungen zum Befreiungsschlag in den Kategorien Lebenssinn, Ausmisten und Gelassenheit, hinzu kommen diverse Selbstversuchsprotokolle über Enthaltsamkeitsaktionen (ein Jahr nichts Neues kaufen, ein Jahr ohne Internet leben) und mittelfingerlastige Ich-mach-nicht-mehr-mit-Titel wie "Einen Scheiß muss ich" und "Am Arsch vorbei geht auch ein Weg". Die Entrümpelungsbibel "Magic Cleaning" der Japanerin Marie Kondo hält sich seit mehr als hundert Wochen auf der Bestsellerliste, nachdem die Aufräumpäpstin zuvor schon den halben Erdball konvertiert hat. Das "Time Magazine" kürte 2015 Kondo neben Angela Merkel und Kim Jong-un zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt für ihre Lehre von der Leere. Oder vielmehr: vom bewussten Haben. Für sie geht es nicht darum, was man entsorgt, sondern was man behält. Nämlich nur das, was für tokimeku sorgt: für schlichte Freude. Man solle alles, aber auch wirklich alles aus den Schränken räumen und aus den Regalen, dann jedes einzelne Ding in die Hand nehmen und sich fragen: Macht mich das froh? Und zwar hier und jetzt, nicht früher oder irgendwann. Falls nicht: weg damit.
Für die meisten beginnt der Schock schon beim Öffnen der Schranktüren. Schnell, ohne nachzugucken: Schreiben Sie einfach mal haarklein auf, was sich gerade in Ihrem Kleiderschrank befindet, von oben links nach unten rechts bitte. Und jetzt machen Sie das Ding auf, und erbleichen Sie. Und dann bitte dasselbe Spiel mit den Schubladen im Wohnzimmer. Schon klar, oder? Wenn man nicht mal weiß, was man hat – warum sollte man es dann überhaupt haben wollen?
Doch wie schwer es ist, die Dinge loszulassen, davon können Aufräum-Coaches ein Lied singen. Man trennt sich nämlich nicht von Sachen, sondern von Selbstbildern, Sehnsüchten und wärmenden Illusionen. Eines Tages passe ich wieder in Größe 38/fange ich wieder mit dem Tennisspielen an/lese ich all die ausgerissenen Zeitungsartikel/ könnte ich diesen Karton mal brauchen. Dieser magische Tag lässt zwar schon seit Jahrzehnten auf sich warten, aber … irgendwann, bestimmt. Das Aufheben dient als emotionaler Schutzschild gegen die Unwägbarkeiten des Lebens. Man weiß ja nie, und weil man nicht weiß, will man gerüstet sein. Also vermüllt man lustig vor sich hin, im Zweifel eine Etage drunter oder drüber: In Kellern und Speichern stapeln sich Altlasten in Kisten und Säcken, Inhalt meist unbekannt, die bei einem Umzug in der Regel ungeöffnet in den nächsten Keller gewuchtet werden. Dort vermehren sie sich auf mysteriöse Weise. Man kennt das Phänomen von wilden Mülldeponien: Gerümpel zieht immer nur mehr Gerümpel an.
Bei vielen ist diese Einsicht bereits angekommen, besonders bei Jüngeren
Gegen dieses zähe Festhalten setzen die neuen Entrümpler Heils- und Glücksversprechen, die nahtlos an religiöse Traditionen anknüpfen. Lebensveränderung! Seligkeit! Endlich Stille im Kopf! Entsagung und freiwillige Armut waren schon immer der Weg ins Himmelreich oder wenigstens zu irdischem Glück, ob bei den Benediktinern oder buddhistischen Mönchen. Die spartanische Härte gegen sich selbst galt und gilt als Zeichen moralischer Überlegenheit. Kein Zufall, dass viele moderne Entsagungsmoden wie die Aktion "Sieben Wochen ohne" in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern und auch das "Simplify your life"-Imperium des Theologen Werner Tiki Küstenmacher christliche Wurzeln haben.
Doch erst in den vergangenen Jahrzehnten hat die Bewegung der "Voluntary Simplicity", der freiwilligen Einfachheit, so richtig Fahrt aufgenommen: Denn jetzt rettet man nicht nur das eigene Seelenheil, sondern die Erde gleich mit, diesen angenehmen kleinen Planeten, auf dem wir durchs Universum reiten und den wir trotzdem seit vielen Jahrzehnten in immer rasenderem Tempo ruinieren. Downshifting ist unter diesen Umständen längst kein Privatvergnügen mehr, sondern eine Vernunftentscheidung: weniger Konsum, weniger Müll, weniger Energieverschwendung, weniger Abgase, weniger Fleisch, weniger Fernreisen, weniger galoppierender Wahnsinn.
Bei vielen ist diese Einsicht bereits angekommen, besonders bei Jüngeren. Die Generation der nach 1980 geborenen Millennials ist mit der Idee groß geworden, dass man Dinge nicht besitzen muss, um sie zu benutzen. Carsharing, Bikesharing, Airbnb, Streamingdienste für Musik und Filme verändern gerade ganz grundsätzlich die Bedeutung von Eigentum. Besitz als Statussymbol und Identitätsstifter hat zunehmend ausgedient. Warum sollte man ein Auto kaufen, das im Schnitt 23 Stunden am Tag geparkt herumsteht, wenn man – zumindest in den Städten – jederzeit Zugriff auf eines haben kann? Wer braucht noch Platz für Regale, wenn Bücher, CDs, DVDs in der digitalen Wolke wohnen?
Jetzt habe ich halt nur fünf Regale à 78 Zentimeter
Wer nicht viel Platz hat, merkt, dass schon dieser Umstand enorm helfen kann beim bewussten Konsumieren. Seit ich in meiner Einzimmerwohnung lebe, komme ich gar nicht mehr in die Versuchung, mir im Supermarkt den Einkaufswagen vollzuladen – ich kann das Zeug nirgends lagern. Ergo: Nichts vergammelt, es gibt kaum Schwund. Ich kaufe immer noch Bücher, aber jetzt habe ich halt nur fünf Regale à 78 Zentimeter; wenn die voll sind, muss was raus, verschenkt, verkauft oder getauscht werden. Überhaupt lautet das eiserne Gesetz für Anschaffungen aller Art: Für jedes neue Ding muss ein altes weg, keine Diskussionen. Mein Wasser kommt aus dem Hahn, nicht aus den Vogesen, und nie zuvor habe ich so schnell so viele hilfreiche Nachbarn mit Bohrhammer oder Elf-Bar-Fahrradstandpumpe kennengelernt (ich kann im Gegenzug einen Eiskübel bieten, jeder hat halt seine eigene Definition von Basics).
Eine der wichtigsten Veränderungen aber betrifft meinen Kleiderschrank. Dort hängen ausschließlich blaue Klamotten, alles passt zueinander – ebenfalls eine Folge meiner Weltreise, bei der ich nur blaue Sachen im Koffer hatte, und das Ergebnis eines kleinen Selbstversuchs aus dem Jahr 2010. Damals hatte ich gelesen, dass man nur zehn Prozent seines Kleiderschrankinhalts tatsächlich regelmäßig trägt, der Rest hängt nur zur Dekoration herum. Also beschloss ich, ein Jahr lang jeden Tag das gleiche blaue Kleid zu tragen, das Projekt "Das kleine Blaue" war geboren. Was als Spiel begann, als spaßige kleine Mutprobe, wurde zu einem ungemein erkenntnisreichen Jahr. Das Aha-Erlebnis: Es funktioniert, und die meisten haben es nicht mal gemerkt.
Meine Blau-Meise, die ich seit inzwischen sechs Jahren pflege, hat nicht mit Sparsamkeit zu tun, und wenn, dann mit einer besonderen Art der Knauserigkeit: Ich muss keinen Gedanken verschwenden an die Frage, was ich anziehe. Es wird schon was Blaues sein, Details entscheidet das Wetter. Ein Thema weniger in meinem Leben, eine Entscheidung, die viele weitere Entscheidungen überflüssig macht.
Samstags bleibt das Handy aus
Auch das gehört für mich zur Lebensentrümpelung: Zeit- und Aufmerksamkeitsräuber, die mir nichts bedeuten (es gibt auch andere, o ja! Aber dann ist es ja kein Raub), nach und nach wie Unkraut auszurupfen. E-Mail-Newsletter: unsubscribe. Whatsapp-Gruppen: stumm schalten. Ich kann und will nicht jede angesagte Serie sehen, vieles lasse ich mit verschränkten Armen vorbeirauschen. Twitter, Instagram: Sorry, das Leben ist zu kurz – ebenso fürs Bügeln. Samstags bleibt das Handy aus, einfach nur so. Partys schwänze ich mit wachsender Begeisterung.
Was gehen kann und was bleiben soll, wovon man mehr braucht und wovon weniger, das ist eine zutiefst persönliche Entscheidung, dafür gibt es kein Patentrezept. Was für den einen Ballast ist, ist für den anderen unverzichtbar. Jeder hat sein eigenes Zuviel, jeder muss sein eigenes Leben examinieren und wie ein guter Doktor fragen: Wo tut's denn weh? Zu viel Plunder? Zu viele sinnlose Termine? Zu viele Erwartungen, denen man gerecht werden will, zu viele Verpflichtungen, unter denen man zusammenbricht? Oder vielleicht das Gegenteil: zu viel Routine, zu viel Ödnis? Für beides gibt es Umdenk- und Umlenkmanöver. Eines allerdings gilt für alle Formen von Vereinfachung: Es soll dann bitte am Ende auch wirklich leichter sein im Leben, nicht auf lediglich neue Weise anstrengend.Ein militanter Minimalist wie der Amerikaner Dave Bruno, der seinen Besitz auf 100 Dinge geschrumpft hat, schafft das nur, indem er die mit seiner Familie gemeinschaftlich benutzten Gegenstände wie Tisch und Stühle nicht mitzählt und seine Bücher als 1 rechnet, nämlich als eine Bibliothek. Was für ein Krampf!
So, und wie geht es denn nun, das große Aufräumen? Vielleicht beginnt man mit ein paar grundsätzlichen Überlegungen:
Schluss mit Muss
"Ich muss" ist der größte Denkfehler der Menschheit, Punkt. Entscheidungen davon abhängig zu machen, dass man die Erwartungen anderer Leute erfüllt, kann nur ins Unglück führen. Das Gleiche gilt für Erwartungen, die man für seine eigenen hält – die aber doch nur die verinnerlichten Ideen anderer sind. Eingebildete Zwänge, ob groß oder klein (ich muss bis 30 eine Familie gründen, ich muss einen Thermomix haben, ich muss mir die Wimpern tuschen, bevor ich aus dem Haus gehe, ich muss selbst schreihässliche Geschenke aufbewahren), gehören als Allererstes entrümpelt, der Rest ist ein Kinderspiel. Nur eines muss man wirklich, nämlich sich eine einzige Frage stellen: Was will ich? Im Unterschied zu: Was soll ich wollen? Die Antwort auf die Frage "Kind oder Karriere?" darf dann gern auch "weder noch" lauten.
Hat man sich erst vom Muss oder seiner fiesen kleinen Schwester Sollte emanzipiert und damit endlich wieder echte Entscheidungsfreiheit gewonnen, fällt alles Weitere leicht: Wir müssen die Sitzgarnitur behalten, auf der keiner sitzt, hat ja mal viel Geld gekostet? Nee, müssen wir nicht, und das Geld ist so oder so weg.Wir müssen uns mit einer Einladung zum Essen revanchieren, und es muss mindestens dreigängig sein? Oh bitte.
Selbst den Titel dieses Artikels können Sie getrost ignorieren. Mach Dein Leben leichter! Nö, warum denn, wenn der Krempel in Ihrem Leben tokimeku bringt? Nur weil jetzt Entrümpeln angesagt ist? Pah.
Du darfst
Wer nicht mehr muss, der darf. Für das Dürfen haben wir normalerweise feste Zeiten vorgesehen, zum Beispiel den Jahresurlaub – Auszeit vom Müssen. In diesen Auszeiten kommen wir mit wahnsinnig wenig aus: Im Ferienapartment ist nur das Nötigste, im Koffer ein Bruchteil des Kleiderschranks. Mit leisem Bedauern fährt man wieder zurück in den prallen Alltag und denkt: Könnte es nicht immer so sein, so lastenlos, so einfach?
Leichtigkeit ist schwer. Weil man uns die Schwere eingetrichtert hat. Die Ernsthaftigkeit. Die Anstrengung, ohne die angeblich nichts etwas wert ist. Per aspera ad astra, so gehört sich das, auf rauen Wegen gelangt man zu den Sternen. Aber was, wenn es einen gar nicht zu den Sternen zieht, sondern wenn man bloß an einem schönen Nachmittag im Garten sitzen möchte, den man sonst nur vom Jäten kennt?
Man darf das. Man darf Termine abblasen, man darf Nein sagen – überhaupt sollte man viel öfter Nein zu allem Möglichen sagen, ein unglaublich befreiendes Wort – und man darf Dinge einfach mal ausprobieren. Und zwar ohne Erfolgsdruck, Dinge dürfen nämlich auch was: schiefgehen. Nicht schlimm. Schlimmer wäre, es nicht probiert zu haben.
Man darf mit dem Leichtwerden spielen, eine kleine Alltagsdiät einschieben. Mal eine Woche, einen Monat lassen, was nervt, tun, was sinnlos Spaß macht, und schauen, was dann passiert. Ich bin vor zwölf Jahren für einen Monat in eine kleine möblierte Wohnung in meiner eigenen Stadt, aber in einem anderen Stadtteil gezogen, nur um zu sehen, wie sich das Leben dort anfühlt. War billiger als Urlaub und deutlich spannender.
Sich die Genehmigung zum Spielen, zum Experimentieren zu geben, auch das ist Entrümpeln. Man darf ganz viel, mehr, als man denkt. Man muss es sich nur selbst erlauben, sonst tut es nämlich keiner.
Das Prinzip "gut genug"
"Ich habe genug" lässt sich ja auf zwei Weisen lesen: Ich habe die Schnauze voll. Oder: Was ich habe und was ich mache und wie ich es tue, genügt mir. Es geht also um das Entrümpeln von Ansprüchen. Nur wer die eigenen Entscheidungen nicht ständig in Zweifel zieht und aus tiefer Überzeugung "Das reicht mir völlig" sagt, wird zufrieden sein können. Wer immer nur das Beste sucht, verplempert sein Leben beim Versuch, es zu finden.
Das Problem ist nämlich, dass die Erwartungen, die eigenen und die der Welt, immer größer werden, je mehr man schon geschafft hat. Die Latte wird stetig höher gelegt. Ich muss eine gute Mutter sein. Was bedeutet das? Die Skala ist nach oben offen, ist man je gut genug? Das ständige Bewusstsein des eigenen Ungenügens ist der Diesel in dieser Höllenmaschine. Zu gewinnen ist das Spiel sowieso nicht: Wenn man es endlich geschafft hat, alle Stapel abzuarbeiten, qualifiziert einen das nur für noch höhere Stapel.
Also muss man die Spielregeln ändern. Die Erwartungen einzäunen. Ein Beispiel: Ein Freund lädt am 13. jedes Monats zu Spaghetti all'arrabbiata ein, Open House, ohne Anmeldung. Er weiß nie, ob 5 Leute kommen oder 30. Es ist auch egal, denn er hat immer eimerweise Arrabbiata eingetuppert in der Tiefkühltruhe, und ein Topf Nudeln ist fix gekocht. Spaghetti all'arrabbiata: nicht mehr, nicht weniger. Gut genug. Inzwischen macht der Freund das seit unglaublichen 25 Jahren. Und damit hat er eben doch alle Erwartungen weit übertroffen.
Die Dinge vom Ende her sehen
Eine der besten Methoden, um sich das Leben zu erleichtern, hat mir ein anderer Freund beigebracht, eine Frage, die zu meinem Mantra geworden ist: "Wird es in einem Jahr noch wichtig sein?" Worüber ich mich gerade aufrege, womit ich mich herumschlage – werde ich mich in einem Jahr überhaupt noch daran erinnern? (Oder in einem Monat? In einer Woche?) Es ist verblüffend, wie schnell sich die meisten Probleme in Luft auflösen, wenn man sie mithilfe dieser Frage abkühlt.
Umgekehrt heizt die Frage auch ein: Ist das, worauf ich heute so viel Kraft verwende, in einem Jahr noch wichtig?Dient es einem höheren Zweck, ist es ein Baustein für ein größeres Ganzes, macht es mich langfristig glücklich? Werde ich froh sein, es getan zu haben? Oft hilft es, die Dinge vom Ende her zu denken: Worauf möchte ich zurückblicken können, wenn ich alt bin, was will ich erlebt, gefühlt, erledigt haben? Schubladen aufräumen ist ein Anfang. Aber richtig leicht wird's erst, wenn man das wirklich Wichtige unter all dem To-do-Geröll wieder freigelegt hat. Mehr fällt mir nicht ein zum Einfacherwerden. Nur dass es funktioniert. Ich sitze hier in meinem einen Zimmer an dem einen Tisch, an dem alles stattfindet, lesen, schreiben, essen, Freunde satt machen (mit Hockern schaffe ich sechs) – es ist immer noch derselbe Tisch, den ich damals ersteigert hatte; er ist gut genug. Aus der Matratze ist ein Bett geworden, nach vier Jahren gibt es auch endlich eine Deckenlampe, die ich ertrage, Bücher sind gekommen und gegangen, ansonsten ist alles so wie nach meinem Einzug. Es kann so bleiben. Es ist nicht viel. Aber es ist das Richtige.