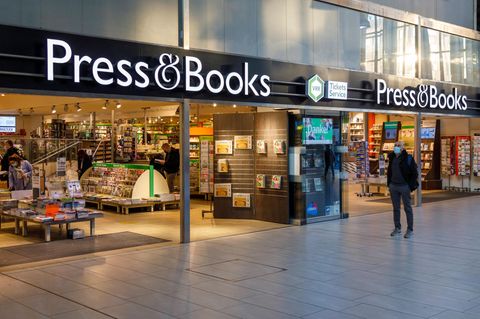Die Spende des mutmaßlichen Christchurch-Attentäters an Martin Sellner von der "Identitären Bewegung Österreich" hat Konsequenzen. Bei Sellner fand eine Razzia statt, ein Ermittlungsverfahren gegen den Kopf der rechten Gruppe läuft seither. Sellner, der im Verdacht der "Beteiligung an einer terroristischen Organisation" steht, sieht das Verfahren gegen ihn als unverhältnismäßig. Er habe nichts von der 2018 erfolgten Spende von Brenton T. an ihn gewusst, sie sei ihm erst später aufgefallen, beteuerte der 30-Jährige gegenüber österreichischen Medien.
Die österreichische Bundesregierung will dennoch hart durchgreifen. Es werde derzeit ein Auflösungsverfahren gegen die österreichischen "Identitären" geprüft, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch. Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), der Sellners Gruppe 2016 noch verharmlosend als "Bürgerbewegung" bezeichnet hatte, schug in dieser Woche völlig neue Töne an. Niemand der bei den "Identitären" aktiv sei, könne gleichzeitig auch eine Funktion in der FPÖ ausüben, wie Strache am Mittwoch sagte. Der Vizekanzler hat Erklärungsbedarf. Bereits mehrmals wurde seiner Partei in der Vergangenheit eine Nähe zu Sellners Aktivisten vorgeworfen.
Rechtsextremismusexpertin Natascha Strobl forscht bereits seit mehreren Jahren zur "Identitären Bewegung". Einer Auflösung der Organisation steht sie kritisch gegenüber. Ein Verbot der Identitären gehe am Kern der Diskussion vorbei, glaubt Strobl. Mit dem stern spricht sie über den richtigen Umgang mit Rechtsextremismus, den Ursprung der Parolen aus dem Christchurch-Manifest und warum der Slogan "Mit Rechten reden" überholt ist.
Frau Strobl, es ist bekannt, dass Martin Sellner, der Sprecher der österreichischen „Identitären Bewegung“ und Sie nicht gerade enge Freunde sind. Dennoch sagte er am Donnerstag in einem Video über Sie: "Sogar eine Natascha Strobl urteilt ehrlicher und aufrichtiger über ein Terrorverfahren als manche andere", in Anspielung auf die seiner Meinung nach unverhältnismäßigen Ermittlungen gegen ihn, die viele Kommentatoren befürworten, weil er 2018 eine Spende des mutmaßlichen Christchurch-Attentäters erhielt. Wie beurteilen Sie seinen Fall?
Ich nehme ihn nicht ernst. Ich bin immer vorsichtig, was Sellners Aussagen betrifft.
Er hat alle Verbindungen zum mutmaßlichen Christchurch-Terroristen abgestritten.
Das ist natürlich eine interessante Strategie, die er jetzt fährt. Er schießt gegen die Bundesregierung und vor allem gegen die FPÖ, weil jetzt ein Vereinsauflösungsverfahren wegen Terrorismus im Raum steht. Ich bin skeptisch was das Auflösungsverfahren betrifft, nicht weil ich Sympathien für die "Identitären" hege, sondern weil ich denke, dass ein Verbot der "Identitären" nicht genehmigt wird und sie im Endeffekt als Gewinner aus der Sache hinausgehen werden. Wenn die Regierung mehr in der Hand hat als diese Spende, soll Sie das Verfahren anstreben. Nur auf Basis dieser Spende ein Verbot anzustreben, führt zu einer sehr gefährlichen Diskussion, auf die wir uns hier einlassen.
Ist es eine gefährliche Diskussion aus rechtsstaatlicher Sicht oder auch deswegen, weil die "Identitären" als Gewinner aus der Sache herauskommen könnten?
Einerseits weiß ich, dass Österreich ein sehr liberales Vereinsgesetz hat. Dass eine Regierung nicht nur nach Gutdünken Vereine auflösen kann, ist eine Errungenschaft. Aber mir geht es speziell darum, dass dieses Thema nicht auf die Ja-Nein-Frage zum Verbot reduziert wird. Denn geht um viel mehr als diese Frage.
Um was genau?
Darum, wie man als Gesellschaft Rassismus und Rechtsextremismus begegnet. Wenn wir die Frage darauf reduzieren, ob die "Identitären" verboten werden sollen und Sie gewinnen das Verbotsverfahren, bekommen Sie das Gütesiegel, keine terroristische Organisation zu sein und alles ist wieder gut. Wir haben das in Deutschland bei der NPD gesehen und in Österreich bei der Burschenschaft Germania. Dementsprechend halte ich wenig von einer Auflösung, wenn man nicht gute Gründe dafür in der Hand hat. Ich glaube, dass es sich bei dem Verbotsverfahren vielmehr um eine Ablenkungsstrategie handelt, um die FPÖ reinzuwaschen. Das geht auf Kosten einer tatsächlichen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus.
Der neurechte Verleger Götz Kubitschek, der auch engen Kontakt zu AfD-Politiker Björn Höcke pflegt, verfasste am Mittwoch einen Aufsatz in der "Sezession" über Sellner mit dem Titel "Mein Freund Martin Sellner". Wie bewerten Sie die Verbindung zwischen der deutschen und österreichischen neuen Rechten?
Götz Kubitschek ist die zentrale Figur der deutschen neuen Rechten. Um ihn sammelt sich die Szene. Die "Identitären" sind sicher die größte Gruppe um Kubitschek. Martin Sellner ist ja selbst Redakteur von Kubitscheks Zeitschrift "Sezession" und immer wieder in Schnellroda, wo Kubitschek wohnt, zu sehen. Er wird dort als Kronprinz von Kubitschek hochgezogen. Da ist einfach eine sehr große Verbindung da.
Österreich ist ein relativ kleines Land. Können Sie sich erklären, wieso der mutmaßliche Attentäter von Christchurch 1500 Euro an den Österreicher Sellner spendete?
Österreich ist ein sehr kleines Land. Aber bei Rechtsextremismus gehört Österreich zur Avantgarde. Die österreichischen "Identitären" sind die größte identitäre Bewegung in Europa. Mit Martin Sellner haben Sie eine der zentralen Figuren, wenn nicht überhaupt die zentrale Figur der europäischen "Identitären Bewegung" in ihren Reihen. Wenn der Christchurch-Attentäter die "Identitären" unterstützen möchte, ergibt es schon Sinn an Sellner zu spenden, weil aus Österreich sehr viel Vernetzungsarbeit und ideologische Arbeit kommt. Die Person Martin Sellner ist zentral für ganz Europa.
Was unterscheidet die "Identitären" von ebenfalls rechten Bewegungen wie Pegida, wie man sie in Deutschland finden kann?
Sie sind sich eigentlich sehr ähnlich. Die "Identitären" waren von Anfang an bei Pegida dabei. Die deutschen "Identitären" wurden im Zuge der Pegida-Bewegungen aufgebaut und auch von den österreichischen "Identitären" unterstützt. Die ja auch von Anfang an in Dresden vor Ort waren, wo Pegida begann.
Wo liegt dann der Unterschied?
Die "Identitären" unterscheiden sich von Pegida dadurch, dass sie besser organisiert sind. Sie haben Kaderstrukturen sowie Funktionäre, können auf Ressourcen zurückgreifen und sie sind deutlich jünger. Sie agieren wie eine Jugendorganisation. Das zeigt sich in ihrem Umgang mit Social Media und in ihrem Aktionismus. Das unterscheidet sie von anderen rechtsextremen Phänomenen wie Pegida.Sellner und seine Gruppe haben sich am Mittwoch vom Terroranschlag auf die beiden Moscheen im neuseeländischen Christchurch, wo 50 Menschen getötet wurden, distanziert. Im Manifest des mutmaßlichen Attentäters, das seine Motive offenbart, finden sich dennoch ähnliche Parolen wie bei den "Identitären". Wo verläuft die ideologische Grenze zwischen Aktivismus und einem Terroristen, der zu Gewalt greift?Die "Identitären" sind natürlich keine Terroristen wie der mutmaßliche Christchurch-Attentäter. Aber es ist auch nicht so einfach zu sagen: "Wir distanzieren uns und damit ist alles wieder gut." Denn Terrorismus geht immer ein gesellschaftlicher Diskurs voraus, der ihn legitimiert. Gerade die "Identitären" haben sehr hart daran gearbeitet, dass wir einen gesellschaftlichen Diskurs haben, der religiöse Minderheiten marginalisiert und stigmatisiert. Dann kann man sich nicht aus der Pflicht nehmen. Denn das, was sie propagieren, ist Rassismus. Wenn sie proklamieren, sie seien die letzte Generation, die den Untergang Europas verhindern könne, dann ist Gewalt sprachlich in diesem Narrativ vorhanden. Es gibt geistige Brandstifter und es gibt Menschen, die logische Schlüsse daraus ziehen. Man kann nicht davon reden, sich verteidigen zu müssen, weil Europa sonst untergeht und dann naiv glauben, dass das niemand ernst nimmt und danach handelt.
Wie können Sie sich den Europabezug einer gewisserweise nationalistischen Bewegung wie der "Identitären" erklären?
Sie haben einen sehr positiven Bezug zu Europa, weil es laut ihrem Verständnis ständig von außen bedroht ist: vom Islam oder Flüchtlingen zum Beispiel. Deswegen ist "Defend Europe" eine ihrer Parolen. Dieser positive Europabezug ist gar nicht so neu. Wir kennen ihn auch vom britischen Faschismus, wie ihn der englische Politiker Oswald Mosley in den frühen 30er-Jahren propagierte. Die "Identitären" beziehen sich auf historische Vorbilder. Es ist eigentlich ein europäischer Nationalismus, den Sie propagieren.
Martin Sellner hat gestern in einem Youtube-Video angekündigt, ganz nach dem Motto "jetzt erst recht" weiter zu kämpfen. Soll man ihn weitermachen lassen?
Man muss verhindern, dass die "Identitären" ihr Ziel erreichen.
Wie verhindert man das?
Man muss gut aufpassen, welche Worte in unserer Sprache Platz finden. Als die "Identitären" vor drei bis vier Jahren den "großen Austausch" propagiert haben, haben sogar Medien ohne Erklärung, ohne Kommentierung, ohne Anführungszeichen vom "großen Austausch" geschrieben.

Natascha Strobl
Natascha Strobl lebt in Wien und forscht als Politikwissenschaftlerin zum Thema Rechtsextremismus. Die Motive der Identitären hat Strobl bereits 2014 im Buch „Die Identitären. Ein Handbuch zur zur Jugendbewegung der Neuen Rechten in Europa“ erklärt und analysiert. Auf ihrem Blog schmetterlingssammlung.net/ teilt sie regelmäßig Erkenntnisse, Analysen und Einschätzungen zu Rechtsextremismus und zur "Neuen Rechten".
Derselbe "große Austausch" auf den auch der mutmaßliche Christchurch-Terrorist Brenton T. in seinem Manifest Bezug nimmt...
Der "große Austausch" ist eigentlich ein Konzept des französischen Philosophen Renault Camus. Die "Identitären" haben das wieder aufgegriffen. Das was 2015 mit den Flüchtlingen passiert ist, ist in dieser Vorstellung Teil des "großen Austausches". Der mutmaßliche Attentäter hat den Begriff eigentlich von den "Identiären" übernommen, die ihn nach Erscheinen des Buches popularisiert und in Debatten gebracht haben.
Medien sollten also einfach nicht die Begriffe der "Identitären" unkommentiert übernehmen?
Ja, denn damit haben die "Identitären" schon gewonnen. Wir müssen darauf achten, wie wir Diskurse führen und welche Logiken sie beinhalten. Und natürlich ist es immer gefragt, gegen Rechtsextremismus aufzustehen. Wir müssen uns fragen: Wie gehen wir mit Gruppen um, die rassistisch oder rechtsextrem sind und die, die Demokratie abbauen wollen? Lassen wir sie teilhaben oder schließen wir sie vom Diskurs aus?
Manche fordern inzwischen eine Abkehr vom Credo, mit Rechten reden zu wollen. Sollen wir sie nun teilhaben lassen oder nicht?
Mit Rechten zu Reden ergibt keinen Sinn, da sie kein Interesse an einem konstruktiven Austausch von Argumenten und Ideen haben. Ihnen geht es darum, den Diskurs zu zerstören beziehungsweise zu bestimmen. Daher ist sinnvoller über sie statt mit ihnen zu reden.