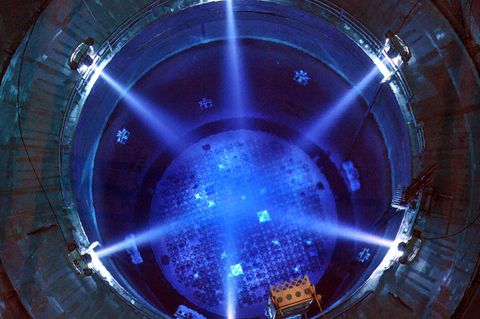Das EU-Statistikamt Eurostat feierte seinen 50.Geburtstag. Es war eine einzige große Heuchelgala. "Lasst uns alle Brüder werden!", schmetterte der Jubiläumschor. Vor dem Saal bedrohte derweil ein Eurostat-Direktor die wartenden Journalisten mit Verleumdungsklagen. Währungskommissar Pedro Solbes pries in seiner Festrede die "Hingabe" der Eurostat-Beamten. Er erwähnte mit keinem Wort, dass Pariser und Luxemburger Staatsanwälte längst in mehreren Fällen bei dem Statistikamt ermitteln, auch wegen des Verdachts einer "schwarzen Kasse", aus der sich Beamte womöglich bedienten.
Eurostat-Chef bietet Rücktritt an
Drei Tage später war die Partystimmung vorbei. Sowohl Eurostat-Chef Yves Franchet wie der Direktor Daniel Byk boten an, sich versetzen zu lassen. Angeblich taten sie, um den Ruf der Institution zu schützen. Aber tatsächlich war Kommissionspräsident Romano Prodi inzwischen selbst unter Druck angesichts der nicht endenden Serie von Medienberichten über Skandale bei Eurostat. "So geht es nicht weiter", bekannte ein Prodi-Vertrauter am Wochenende. Das ist ein erstaunlich später Sinneswandel, denn noch vor zwei Wochen pries Präsidentensprecher Reijo Kemppinen den Eurostat-Chef Franchet allen Ernstes als "proaktiv" agierenden Reformer. Jetzt stellt sich die Frage, warum Prodi erst so spät eingriff. Denn seit über drei Jahren liegen seinen Beamten mehrere alarmierende Prüfberichte über die Mißstände bei dem Statistikamt vor.
Betrug bei Eurostat - solche Schlagzeilen erschüttern eine der Schlüsselinstitutionen der Gemeinschaft. Denn die Zahlen der in Luxemburg ansässigen EU-Statistiker sind hochpolitisch. Sie dienen als Grundlage für Entscheidungen über Milliarden an Subventionen und sind die Basis für die Stabilität der gemeinsamen Währung Euro. Denn Eurostat prüft, ob die Mitgliedsstaaten ihre Haushaltsdefizite korrekt berechnen oder womöglich schummeln.
Problem bisher vernachlässigt
Umso erstaunlicher, dass die Affärenserie in der Luxemburger Kommissionsdienststelle Präsident Prodi lange erkennnbar wenig kümmerte. Bereits im Februar 2002 hatte der stern enthüllt, dass Eurostat Gegenstand mehrerer Untersuchungen des EU-Betrugsbekämpfungamtes Olaf ist. Prodi und Co. waren also eigentlich gewarnt. Ende 2002 hatte Olaf mindestens sechs Untersuchungen in Sachen Eurostat eröffnet. Und auch das ist seit Monaten öffentlich bekannt. Die Luxemburger Justiz ermittelt inzwischen in zwei dieser Fälle. Doch der Kommissionspräsident hatte bisher nach den Angaben seines Sprechers "nicht genügend Informationen", um selbst aktiv zu werden.
Das klingt wenig glaubwürdig. Tatsächlich liegen den Beamten von Haushalts-kommissarin Michaele Schreyer (Grüne) nach Informationen von stern.de schon seit drei Jahren mehrere Prüfberichte vor, in denen die schwerwiegendsten Vorwürfe bereits enthalten sind, inklusive der Fall der "schwarzen Kasse". Doch Prodi und Schreyer wollen jetzt glauben machen, sie selbst hätten diese Berichte bisher nicht zu Gesicht bekommen. Prodis Argument: Man habe auf Ergebnisse der Olaf-Untersuchungen gewartet. Und die wiederum hätten bisher auf sich warten gelassen. Die Behebung der Mißstände sei ja - so Kemppinen zu stern.de - nicht Schreyers "Verantwortung" gewesen. Wirklich? Folgt man Eurostat-Chef Franchet, war die aus Deutschland stammende Haushaltskommissarin sehr wohl informiert. "Sie hat alle Probleme gekannt", versicherte er jetzt in der ARD, Ja, "auch die Prüfberichte".
Bericht über Unregelmäßigkeiten lag vor
Soll heißen: Auch den Bericht im Fall Eurocost. Seit März 2000 lag der Schreyer unterstehenden Generaldirektion Finanzkontrolle ein Prüfreport zum Fall der von Franchets Eurostat finanzierten Gesellschaft "Eurocost Asbl" vor. Der Bericht enthüllte schwerwiegende Mißstände. In einem stern.de vorliegenden Brief an den Luxemburger Staatsanwalt Robert Biever zitiert die Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf am 4.Juli 2002 Belege für "zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Betrugsfälle". Olaf-Chef Franz-Hermann Brüner nannte "Doppel- und sogar Dreifachfinanzierung" von Projekten, Diebstahl von IT-Gerät und Büromöbeln sowie "Bilanzmanipulationen", um die "Betrügereien zu decken". Schlimmer noch: Eurostat habe dieses Vorgehen offenbar in "stillschweigenden Vereinbarungen" gedeckt.
Eurostat-Chef Franchet ist im Fall Eurocost längst persönlich im Visier der Ermittler. In seinem Brief an die Luxemburger Justiz im Juli 2002 sprach Brüner von einem möglichen "Interessenkonflikt": Als Eurostat-Chef verschaffte Franchet der Organisation Eurocost Millionensubventionen. Er war zugleich sieben Jahre lang deren Vizepräsident. Der Eurostat-Generaldirektor glänzte laut Brüner durch "regelmäßige Anwesenheit" bei den Eurocost-Generalversammlungen, die "alle" in Kommissionsgebäuden stattfanden.
Nicht persönlich profitiert
Franchet selbst will von den Zahlungen persönlich nicht profitiert haben. Doch sicher ist, dass der Steuerzahler verlor. Insgesamt kassierte Eurocost über 18 Millionen Euro für statistische Arbeiten, die inzwischen von einer anderen Firma für ein Drittel der Kosten erledigt werden. Immerhin eine Million Euro forderte die Kommission von Eurocost zurück - vergebens, denn die Gesellschaft ist in Liquidation.
Dass die Subventionen für Gesellschaften wie Eurocost eine problematische Sache darstellten, war den Eurostat-Beamten dabei seit vielen Jahren bewußt. Es gehe hier um "Praktiken, die wenig transparent und wenig offen für den Wettbewerb" seien, konstatierte der Eurostat-Mann François de Geuser schon im Juni 1995 in einem internen Brief. Doch noch zwei Jahre später am 3.Februar 1997 mahnte Eurostat-Direktor Alain Chantraine, die Haushaltsausführung dürfe keinesfalls "die Aktivitäten der durch Eurostat subventionierten Vereine in Schwierigkeiten bringen (Deba, CESD, Eurocost, TES)."
EU-Kommissare waren informiert über Vorzugsbehandlung
Auch die Kommissare in Brüssel können nicht behaupten, sie hätten nichts gewußt. Schon im Januar 1997 informierte der Eurostat-Beamte Michel Thierry im Namen einer Beamtengewerkschaft den finnischen Kommissar Erkki Liikanen (heute für Industrie, damals für Verwaltung zuständig), im Detail über "quasi systematische Praktiken" von Betrug und Mißwirtschaft bei dem Statistikamt und über die "Vorzugsbehandlung" für Institute wie Eurocost. Während die Kommission jede unzulässige Beihilfe in den Mitgliedsstaaten unnachgiebig verfolgt, durften Franchet und seine Kollegen offenbar trotzdem weiter aktiv den Wettbewerb verzerren. Die Gesellschaft CESD mit ihren heute 65 Mitarbeitern war dabei neben Eurocost einer der Hauptprofiteure - sie zählte bis 1997 ebenfalls Franchet als aktives Mitglied.
Schlechte Arbeit und Geldverschwendung
Der Befund auch bei CESD: Schlechte Arbeit und verschwendete Gelder. Auch diese Gesellschaft mußte unlängst in Folge einer Überprüfung eine Million Euro zurückzahlen. Und sie fiel ebenfalls wegen schludriger Arbeit auf. Am 15.Mai 2000 übte ein Eurostat-Experte in einem internen Papier massive Kritik an der Art und Weise, wie CESD Daten über den Handel zwischen EU und China bearbeitete. Die Gesellschaft zeige ein "ungenügendes Verständnis des Projekts", sie habe keinen "echten Informatiker" eingesetzt - und man beklage eine "beunruhigende Verspätung".
Auch bei CESD war Eurostat durch die Mitgliedschaft von Franchet und anderen hohe Beamten indirekt beteiligt. Trotzdem fehlte es offenbar an der nötigen Kontrolle. Das niederländische nationale Statistikamt CSB zog sich darum von der Mitarbeit bei der Organisation wieder zurück. "CBS-Mitarbeiter können nicht CESD-Mitglieder sein", sagte ein CBS-Sprecher zu stern.de. Die "Rechtskonstruktion" von CESD sei "nicht akzeptabel". Wenn schon EU-Kommission und Re-gierungen derartige Organisationen unterhielten, sollten sie in der Lage sein, "wirksam zu kontrollieren". Doch das sei hier nicht der Fall.
Falsche Angaben
Personalkommissar Neil Kinnock kennt seit langem einen weiteren Auditbericht vom Dezember 2000. Der betrifft die Firma Eurogramme. Und die machte wiederholt krass falsche Angaben über ihren Umsatz und ihr Personal. Den Eurostat-Beamten war das spätestens seit Juni 1999 aus einem Bericht der EU-Finanzkontrolle bekannt. Trotzdem ergatterte die Firma insgesamt über 70 Aufträge im Wert von mehr als sieben Millionen Euro.
Eurogramme-Besitzer Edward Ojo habe "keine betrügerischen Absichten"« gehabt, versuchte Währungskommissar Pedro Solbes noch im Februar den Europaabge-ordneten im Haushaltskontrollausschuß weis zu machen. Das war ein offenkundiger Fall von Irreführung des Parlamentes. Solbes oder zumindest seine Mitarbeiter müssen es besser gewußt haben. Denn schon am 7.Juni 1999 hatten Kommissionskontrolleure die Eurogramme-Manipulationen schriftlich dokumentiert - etwa in einem Fall, in dem Eurogramme neun Lebensläufe von Experten einreichte, von denen sieben gar nicht zu Ojos Unternehmen, sondern in Wahrheit "zu einer anderen Gesellschaft gehörten". Keine betrügerische Absicht?
"Betrügerische Manöver"
"Wissentlich" habe Eurogramme "betrügerische Manöver" benutzt, um Aufträge zu erlangen, fasste Olaf-Chef Brüner seine Erkenntnisse im Juli 2002 in einem Schreiben an die Luxemburger Justiz zusammen, das stern.de vorliegt. Die Firma, so Brüner, "täuschte die Kommission" indem sie glauben machte, "hochspezialisierte Experten" würden Arbeiten ausführen. Eurogramme gewann gegen andere (ehrliche) Bewerber mit der Zusicherung, Experten zu einem niedrigen Preis zu vermitteln. In Wahrheit wurde die Arbeit dann von "Studenten" erledigt, die als "Praktikanten" angestellt waren.
Franchet waren diese Tricksereien seit Jahren bekannt. Er bezeichnete die Karriere von Eurogramme-Chef Edward Ojo trotzdem noch im vergangenen Jahr als "Erfolgsstory". Dass die Eurostat-Bosse die Ojo-Manipulationen wissentlich duldeten, ist wiederum Prodi und seinen Kommissare spätestens seit Mai vergangenen Jahres kein Geheimnis mehr, als stern.de und andere Medien über den Fall berichteten. Doch die Kommissare tolerierten diese Praktiken und verteidigten sie öffentlich.
Verdacht der Bestechung
Personalkommissar Kinnock wies sogar die Beschwerde der Eurostat-Beamtin Dorte Schmidt-Brown ab, die sich von ihren Vorgesetzten gemobbt fühlte, nachdem sie überhöhte Zahlungen an Eurogramme versucht hatte zu verhindern. Weitere Vorwürfe sind ebenfalls längst kein Geheimnis mehr: Olaf geht auch der Möglichkeit nach, dass Eurostat-Beamte sich bestechen ließen. Es gebe den Verdacht der "möglichen Bestechung" eines Eurostat-Offiziellen, so Olaf-Chef Brüner am 12.Juni 2002 in einer internen Note an Prodis Generalsekretär David O’Sullivan. Hatte O’Sullivan davon Prodi bisher nichts erzählt? Auch nicht, nachdem der stern im September 2002 über den Vorgang berichtete?
Plünderung des EU-Haushalts
Und jetzt schließlich der Fall der »Schwarzen Kasse«: Auch der ist den Beamten von Kommissarin Schreyer seit März 2000 bekannt. In einem Brief an die Pariser Staatsanwaltschaft spricht Olaf-Chef Brüner von einer "groß angelegten Operation der Plünderung" des EU-Haushalts. Franchet und Direktor Byk sollen ein "System" geschaffen haben, bei dem Einnahmen aus dem Verkauf von Eurostat-Publikationen nicht ins Gemeinschaftsbudget flossen, sondern außerhalb der Bücher auf einem Bankkonto der Sparkasse Luxemburg gebunkert wurden. Es gebe "keinerlei" Beweise für eine "persönliche Bereicherung", versicherte Franchet dieser Tage in einer Mitteilung an sein Personal. Aber die französische Justiz verfolgt nach Angaben einer Sprecherin auch den von Olaf aufgeworfenen Verdacht, dass sich Beamte "persönliche Ausgaben" illegal finanzieren ließen.
Überall sonst denn in Brüssel wäre ein Behördenchef nach solchen Anschuldigungen längst untragbar, glaubt die CSU-Europaabgeordnete und Haushaltsexpertin Gabriele Stauner. Noch bei Amtsantritt hatte auch Personalkommissar Neil Kin-nock versprochen, Kommissionsmitarbeiter während laufenden Untersuchungen zu versetzen, wenn anders der Ermittlungserfolg gefährdet sei und ein "Minimum an Beweisen" vorliege. Den Eurostat-Chef Yves Franchet hielten Kinnock und Prodi trotzdem bis heute im Amt. Dies, obwohl er seinen Posten bereits 15 Jahre ausfüllt und Kinnock eigentlich versprochen hatte, alle Spitzenbeamten nach sieben Jahren auf neue Posten rotieren zu lassen.
Kein Wunder, dass sich Europaabgeordnete wundern, warum Franchet so lange solche Protektion genoß. Kann es wirklich sein, dass Prodi und Co. bis jetzt nicht erkannt haben, wie brisant die Vorwürfe gegen das Statistikamt sind? Oder hat Franchet geheime Verdienste, für die er jetzt belohnt wird? Längst fragen Europaabgeordnete wie Stauner, ob es stimme, dass der Eurostat-Generaldirektor Kenntnis von fragwürdigen statistischen "Schönheitsoperationen" im Zusammenhang mit der Einführung des Euro hat und dass dieses Wissen ihn für die Kommission "unantastbar macht"?
Operation France Télécom
Tatsächlich erwies Franchet im Jahr 1996 der französischen Regierung einen enormen Dienst. Ohne das Fachvotum eines Ausschusses mit Statistikern und Zentralbankern der Mitgliedsstaaten abzuwarten und gegen den Rat der Vertreter aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden, genehmigte der französische Beamte der französischen Regierung eine umstrittene Operation: France Télécom verkaufte Pensionsverpflichtungen in Höhe von 37,5 Millarden Francs (über fünf Milliarden Euro) an den Staat, der diese Summe als Defizitminderung verbuchte, obwohl er damit für alle Zukunft die Kosten der Altersversorgung der Telecom-Mitarbeiter übernahm. Ohne diese Operation hätte Frankreich keine Aussicht besessen, die Kriterien des Vertrags von Maastricht zu erfüllen. Statt eines Defizits von 3,0 Prozent der Wirtschaftsleistung wären es 3,5 Prozent gewesen.
Übrigens hat der damalige italienische Regierungschef ebenfalls allen Grund, Franchet dankbar zu sein. Nach der Operation "France Télécom" genehmigten die EU-Statistiker nämlich auch mehrere bilanzverschönernde Maßnahmen, die sich die Regierung in Rom erdacht hatte, um den Beitritt zum Euro-Club zu schaffen. "Wenn die Franzosen damit durchkommen, können wir ihnen auch ein oder zwei Tricks zeigen"«, argumentierte der damalige italienische Regent – kichernd - in einem Interview mit der "Financial Times". Sein Name: Romano Prodi. Seine heutige Funktion: Präsident der EU-Kommission.