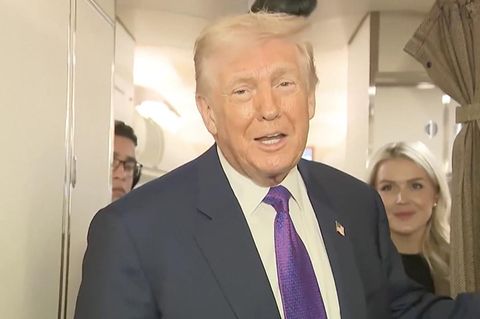Mit markigen Worten hat US-Präsident Barack Obama den libyschen Machthaber Muammar Gaddafi zum Rücktritt aufgefordert. Doch Zweifel sind angebracht, ob Obama auch so starke Taten folgen lassen kann, dass sie den nordafrikanischen Autokraten aus dem Amt treiben werden. Der nach wie vor mächtigste Mann der Welt läuft Gefahr, unabhängig von seinem Tun nur Fehler begehen zu können. Ganz gleich, ob er ein Flugverbot über Libyen verhängt oder die Gaddafi-Gegner bewaffnet - keine Option garantiert, dass der Herrscher von Tripolis stürzt oder die Stabilität in Nordafrika wiederhergestellt wird.
"Was immer getan wird, die Risiken sind groß", beschreibt Stephen Grand von der Brookings Institution das Dilemma Obamas. "Man kann sich nicht einfach in einen Bürgerkrieg einmischen, und dann erwarten, ihn dadurch schon zu beenden. Aber Nichtstun ist auch keine brauchbare Alternative." Obamas Berater haben dessen vorsichtigen Kurs mit dem Ziel begründet, die internationale Opposition gegen Gaddafi zu einen. Seine vornehmlich republikanischen Gegner werfen ihm Führungsschwäche vor und befürchten, der Präsident könne die Chance vergeben, sich eines jahrzehntelangen Gegners der Vereinigten Staaten zu entledigen.
Doch die Kosten einer jeden Art von Intervention können für einen um seine Wiederwahl bemühten Präsidenten unkalkulierbar hoch werden. Dies umso mehr, als Obama versprochen hat, die Kriege in Afghanistan sowie im Irak zu beenden und die heimische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Zudem darf er die ölreichen Länder im Nahen Osten nicht verärgern und auch die Beziehungen zu den Europäern nicht aufs Spiel setzen. Die Entwicklung in Libyen kann zudem Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, das Ansehen der USA und das außenpolitische Erbe des Präsidenten haben.
"Der Präsident hat einen großen Fehler gemacht, als er Gaddafis Rücktritt forderte, ohne zu wissen, wie er ihn erreichen kann", kritisiert Elliott Abrams, der unter Obamas Vorgänger George W. Bush stellvertretender Sicherheitsberater war. "Das entwertet das Wort des amerikanischen Präsidenten."
Selbst in den Reihen seiner Demokratischen Partei sind Forderungen nach einer aggressiveren Libyen-Politik Obamas laut geworden. Präsidialamtssprecher Jay Carney räumte Anfang der Woche zwar eine gewisse Dringlichkeit ein, mahnte aber zur Zurückhaltung. Die Regierung will sich auf keinen Fall zu Entscheidungen drängen lassen, die die Vereinigten Staaten in einen Krieg verwickeln könnte. Das Dilemma: Je länger Obama zögert, desto mehr Menschen kommen in Libyen zu Tode. Kritiker könnten ihm angesichts einer zu erwartenden Katastrophe Zaudern vorwerfen. Schließlich könnte der ohnehin schon hohe Ölpreis auf neue Rekordhöhen schießen.
Auch wenn die US-Regierung sich nach offizieller Lesart alle Optionen offenhält, sind ihre Möglichkeiten begrenzt. Die Begeisterung für eine Flugverbotszone hält sich unter Obamas Ministern in Grenzen. Die Entsendung von Bodentruppen scheint angesichts der Absicht des Präsidenten, aus Afghanistan und dem Irak abzuziehen, unwahrscheinlich. So setzen die USA auf die Hoffnung, dass das libysche Volk stark genug sein wird, Gaddafi zu verjagen. Doch der schlägt derzeit mit großer Gewalt zurück.