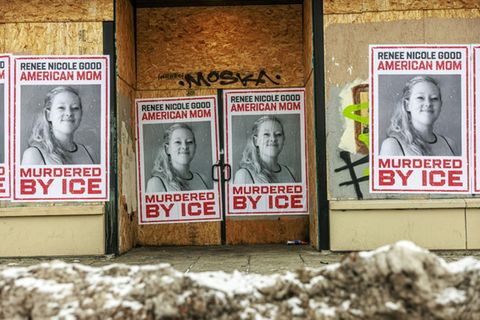Der Stolz über den gelungen Coup war Nicolas Sarkozy anzusehen: Strahlend trat er am Dienstag um 10.00 Uhr vor die Presse, um nach einer durchtelefonierten Nacht den Durchbruch zu erläutern. "Ein langer Leidensweg ist vorüber", sagte der französische Staatspräsident. Und seine Frau Cécilia, fügte er mit einem Lächeln hinzu, habe eine "absolut bemerkenswerte Arbeit gemacht". Eine Stunde zuvor waren die fünf bulgarischen Krankenschwestern und der Arzt palästinensischer Abstammung, die seit mehr als acht Jahren in einem libyschen Gefängnis saßen, in einer französischen Maschine in Sofia gelandet. Mit an Bord: Cécilia Sarkozy, die am Sonntag nach Tripolis geflogen war und sich in die Verhandlungen über die Freilassung eingeschaltet hatte. Ihr Legitimation: "Keine", wie das französische Blatt "Dernières Nouvelles d'Alsace" urteilte.
Als "Sarkozy-Schau" hatten die französischen Sozialisten die Initiative vorab gebrandmarkt. Und tatsächlich war von dem Präsidentenpaar am Dienstag mehr die Rede als von den befreiten Bulgarinnen. Natürlich ist es Sarkozy bravourös gelungen, eine Gelegenheit zur Profilierung zu nutzen. Und diesmal nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Gattin, die zuletzt wegen einer Kreditkartenaffäre für Schlagzeilen gesorgt hatte und über deren Rolle sich in Paris niemand im Klaren war. Offenkundig ist aber auch, dass Sarkozy durch hohes Risiko, Einfallsreichtum und Verhandlungsgeschick dafür gesorgt hat, dass die Freilassung beschleunigt wird. Doch die Vorarbeit hatten andere geleistet: Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier und die österreischische EU-Außenkommissarein Benita Ferrero-Waldner.
Seit mehr als drei Jahren bemühte sich die EU um die Lösung des Dramas, das 1998 begann, als 438 Kinder in einem Krankenhaus in Bengasi mit dem HI-Virus infiziert wurden und die ausländischen Pflegerinnen dafür verantwortlich gemacht wurden. So reiste Steinmeier Mitte November als Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft nach Libyen und bereitete den Deal vor.
Herzstück des Deals schon lange eingefädelt
Dafür wurden von der EU unter anderem 9,5 Millionen Euro für das Kinderkrankenhaus in Bengasi gezahlt. Hauptbestandteil des von langer Hand vorbereiteten Deals war die Einrichtung eines "Bengasi-Fonds", aus dem die Familien der infizierten Kinder entschädigt werden sollen. Eine Million Dollar fließt pro Kind - zumindest wurde diese Summe in Libyen kolportiert. Woher der Löwenanteil dieser Millionen kommt, blieb offen: Bulgarien steuerte angeblich 44 Millionen Dollar bei - in Form eines Schuldenerlasses. 74 Millionen Dollar kamen nach Informationen von "Spiegel Online" von Libyen selbst, von der EU kamen zweckgebunden die 9,5 Millionen für das Krankenhaus. Nicht nur Insider vermuten, dass für den Rest der Emir von Katar gerade steht.
Eine weitere Hürde zur Freiheit für die Bulgarinnen war genommen, als der Oberste Richterrat Libyens vergangene Woche das Todesurteil in eine lebenslange Haftstrafe umwandelte.
Cécilia Sarkozy in der Höhle des Löwen
Doch dann schlugen die Stunden der Sarkozys. Cécilia war bereits am 12. Juli zu einem ersten Treffen mit dem libyschen Staatschef Muammar Gaddafi nach Tripolis gereist. Dass Frankreichs Präsident seine Frau in die Höhle des Löwen schickte, hat die libysche Seite deutlich aufgewertet. Der zweite Schachzug war die Einbeziehung Katars. Am 14. Juli war der Emir Scheich Hamad bin Chalifa al Thani zum Nationalfeiertag nach Paris gekommen. Sarkozy konnte ihn offenbar für eine entscheidende Vermittlerrolle gewinnen.
EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso sagte am Dienstag, Katar habe "einen zusätzlichen humanitären Beitrag an Libyen" geleistet, der "von großer Bedeutung" gewesen sei. Es steht außer Frage, dass Nicolas und Cécilia Sarkozy die letzte Etappe des Dramas gekonnt medial inszeniert haben. Dazu gehörte, dass sich die Präsidentinnengattin im Hintergrund hielt, als die freigelassenen Krankenschwestern in Sofia das Flugzeug verließen. Nun werden die beiden wohl die Früchte eines Verhandlungsprozesses ernten, der auf eine Lösung zusteuerte.
Beginn einer neuen Libyen-Politik
"Aber hinter Sarkozys Initiative steht die völlig ernstzunehmende Anstrengung, eine dynamischere Politik mit Libyen zu ermöglichen", sagt Frankreichexperte Frank Baasner vom Deutsch-französischen Institut. Wenn es gelänge, den einstigen Outlaw Gaddafi zu erreichen, sei dies von Bedeutung für die ganze EU. Gaddafi hatte am späten Montagabend noch einmal eine Reihe Forderungen gestellt: Abkommen über den Bau einer Autobahn und einer Eisenbahnlinie quer durch das nordafrikanische Land, eine Wiederanerkennung der archäologischen Stätten. Über konkrete Zusagen äußerte sich Sarkozy am Dienstag nicht, betonte aber: "Wir werden Libyen bestimmt nicht für seine Entscheidung bestrafen."
Sichtbarstes Zeichen: Am Mittwoch wird er in den Wüstenstaat reisen. Das selbst erklärte Ziel: Libyen bei der Wiedereingliederung in die Gemeinschaft der Nationen zu helfen. Ein weiteres Ziel hat Sarkozy mit seiner Strategie schon erreicht. "Im Grunde gilt meine einzige Sorge Cécilia", sagte der Präsident am 14. Juli zu Journalisten. Er meinte die Frage, welche Rolle die energische Frau mit den grünen Augen und dem sibyllinischen Lächeln an seiner Seite spielen könnte. Das Tragen von Gucci-Kleidern und Einladungen zum Mittagessen reichten ihr nicht aus. Nun hat sie die heikelste Mission zum Erfolg geführt, die je einer französischen First Lady anvertraut worden ist.
Auf dem Weg zur "Außenministerin der Herzen"
Ist sie auf dem Weg zu einer "Außenministerin der Herzen"? Der dem Präsidentenpaar wohlgesonnene "Le Figaro" zieht schon den Vergleich zu Prinzessin Diana, die ihre Popularität in den 90er Jahren im Kampf gegen die größten menschlichen Tragödien einsetzte. Am Dienstag hatte Cécilia Sarkozy allerdings genug von ihrem ersten Auftrag. Es sei eine "große Freude, die bulgarischen Krankenschwestern nach Hause bringen zu können", sagte sie in einem kurzen Fernsehinterview. Nun sei sie vor allem todmüde.