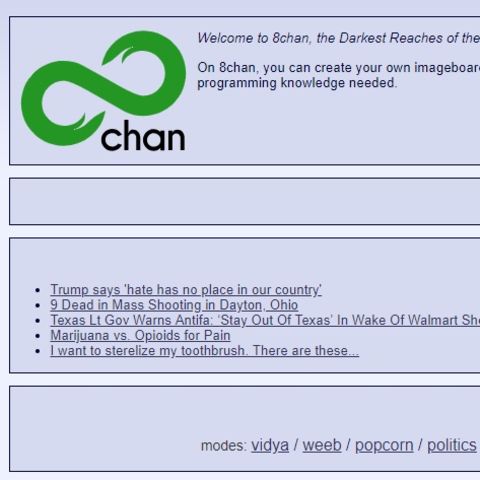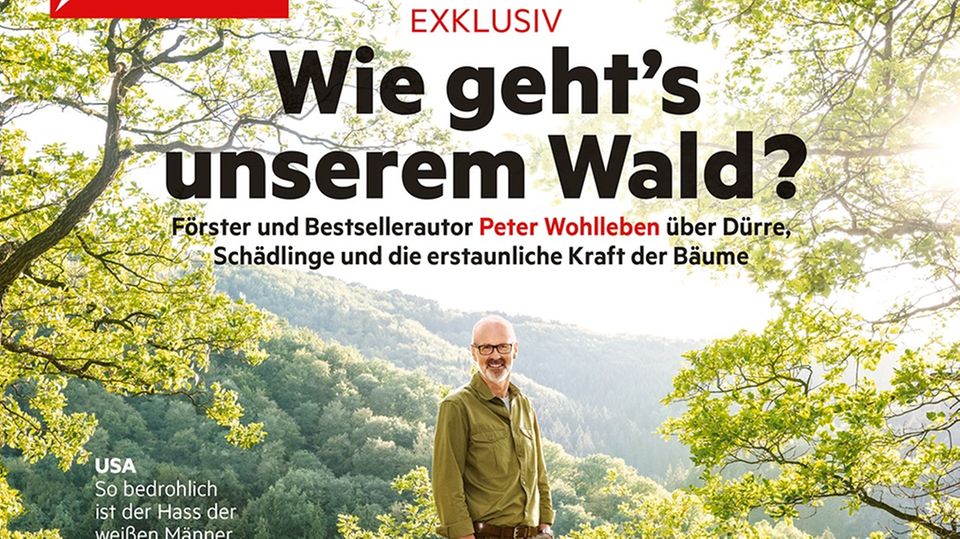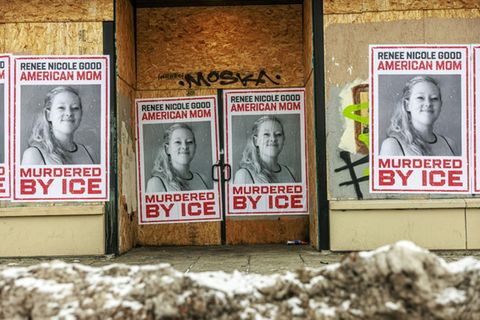Es wird alles noch schlimmer kommen, sagt der Mann, der sich nur allzu gut mit dem Hass dieser weißen Männer auskennt, die sich im Rassenkampf wähnen.
Mit ihrem Hass auf die Mexikaner, von denen sie glauben, dass sie den Weißen die Arbeit wegnehmen und die Ehre. Auf die Schwarzen und die Juden, auf all jene, von denen sie glauben, dass sie darauf hinarbeiten, die Bevölkerung auszutauschen, um die weiße Vorherrschaft zu brechen und damit die amerikanische Zivilisation zu zerstören. Mit diesem abgrundtiefen Hass, an dem sie sich in ihren Allmachtsfantasien berauschen. In denen sie sich als Märtyrer aufspielen und doch nichts anderes als feige Mörder bleiben, wenn sie Kinder in Supermärkten erschießen, Synagogenbesucher niedermetzeln und Kirchen anzünden, in denen sich eine schwarze Gemeinde zum Gottesdienst versammelt hat.
"White supremacist“ in El Paso
Er habe schon lange vor einer Welle rechten Terrors gewarnt, doch niemand habe auf ihn hören wollen, sagt Christian Picciolini.
Picciolini weiß, wie sich der Hass dieser weißen Männer anfühlt. Er hat ihn selbst einmal empfunden. Er macht ihm heute große Angst.
Jahrelang war er Anführer der bekanntesten Neonazi-Skinheadgruppe in den USA, auf seinem Arm prangten Runen-Tattoos, auf seiner Jacke ein Hakenkreuz. Hass war sein Antrieb, einmal schlug er mit seinen Männern einen Schwarzen fast tot. Nun kämpft er gegen diesen Hass und hilft Aussteigern aus der Szene.
Gestern war er in New York, jetzt ist er kurz zu Hause in Chicago, doch er ist schon wieder auf dem Sprung, es gibt viel zu tun für ihn in diesen Tagen. Nachdem am 3. August ein 21-Jähriger in einem Supermarkt in El Paso um sich schoss und 22 Menschen ermordete, erreichen ihn jede Woche Hunderte E-Mails, die meisten von Eltern, die sich sorgen, ihr Sohn könne einmal dem Schützen von El Paso nachfolgen wollen. Sie bitten Picciolini, mit ihren entglittenen Kindern zu reden.
Der Schütze von El Paso hinterließ ein rassistisches Manifest im Internet, in dem er sich als Kämpfer gegen eine "hispanische Invasion“ stilisierte. Mit ihm drängt sich ein Typus des Terroristen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, dem allzu lange nur Experten wie Picciolini Aufmerksamkeit geschenkt hatten: Er ist weiß, rechts, nationalistisch und rassistisch. "Eltern schreiben mir nun, ihre Söhne trieben sich in rechtsradikalen Internetforen herum, sprächen von minderwertigen Rassen oder verteidigten gar den Täter von El Paso“, sagt er. "Die Gefahr von Nachahmungstätern, die in einem perversen Wettbewerb noch mehr Menschen in den Tod reißen wollen, ist groß.“

Terrorismus galt in den Vereinigten Staaten seit dem 11. September 2001 als gleichbedeutend mit Al-Qaida und später dem IS, mit islamistischem Terrorismus von außen. Das Attentat eines "white supremacist“ in El Paso, eines Rechtsterroristen aus dem Innersten Amerikas, es hat die Öffentlichkeit endlich aufschrecken lassen.
Dabei sind "white supremacists“ schon seit Jahren das Gesicht des Terrors in den USA. Unter ihnen versteht man hier eine fragmentierte und gleichzeitig über das Internet eng vernetzte, wachsende Szene von Neonazis, Skinheads, Antisemiten, traditionellen Rassisten wie dem Ku-Klux-Klan und neuen, jugendorientierten Rechtsradikalen in Sneakers. Gemeinsam ist ihnen die Wahnvorstellung, die weiße Rasse stehe vor der Auslöschung durch eine Flut farbiger Menschen, die von Juden kontrolliert und manipuliert würden. Fast jedes Mittel in diesem herbeifantasierten Rassenkrieg ist diesen "white supremacists“ recht.
Globale Armee von Schläfern
Allein in den vergangenen 18 Monaten ermordeten "white supremacists“ 65 Menschen. Zu den Opfern zählen elf Gläubige, die ein Attentäter erschoss, als sie sich in einer Synagoge in Pittsburgh zum Gebet versammelt hatten. Eine schwarze Frau, die ein Rassist in Kansas erstach; er hatte schon vorher regelrecht Jagd auf Afroamerikaner gemacht. Ein homosexueller Jude, den ein Mitglied der Neonazi-Gruppe "Atomwaffen Division“ in Kalifornien 20-mal in Gesicht und Hals stach, ehe er ihn verscharrte.
Nach dem 11. September 2001 waren rechte Extremisten für dreimal so viele Attentate auf amerikanischem Boden verantwortlich wie Islamisten. Erst im Juli hatte FBI-Direktor Christopher Wray dem Kongress berichtet, dass der größte Teil der Terror-Ermittlungen seiner Behörde mit rassistisch motivierten Anschlägen zu tun habe.

Rechter Terrorismus ist ein inter-nationales Phänomen, die Spur seiner mörderischen Attentate reicht von Neuseeland bis Norwegen. "In den vergangenen Jahren hat sich – ähnlich wie beim islamischen Terrorismus – eine globale Armee von Schläfern formiert. Die Extremisten müssen sich nicht zwingend gegenseitig kennen und haben auch keinen globalen Anführer. Aber sie wähnen sich alle gleichsam im gemeinsamen Kampf für die weiße Rasse, sind über das Internet vernetzt und radikalisieren sich zunehmend. Doch in den USA, einem Land, dessen Einwohner mehr Waffen pro Kopf besitzen als in jedem anderen Land auf der Welt, ist der rechte Terrorismus besonders gefährlich“, sagt Christian Fuchs, Rechtsextremismus-Experte und Autor des Buches "Das Netzwerk der Neuen Rechten“. Zudem, so Fuchs, bekämen sie Legitimation und Inspiration für ihre Ideologie von höchster Stelle – vom Präsidenten persönlich.
"In meiner Neonazi-Zeit hätte ich mir solch einen Präsidenten gewünscht“, sagt Ex-Neonazi Picciolini. "Donald Trump bezeichnet Immigranten als Tiere und Invasoren. Vieles, was ich aus seinem Mund höre, habe ich selbst damals gesagt. Anfang der 90er Jahre habe ich mit genau diesen Worten einen menschenverachtenden Song auf einem Skinhead-Konzert in Weimar gegrölt. Wenn ein Präsident farbige Menschen als Feinde brandmarkt, befeuert er Rassisten in ihrem Tun.“
Das Wiedererstarken des rechten Extremismus in den Vereinigten Staaten nahm seinen Anfang 2008, nach der Wahl Barack Obamas, des ersten schwarzen Präsidenten. "Es begann nicht zufällig gerade in dieser Zeit, in der gesellschaftliche Privilegien nicht mehr automatisch qua Geschlecht, Hautfarbe oder Religion zu gelten schienen“, sagt Experte Christian Fuchs. "Diese Entwicklungen schürten ein Bedrohungsgefühl in rechten Kreisen, Vorstellungen von einer Auslöschung der eigenen Kultur machten sich breit.“
Timothy McVeigh
Am 4. April 2009 erschoss ein rechter Extremist in Pittsburgh drei Polizisten. Der Täter sagte, er kämpfe gegen eine "jüdisch kontrollierte Weltregierung“. Daryl Johnson, der sich selbst als konservativen Republikaner bezeichnet, war zu jener Zeit führender Experte für inländischen Terrorismus im Heimatschutzministerium. "Ich habe damals vergebens vor der Gefahr von rechts gewarnt, es ist so frustrierend“, sagt Johnson heute am Telefon. "Ich fürchte, wir haben inzwischen einen Punkt erreicht, an dem wir mit dieser Art von Gewalt lange Zeit werden leben müssen.“

2009 verfasste er einen vertraulichen Bericht, nur für den internen Gebrauch gedacht. Titel: "Rechtsextremer Terrorismus. Gegenwärtiges ökonomisches und politisches Klima führt zu einem Wiederanstieg von Radikalisierung und Rekrutierung“. Johnson beschrieb in seinem neunseitigen Papier, wie die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten und die internationale Finanzkrise zu einem Anwachsen rechtsextremistischer Umtriebe geführt hatten. Er warnte davor, dass Rechtsextremisten versuchen könnten, gut ausgebildete Soldaten zu rekrutieren. Johnson verwies darauf, dass sich bereits nach dem ersten Irak-Krieg 1990/1991 Armeeveteranen rechten Gruppen angeschlossen hatten.
Unter ihnen war Timothy McVeigh, der 1995 ein Gebäude mehrerer Bundesbehörden in Oklahoma City in die Luft gesprengt und dabei 168 Menschen getötet hatte; es war der bis dahin schwerste Terroranschlag in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Republikaner tobten, als sie von Johnsons Bericht erfuhren, sie sahen in der Warnung vor rechtem Extremismus einen Angriff des Obama-Lagers auf ihre weiße Wählerbasis im konservativen Teil Amerikas. Der Bericht verschwand. Das Heimatschutzministerium konzentrierte sich fortan wieder voll und ganz auf den Kampf gegen den islamistischen Terror.
In dieser Zeit arbeitete ein Millionär schon seit einigen Jahren unermüdlich daran, eine rassistische politische Bewegung zu etablieren. William Regnery pumpte sein Geld in extremistische Organisationen, Magazine und Konferenzen. Regnery, heute 78, träumt von einem rein weißen Amerika, in dem Farbige und Juden nicht geduldet würden. Lange Zeit nahm kaum jemand Notiz von seinen rassistischen Vorstellungen und von der "Alt Right“-Bewegung, die er zusammen mit dem jungen Rassisten Richard Spencer ins Leben rief. Doch dann, im Jahr 2015, katapultierte sich Donald Trump auf die politische Bühne und erkannte in der Angst vieler Weißer sein Wahlprogramm. Er sprach von mit Drogen dealenden Mexikanern und einem Bann für Muslime, die in die USA einreisen wollten.
Donald Trump brachte schamlos die Agenda der "white supremacists“ auf die große politische Bühne. Regnery und Spencer waren elektrisiert. Die Rassisten machten Wahlkampf für Donald Trump. Sie lieferten ihm eine Basis. Und Trump lieferte ihnen zumindest in Teilen rassistische Politik und Rhetorik. Trump habe seine Bewegung legitimiert, erklärte Regnery einmal in einem seiner raren Interviews. Von nun an habe man über weißen Nationalismus nicht mehr nur heimlich im Badezimmer sprechen können, von nun an sei er ein Thema für die gute Stube geworden. Und in diese gelangt er heute auch über die Fernsehschirme. Moderatoren wie Tucker Carlson von Donald Trumps rechtspopulistischem Haussender Fox News unterfüttern die rassistischen Erzählungen, sie sprechen von Migranten als Eindringlingen, die das Land vermüllen und schmutziger machen. Trump wiederum greift diese Hetze nicht nur auf, sondern befeuert sie mit kalkulierten Tabubrüchen.
"8chan“
So ist eine Spirale der Radikalisierung entstanden, und Trump wird sie nicht stoppen, denn der Rassismus soll ihm die Wiederwahl sichern. Die "New York Times“ enthüllte vor Kurzem, dass sein Wahlkampfteam eine Facebook-Kampagne durchführt, die die Gefahr einer "Invasion“ Amerikas durch Immigranten heraufbeschwört. Trump ebnet den Weg des offenen Rassismus in den Mainstream.

"Als ich in den 90er Jahren in der rechtsextremen Bewegung war, waren wir ziemlich isoliert von der Gesellschaft. Heutige Extremisten fühlen sich bestätigt, ihre Angst vor dem Niedergang der Weißen findet Gehör in der Republikanischen Partei“, sagt Picciolini. Wenn er heute mit Männern redet, erzählen sie ihm, wie erhebend es sich anfühle, im Internet ein ganzes Netzwerk von Gleichgesinnten gefunden zu haben. "Das Internet liefert ihnen ein 24 Stunden geöffnetes Büfett des Hasses, sie stacheln sich zu immer extremeren Drohungen an. Es ist falsch, die Terroristen als einsame Wölfe, als Einzeltäter zu bezeichnen. Sie haben als Einzelkämpfer angefangen, sind aber längst Teil eines größeren, radikalen Ökosystems.“
Zu diesem Ökosystem gehören Hass-Clips auf Youtube und Posts in sozialen Netzwerken, geschützt durch die US-Verfassung, die selbst Hassbotschaften unter den Schutz der Meinungsfreiheit stellt. So erreicht die Hetze von Extremistenorganisationen unzensiert ihre Zielgruppe. Das "National Socialist Movement“ kann zur Gewalt gegen Juden und Minderheiten aufrufen, um die "Union aller Weißen in einem Großamerika zu erreichen“. Die "League of the South“ kann für einen zweiten Bürgerkrieg und die Abspaltung des Südens werben und für eine Herrschaft der europäischen Amerikaner. Und die "Atomwaffen Division“ kann ungehindert eine gewaltsame Revolution propagieren, die in einer nationalsozialistischen Diktatur und dem endgültigen "arischen Sieg“ enden solle.
Der ehemalige FBI-Agent und Antiterror-Experte Clint Watts fordert deshalb ein konzertiertes Vorgehen der Ermittlungsbehörden, um Gefährder im Netz aufzuspüren. Orientieren könne man sich beim Kampf gegen rechten Terror an dem Apparat, der im Kampf gegen den islamistischen Terror aufgebaut wurde. "So wie Al-Qaida speisen sich die rechtsextremen Bewegungen aus der Wut entfremdeter junger Männer mit wenig sozialen Kontakten und Selbstwertgefühl. Auch sie sind darauf angewiesen, ihre Mitglieder über das Internet zu radikalisieren.“ Es brauche deshalb ein Zentrum, das die Umtriebe der Rechtsextremen im Internet so eng überwache, wie es bei den Islamisten geschieht.

Noch können sie sich beinahe ungestört austoben in den dunklen Ecken des Internets. Auf Portalen wie "8chan“ kursierte kurz nach dem Attentat von El Paso eine Liste von Anschlägen. Darauf waren Datum, Ort, Anzahl der Opfer vermerkt. Der Norweger Anders Breivik, der 2011 77 Menschen ermordete, führte die Liste an, gefolgt von Dylann Roof, der 2015 neun schwarze Gläubige in einer Kirche in Charleston erschoss, auf "8chan“ werden sie als Märtyrer verehrt. Der Name des Schützen von El Paso fand sich am Ende der Liste. "Sie hetzen sich gegenseitig auf. Ich fürchte, es wird nicht lange dauern, bis jemand versucht, seinen Namen auf die Liste dieser Terroristen zu setzen“, sagt Aussteiger Picciolini. "Je näher die Präsidentschaftswahlen 2020 rücken, desto wahrscheinlicher wird es.“
"Atomwaffen Division“
Am 8. August, fünf Tage nach dem Attentat von El Paso, verhaftete das FBI einen 23-jährigen Mann in Las Vegas. In seinem Schlafzimmer hatten die Agenten Bauteile für eine Bombe gefunden, ein Schnellfeuergewehr und ein Jagdgewehr. Der Verdächtige ist Mitglied der "Atomwaffen Division“ und hatte versucht, einen Obdachlosen anzuheuern, um eine Synagoge auszukundschaften; das sollte ein Attentat auf die Gläubigen vorbereiten. Das FBI fand zudem Pläne, in denen der Mann skizzierte, wie er mit zwei Kommandos einen Massenmord an den Besuchern einer Homosexuellen-Bar verüben wollte.
Am selben Tag wurde ein Beamter im Außenministerium in Washington beurlaubt. Aktivisten hatten recherchiert, dass er die Ortsgruppe einer Rassisten-Organisation leitete. In einem Podcast hatte er schwadroniert: "Wir brauchen ein Land für Weiße mit atomaren Abschreckungswaffen. Und dann wird man sehen, wie die Welt zittert."
Diese Reportage erschien zuerst im stern Nr. 35/2019.