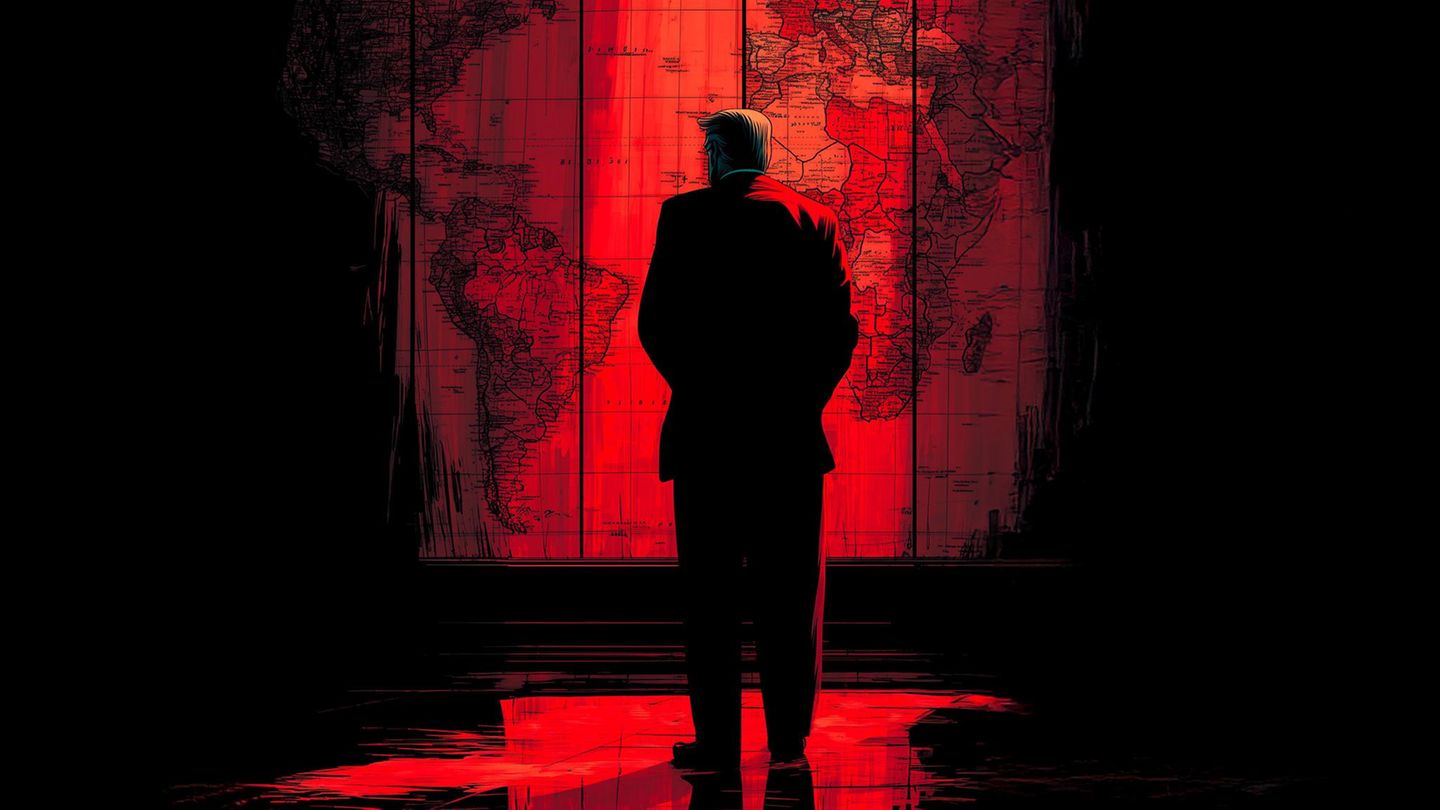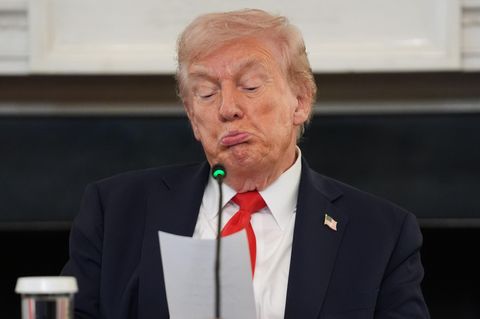Herr Ischinger, was hat Sie überrascht in dieser Woche?
Positiv natürlich, dass wir jetzt konkrete Hoffnung haben, dass die Geiseln in Gaza freikommen – dass es dort zu einem Frieden kommt. Generell hat mich überrascht, dass der amerikanische Präsident sich den Gaza-Plan wirklich zu eigen gemacht hat. Er hat zugelassen, dass er mit seinem Namen verbunden ist: Das ist jetzt der Trump-Plan. Damit geht er ein erhebliches Risiko ein. Man kann zwar diesem Plan nur jeden Erfolg wünschen, und ein erster Schritt scheint ja jetzt gemacht, aber die Zahl der Parteien und Gruppen, die nichts anderes im Sinn haben werden, als ihn in den kommenden Wochen und Monaten zu sabotieren, ist immens. Ein Trump-Plan zur Ukraine wäre mit weniger großen Risiken des Scheiterns verbunden. Leider gibt es den nicht.

Zur Person
Wolfgang Ischinger war von 2001 bis 2006 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den USA, von 2006 bis 2008 dann in Großbritannien. Anschließend übernahm er die Leitung der Münchner Sicherheitskonferenz, die er bis heute führt
Sie kommen gerade aus der Oase Al-Ula in Saudi-Arabien, wo die Münchner Sicherheitskonferenz Dutzende führende Politiker aus dem Mittleren Osten versammelt hat. Wie blicken die auf Trumps Friedensinitiative?
Ich bin daran gewöhnt, dass bei Diskussionen über die Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten, insbesondere beim Thema Israel-Palästina, jeder seine eigene Meinung hat, alle durcheinanderreden und es keine klare gemeinsame Perspektive gibt. Das war so bei Gesprächen zwischen den Amerikanern und Arafat, es war beim berühmten Oslo-Plan zum Nahen Osten so, den wir Europäer damals mitgetragen haben. Jetzt hatten wir erstaunlicherweise über 15 Außenminister aus der arabischen Welt plus Nachbarstaaten wie die Türkei, und es gab unisono ein Narrativ: Der Trump-Plan ist der einzige, den wir haben, und er ist die einzige Chance für ein Ende des Tötens und zur Einleitung eines Friedensprozesses. Deshalb müssen und wollen wir diesen Prozess mit allem, was wir haben, unterstützen. Es war eindrucksvoll zu sehen, wie die arabische Welt hier mit einer stärkeren Stimme spricht als wir 27 Europäer, die wir ja leider keine gemeinsame Politik haben.
Und ist der Trump-Plan wirklich die einzige Chance?
Wenn dieser Versuch jetzt scheitern sollte, wer soll dann die Scherben auflesen? Ich kann nicht erkennen, dass andere die Kraft oder die Stärke der USA, auch das militärische Backup hätten, ganz egal, ob wir von China reden oder uns Europäern. Oder von Russland, das keine Kraft mehr hat, sich in der Region zu engagieren, nachdem die Basis Syrien für Russland ja quasi weggeschwemmt wurde durch den Abgang von Assad.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul ist nun auch ins ägyptische Scharm El-Scheich gefahren, wo Hamas und Israel verhandeln. Aber was macht er da eigentlich – Deutschland ist ja nicht Teil der Verhandlungen?
Deutschland ist traditionell ein wichtiger Akteur in der Region aufgrund unseres traditionellen Verhältnisses zu Israel, aber auch aufgrund eines lange gewachsenen Verhältnisses zur arabischen Welt und unseres ökonomischen Gewichts. Und Wadephul kann dort signalisieren, dass dieser Plan unsere Unterstützung genießt – und dass Deutschland, wenn die Geiselfreilassung und der israelische Rückzug tatsächlich vollzogen sein sollten, bei den vielen komplizierten Fragen, die dann kommen, beim Wiederaufbau und humanitären Themen, seinen Teil beitragen wird.
In erster Linie geht es da um Geld, oder?
Platt gesagt schon. Wer soll denn die zwei- bis dreistelligen Milliardenbeträge für den Wiederaufbau aufbringen? Natürlich wird da auf die Golfstaaten geschaut, aber die werden auch nicht freiwillig die ganze Rechnung übernehmen. Deshalb geht da, wie in der Vergangenheit auch, der Blick nach Europa. Von den USA kommt zwar die strategisch-militärisch-politische Triebkraft, aber ich erwarte nicht, dass die Amerikaner bereit sind, hier 20 oder 30 Milliarden auf den Tresen zu legen.
Teil des Trump-Plans ist ja eine internationale Übergangsbehörde für Gaza, "Board of Peace", das Präsident Trump selber leiten will. Diese Konstruktion klingt erst mal reichlich gewagt.
Unmöglich – das gibt es in der Außenpolitik nicht. Deswegen ist es tatsächlich vorstellbar, dass ein solches Gremium unter der Oberhoheit von Trump gebildet wird. Die Frage ist: Wird das ein rein amerikanisches Unterfangen oder wird es in irgendeiner Form international abgesichert, etwa durch einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats? Das wäre der klassische Weg, um dafür zu sorgen, dass es von allen Seiten anerkannt und zumindest prinzipiell unterstützt wird. China und Russland würden das wohl unterstützen, wenn sie selber mit im Boot sitzen würden. Man muss nicht zwangsläufig den Weg über die Vereinten Nationen gehen, aber wenn man es "freihändig" macht, fehlt die völkerrechtliche Legitimität.
Gab es denn so etwas schon früher?
Als 1995 in Dayton der Frieden für Bosnien geschlossen wurde, haben wir auch eine neue Struktur aus dem Boden gestampft: Es wurde ein sogenannter "Hoher Repräsentant" geschaffen und ein Rat zur Friedensimplementierung, der ihn überwachen sollte. Der erste hohe Repräsentant war dann der Schwede Carl Bildt, und im Rat saßen alle relevanten Staaten, natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland. Der UN-Sicherheitsrat hat das Konstrukt dann Ende 1995 abgesegnet, und es hat bis heute Bestand.
Würden Sie Ihr Geld auf den Erfolg dieser Sache verwetten? Ich wäre da skeptisch
In dieser Woche werden die Nobelpreise vergeben. Gäbe es eine Situation, in der Sie Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorschlagen würden?
Erstens glaube ich nicht, dass ich legitimiert bin, Vorschläge dafür zu machen. Und nach den Erfahrungen der letzten Jahre bin ich, zweitens, nicht der Meinung, dass der Friedensnobelpreis als Vorschusslorbeeren vergeben werden sollte. Ich habe bis heute Zweifel, ob es eine schlaue Idee war, 2009 Präsident Obama den Friedensnobelpreis zu verleihen, nachdem er gerade einmal neun Monate im Amt war und noch keinerlei Beiträge zum Weltfrieden leisten konnte. Ich habe das als eine Entwertung des Nobelpreises wahrgenommen. Sollte sich herausstellen, dass Trump tatsächlich eine ganze Reihe von Konflikten erfolgreich lösen sollte, und dass durch seine Anstrengungen ein dauerhafter Frieden, und das ist das Entscheidende, im Nahen Osten entsteht, wäre das ein außerordentlich großes Verdienst. Aber das wollen wir erst mal sehen.
Mit all Ihrer Erfahrung, Herr Ischinger: Sind Sie vorsichtig optimistisch, was einen langfristigen Frieden im Nahen Osten betrifft?
Ich wünsche mir als Mensch nichts dringender als das allererste Ziel, nämlich die Befreiung der noch verbleibenden lebenden Geiseln. Das wäre schon ein riesiger Schritt in Richtung Frieden. In Scharm El-Scheich wird jetzt über Implementierungsprobleme geredet – ich kann nur hoffen, dass der Prozess dort nicht zerredet wird. Denken Sie mal an den Iran und andere, die nichts anderes im Sinn haben werden, als diesen Prozess auszubremsen. Sie könnten mich jetzt fragen: Würden Sie Ihr Geld auf den Erfolg dieser Sache verwetten? Ich wäre da skeptisch. Die Risiken sind groß, aber die Möglichkeit, dass es klappt, ist da. Deswegen sollten wir uns so stark wie möglich engagieren, um diesen Prozess zu unterstützen.
Und zuletzt, Herr Ischinger, sehen wir denn auch in der Ukraine diese Woche positive Entwicklungen?
Neben der großen internationalen positiven Dynamik in Sachen Gaza ist es die Tatsache, dass neuerdings aus Washington und auch aus dem Munde Trumps wieder Töne kommen, die darauf deuten, der Ukraine wieder mehr militärische Hilfe zukommen zu lassen, damit das Land seine gegenwärtigen, sehr erfolgreichen Verteidigungsoperationen einschließlich der Bekämpfung der russischen Energieinfrastruktur erfolgreich fortsetzen kann. Denn nur wenn man in Moskau den Gürtel wesentlich enger schnallen muss, militärisch, strategisch, energiepolitisch und ökonomisch, können wir überhaupt damit rechnen, dass man dort bereit sein wird, vom Schlachtfeld Richtung Verhandlungstisch zu gehen.