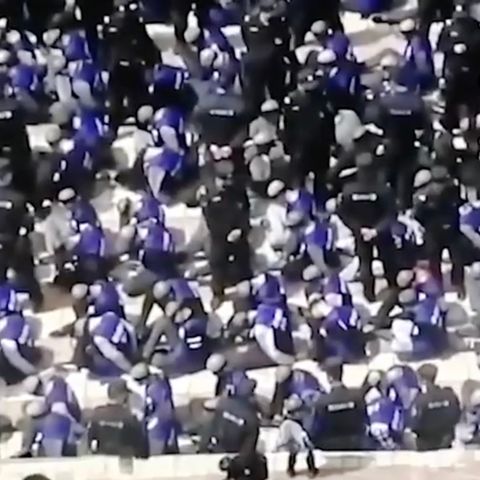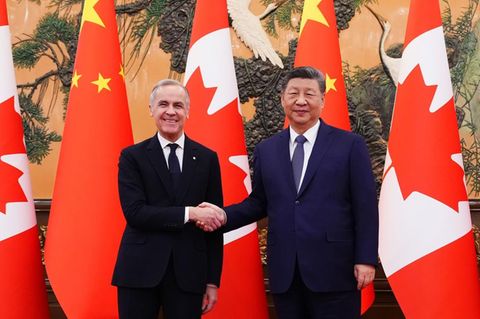Eigentlich ist Baumwolle ein Stoff, aus dem die Albträume sind. Von afrikanischen Sklaven in den USA einst aufwendig gepflanzt und geerntet, hat sie ab dem 18. Jahrhundert in nur wenigen Jahrzehnten die uralte Kulturpflanze Flachs verdrängt, also das Leinen. Jetzt, 150 Jahre später, verschlingt der Baumwoll-Anbau so viel Wasser, dass Flüsse und Seen austrocknen und die Böden versalzen. Für die Weiterverarbeitung zu Jeans und T-Shirts wird der Rohstoff zwischen Bangladesch, Polen und den Philippinen hin- und her geschifft, die Färbemittel sind giftig, die Näherinnen schlecht bezahlt. Am Ende bezahlen Kunden für einen Kapuzenpulli bei Primark, Kik oder Lidl ein paar Euro und ersetzen ihn nach zwei, drei Mal tragen.
Dass Mode, vor allem die Fast-Fashion, ökologisch ein Desaster ist, ist nicht neu. Schon vor einigen Jahren hatten sich Ketten wie Aldi und Tchibo dazu verpflichtet, nur noch Textilien ohne umwelt- oder gesundheitsschädliche Chemikalien zu verkaufen. Auch Bio-Baumwolle ist bei vielen Produzenten mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme, doch rehabilitiert die Pflanze damit noch lange nicht.
H&Ms Baumwoll-Boykott
Während ihre Herstellung grüner und nachhaltiger wird, erinnern im Westen Chinas die Arbeitsbedingungen an dunkelste Sklavenzeiten im Südosten der USA. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass in der Provinz Xinjiang die Volksgruppe der Uiguren in Lagern Zwangsarbeit verrichten muss – etwa auf Baumwollfeldern. Der schwedische Modekonzern H&M boykottiert deshalb die Verwendung des Rohstoffs aus der Region, wogegen sich nun wiederum China wehrt. Der Konflikt hat das Zeug zu einem kulturpolitischen Wirtschaftskrieg zu eskalieren.
Denn bei der Auseinandersetzung geht es nicht nur Baumwolle. Es geht natürlich, aber nicht nur, um Greenwashing und Firmenimage. Es geht, wie so oft, tatsächlich auch um die Unterdrückung der muslimischen Minderheit durch die Regierung Pekings, also um Menschenrechte. Es geht darum, ob man deshalb mit diesem Regime Geschäfte machen sollte, beziehungsweise welche und wie. Im Grunde genommen aber geht es um den ganz großen Konflikt, der da lautet: Wie groß und mächtig will das "Land der Mitte" wirklich werden und muss sich der Westen vor dem immer selbstbewussteren Auftreten Chinas fürchten?
Der Reihe nach: Schon seit vielen Jahrzehnten betrachten die Machthaber in Peking das größtenteils von Muslimen bewohnte Xinjiang als "Unruheprovinz". Mitte der 90er-Jahre verschärfte die chinesische Führung ihre repressive Politik gegenüber den Uiguren. Seit 2014 werden die Westchinesen systematisch in Lager kaserniert, die Peking als Art "Fort- und Ausbildungscamps" schönredet. Menschenrechtlern zufolge handelt es sich um Umerziehungslager, in denen sich "eine der ungeheuerlichsten menschlichen Tragödien seit dem Holocaust" ereigne, wie Vertreter von Juden, Muslimen, Christen und Buddhisten vergangenes Jahr gemeinsam erklärten.
Schätzungsweise eine Million Menschen sind in Xinjiang in Hunderten von Haftlagern eingesperrt. Aus Zeugenaussagen und Dokumenten geht hervor, dass man die Inhaftierten zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache zwingt und Kinder von ihren Eltern trennt. Zwangsarbeit sowie körperliche und seelische Misshandlungen sind alltäglich. H&M hatte 2020 deswegen angekündigt, keine Baumwolle mehr aus der Region beziehen zu wollen – eine Reaktion seitens China blieb zunächst aus. Das hat sich nun geändert. Nachdem die EU vor Kurzem Sanktionen gegen chinesische Beamte verhängt hat, holte die Regierung in Peking zum Gegenschlag aus und verhängte ihrerseits Strafen gegen europäische Politiker und Institutionen.
Austausch von Unfreundlichkeiten
Diese Ankündigung wiederum nahmen einige EU-Staaten zum Anlass, chinesische Botschafter einzubestellen. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin etwa heißt es: "Während wir Menschenrechtsverletzungen sanktionieren, sanktioniert Peking die Demokratie und ihre Institutionen. Das können wir so nicht akzeptieren", so Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Ähnlich äußerten sich auch die Vertreter Belgiens, Dänemarks und Frankreichs. Zwar rangiert die Botschafter-Einbestellung auf der Skala zwischenstaatlicher Unfreundlichkeiten im eher unteren Bereich, aber sie ist und bleibt eine Unfreundlichkeit. Eine, auf die China nun in eigener Weise reagiert: mit wirtschaftlichem Druck.

Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden H&M sowie Adidas und Nike auf eine schwarze Liste gesetzt. Erst übten staatliche Medien harsche Kritik an den West-Marken, dann begann Onlineshops damit, deren Produkte aus ihrem Angebot zu nehmen. Auch zahlreiche chinesische Influencer stimmten plötzlich in den Boykottchor mit ein und rieten vom Kauf entsprechender Schuhe und Shirts ab. Mittlerweile kündigen sogar die ersten Vermieter den schwedischen Filialen. Chinesische Verbraucher würden "mit den Füßen abstimmen und widerspenstige Unternehmen boykottieren", hieß es etwa beim Staatssender CCTV. Auch New Balance, die Modefirma Burberry und Zara sind mittlerweile ins Visier geraten.
In der Vergangenheit waren die meisten internationalen Firmen mit Kritik an China eher zurückhaltend. Zu groß und zu wichtig ist der gigantische Markt mit seiner mehr als eine Milliarde Einwohner. Dennoch gerieten ausländischen Unternehmen immer wieder mit der Pekinger Regierung aneinander. So weigert sich Google etwa, Hongkonger Behörden Daten aus der Navigationsapp zur Verfügung zu stellen. Anlass sind die neuen Sicherheitsgesetze, die nach der Niederschlagung der Demokratiebewegung erlassen wurden. Andere Unternehmen sind dagegen "kooperativer": So hatte sich einst die Modekette Gap dafür entschuldigt, eine "fehlerhafte" Landkarte Chinas ohne Taiwan auf einem T-Shirt abgebildet zu haben. Peking betrachtet die unabhängige Nachbarinsel als Teil der Volksrepublik.
China stellt Ansprüche
Womit die nächste Ebene des Konflikts erreicht ist. Denn die chinesische Regierung legt ihre vornehme Zurückhaltung der letzten Jahrzehnte ab und stellt immer offensiver territoriale Ansprüche in der Region. Auf Taiwan etwa, das die Pekinger Führung als "abtrünnige" Provinz bezeichnet, obwohl die Insel nie Teil Chinas war. Unverblümt droht sie mit einer gewaltsamen Eroberung. Für den Fall haben die USA sich der Verteidigung Taiwans verpflichtet. Zuletzt nahmen die Spannungen in der Region zu, als das US-Kriegsschiff "USS John Finn" durch die Taiwanstraße kreuzte. Auch vor der japanischen Küste liegen einige Insel, auf die China Anspruch erhebt, die USA haben hier ebenfalls Beistand angekündigt.
Wirtschaftlich expandiert die "kommunistische" Regierung ohnehin schon seit sehr vielen Jahren. Vor allem in afrikanischen Ländern investieren die Chinesen massiv. Meist lautet der Deal: Infrastruktur gegen Arbeitskräfte und/oder Rohstoffe. Auch europäische Staaten wie etwa Italien sind mittlerweile offen für chinesisches Geld. Ebenso wie deutsche Mittelständler. Mit der "Neuen Seidenstraße" hat China zudem eine Initiative gegründet, die anderen Ländern bei ihrer Entwicklung "helfen" soll. Wie das aussehen kann, zeigt ein Beispiel aus Sri Lanka. Dort wurde der Bau eines Hafens finanziert, der sich jedoch (und wohl auch absehbar) nicht gerechnet hat und deshalb wieder an China zurückgefallen ist. Auf diese Weise sichert sich die Pekinger Regierung den Zugang zu strategisch interessanten Ankerplätze im asiatischen Raum.
USA wollen eine "West-Seidenstraße"
Auch die Amerikaner beobachten die massive Ausbreitung chinesischer Interessen und Einflusszonen mit Sorge. Zum Boykott von H&M äußerte sich das Außenministerium jetzt offiziell: "Wir unterstützen Unternehmen, die dafür sorgen, dass die von uns konsumierten Produkte nicht durch Zwangsarbeit hergestellt wurden", wie eine Ministeriumssprecherin sagte. Ex-US-Präsident Donald Trump hatte auch schon versucht, harte Kante gegen Chinas aggressive Politik zu zeigen, agierte dabei aber eher ungeschickt. Sein Nachfolger Joe Biden wagt nun einen anderen Versuch und schlug vor, eine Art "West-Seidenstraße" ins Leben zu rufen, die von "demokratischen Staaten ausgeht, um jenen auf der ganzen Welt zu helfen, die in der Tat Hilfe brauchen", wie er sagte.
Sein Außenminister Antony Blinken stellte auf dem jüngsten Nato-Treffen noch einmal klar, dass die USA das Riesenreich als Bedrohung für Wohlstand und Sicherheit betrachte. Dennoch würden die Vereinigten Staaten ihre Alliierten "nicht zu einer 'Wir-oder-sie'-Entscheidung zwingen". Ton und Tat zwischen "dem" Westen und China werden also mal wieder rauer. Neu ist, dass nun auch Unternehmen offen die Machtprobe mit dem Land suchen, die eigentlich ein Interesse an konfliktfreier Ruhe haben.
Quellen: "Tagesspiegel", DPA, AFP, Kurier.at, Domradio, NTV, Bundeszentrale für politische Bildung, Weltspiegel