Zuletzt war viel von Wellen die Rede, von blauen zumeist. Ob sie tatsächlich kommen und wenn ja, wie stark sie wohl sein werden. Glaubt man den aktuellen Prognosen, wird der Wellengang eher gemäßigt ausfallen. Mehr Geplätscher als Tsunami. Bei den anstehenden Zwischenwahlen in die USA werden die oppositionellen Demokraten, deren Parteifarbe blau ist, zumindest eine Kammer des US-Kongresses erobern: das Repräsentantenhaus. Durchaus eine blaue Erfolgswelle, ja, aber eben auf üblichem Niveau, denn bei dem in Amerika Midterms genannten Urnengang darf die Opposition immer ein wenig siegen.
Ausgang der Wahl ist eigentlich klar
Für die meisten Wahlforscher ist der Ausgang der Zwischenwahl, die traditionell auch immer als Zeugnis für den Chef im Weißen Haus gilt, bereits klar: Nate Silver, einer der Gurus der Szene, sieht die Chancen, dass die Republikaner die Mehrheit behalten, nur bei 14,4 Prozent. Das heißt: in sechs von sieben Fällen wird die Opposition die meisten Abgeordneten in der Kammer stellen. In diesem wahrscheinlichen Fall wird das Regieren für Donald Trump um einiges komplizierter. Aber er hat ja noch den Senat. Dort wird die Regierungspartei wohl die Mehrheit verteidigen. Beide Seiten werden sich am Dienstagabend als Sieger fühlen dürfen, die Demokraten vielleicht etwas mehr.
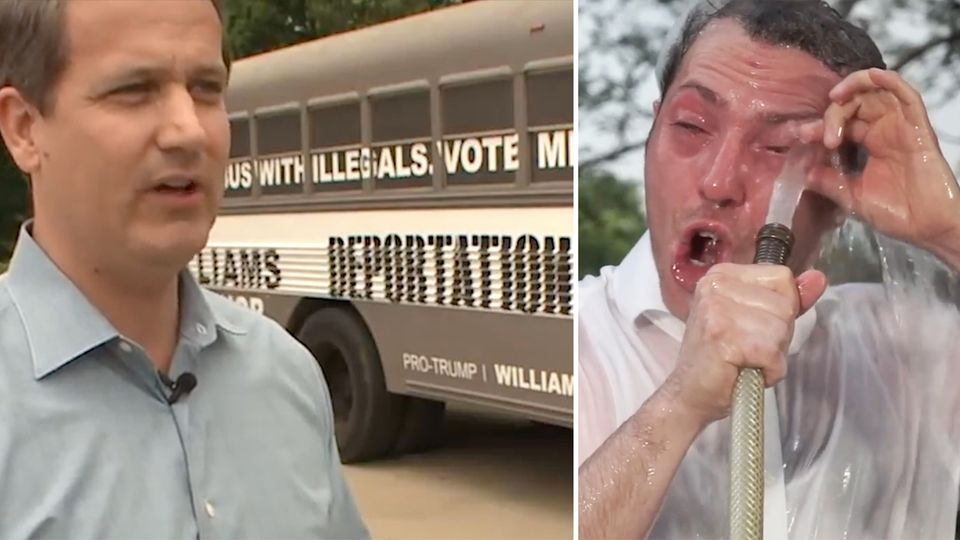
Prognosen über eine "blaue Welle" hatte es auch schon vor der Präsidentschaftswahl 2016 gegeben. Die "New York Times" taxierte die Wahrscheinlichkeit des Sieges der Kandidatin Hillary Clinton damals auf satte 85 Prozent. Die Experten der Zeitung irrten. Auch Nate Silver lag damals daneben. Er berechnete die Wahrscheinlichkeit eines Clinton-Siegs mit 71,4 Prozent und die eines Trump-Sieges entsprechend mit 28,6 Prozent. Nach dem Triumph des Immobilienmilliardärs war das Geschimpfe auf die Umfrageinstitute und die Wahlforscher groß. Schließlich ging auch schon die Vorhersage der Brexit-Abstimmung ein paar Monate zuvor schief.
Die meisten Umfragen stimmten
Und doch: Die allermeisten Umfragen lagen nicht einmal besonders falsch. Das Rennen war nur so eng, dass der Ausgang in der üblichen Fehlerbandbreite lag. Dazu kamen dann noch die Journalisten, die sich den Durchschnitt der Umfragen genommen haben, die knapp aber klar die demokratische Kandidatin vorne gesehen haben und so kurz und knackig den Sieg Clintons verkündeten. Die Ironie dabei: Clinton hat die Präsidentschaftswahl ja sogar gewonnen – zumindest wenn es in den USA nach der reinen Stimmenmehrheit ginge.
Woran es 2016 umfragentechnisch gehapert hat, zeigen folgende Beispiele:
- Beispiel Brexit: Am Ende stand es 48,1 Prozent für den Verbleib gegen 51,9 Prozent für den EU-Ausstieg. In absoluten Zahlen: 16.141.242 Millionen Briten wollten bleiben, 17.410.742 nicht - ein Unterschied von 1.269.500 Menschen. Anders gesagt: ein Unterschied von rund 3,5 Prozentpunkten gemessen an den 33,5 Millionen abgegebenen Stimmen. Die meisten, wenn auch nicht alle Umfragen, hatten der Abstimmung einen eher dünnen Vorsprung des "Bleiben"-Lagers diagnostiziert. Üblicherweise gilt für Umfragen eine Fehlerspanne zwischen drei und fünf Prozent. Das heißt, dass die Mehrheit der Brexit-Befragungen zwar nicht wirklich gut lag, aber eben auch nicht völlig daneben.
- Beispiel Präsidentschaftswahl 2016: Auch hier stimmten die Umfragen – zumindest was den "Popular Vote" angeht, die Gesamtstimmen. Hillary Clinton lag in allen Befragungen stets zwischen drei bis fünf Prozentpunkten vor ihrem Konkurrenten Trump. Und am Ende kam sie auf landesweit 65.853.516 Stimmen, das waren rund drei Millionen mehr als der Republikaner bekommen hatte. Dieser Vorsprung entspricht ziemlich genau den Umfragewerten. Dass sie am Ende nicht US-Präsidentin wurde, hat mit dem US-Wahlsystem zu tun, in dem derjenige den Sieg davonträgt, der die meisten Bundesstaaten gewinnt – grob gesagt. Und das führt zum eigentlichen Umfrageproblem.
- Beispiel Bundesstaaten: In den USA bestimmen de facto die Bürger in den einzelnen Staaten den Präsidenten, beziehungsweise die von dort entsandten Wahlleute. Viele Staaten sind traditionell in fester Hand bestimmter Parteien: Das konservative Texas etwa wählt die Republikaner, das liberale Kalifornien die Demokraten. Dort machen die Kandidaten selten Wahlkampf, weil sie ihre Ressourcen lieber in umkämpfte Gebiete stecken. Der letzte Urnengang wurde im Grunde in zwei Ecken entschieden, in denen die Demokraten gewinnen und deshalb von vielen Umfrageinstituten "vergessen" wurden: Michigan und Wisconsin. In beiden Staaten wurden die Menschen nur wenig befragt – zur Überraschung aller fielen sie dann ans Trump-Lager. In Michigan mit einem Vorsprung von gerade einmal 10.700 Stimmen (bei knapp fünf Millionen Wähler) und in Wisconsin mit 22.000 Stimmen (bei rund 3,5 Millionen Wählern). Dass sie von den Republikanern erobert werden würden, gehörte zu diesen wenigen "Donald Trump gewinnt-Szenarien" - unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Die Qualität der Umfragen: weiterhin gut
In einem leicht trotzigen Essay hat Umfrage-Experte Nate Silver schon kurz nach dem November 2016 angemerkt, dass es nicht so sehr die Zahlen waren, die falsch lagen, sondern eher die statistische Fehlertoleranz sowie die Interpretation durch die Medien. In einer aktualisierten Fassung, weist Silver auf eine gemeinsame Untersuchung zwei britischer Unis hin, nach der die Umfrage-Qualität in den vergangenen 20 Jahren auf gleichem Niveau geblieben ist. Dass Umfragen zwar keine exakten Vorhersagen sind, aber gute Momentaufnahmen, ahnt offenbar auch der Präsident. Seit einigen Tagen bereitet er seine Anhänger darauf vor, dass seine Partei vermutlich die Kontrolle über das Repräsentantenhaus verlieren wird. Seine Reaktion (auf einer Veranstaltung in West Virginia): "Das ist nicht gut für das Land. Aber macht euch keinen Kopf. Ich kriege das schon hin."
Quellen: "Washington Post", Realclearpolitics, Fivethirtyeight, Statista, Bloomberg, "Politico"







