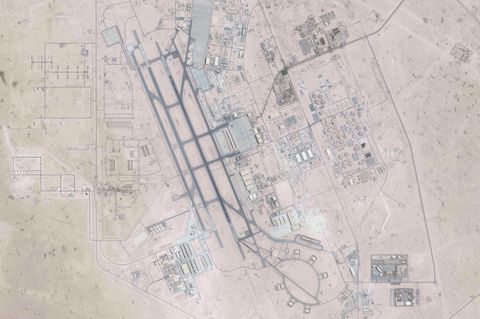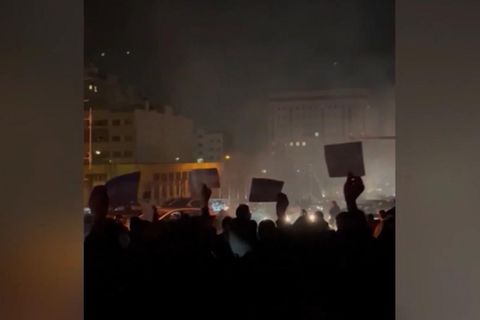Es sind nur zwei Blatt Papier, eng beschrieben, sie tragen weder Stempel noch Unterschrift. Es sind zwei unscheinbare Blatt Papier, doch sie verursachen gerade so viel Wirbel in Washington, dass sie dabei auch Außenministerin Condoleezza Rice in Bedrängnis bringen. "Schweizer Memo" nennt man das kurze, aber inhaltsreiche Dokument, das vor knapp vier Jahren aus dem Iran in die USA übermittelt wurde. Ein Dokument von möglicherweise historischer Bedeutung. Denn es handelte sich um ein Angebot, abgesegnet von der höchsten iranischen Führung. Ein Angebot über direkte Verhandlungen zwischen beiden Ländern, zum ersten Mal seit über 20 Jahren. Gespräche über die großen Probleme. Auch über das iranische Atomprogramm, sogar über eine mögliche Anerkennung Israels. Der Deal? Eine Art Bestandsgarantie des iranischen Regimes durch die USA. Es war eine Einladung zu einer umfangreichen Einigung, zu einem "Grand Bargain". Sie wurde nicht angenommen. Man schaltete vielmehr um auf Konfrontation. In Teheran. Und in Washington.
Dabei wäre es vielleicht eine einzigartige Chance gewesen. Im April 2003, die USA sind gerade siegreich in Bagdad einmarschiert, trifft sich Tim Guldiman, Schweizer Botschafter in Teheran, mit einem hohen iranischen Diplomaten. Jeder in Teheran weiß: der Schweizer Botschafter ist der Verbindungsmann zwischen Iran und den USA, über ihn halten die beiden Länder inoffiziell Kontakt, sie haben ja keine diplomatischen Beziehungen. Aber immerhin: sie haben den "Schweizer Kanal".
Iraner signalisierten Gesprächsbereitschaft
Im Siegesrausch des Frühjahrs 2003 ist die Bush-Regierung überzeugt, man könne bald den gesamten Nahen Osten "befreien", vielleicht auch den Iran. Gut möglich, dass man in Teheran davor berechtigte Sorge hat. Außerdem: die beiden Länder haben schon bei dem Krieg gegen die Taliban und al-Quaida in Afghanistan zusammengearbeitet.
An diesem Apriltag skizzieren die beiden Gesprächspartner eine Agenda für eine diplomatische Wende, eine "roadmap" für mögliche direkte Gespräche. Der Iraner ist nicht irgendwer - Sadeq Kharrazi ist Botschafter in Paris, ein Neffe des agierenden Außenministers, vor allem aber ist er familiär ziemlich eng verbandelt mit dem obersten geistlichen Führer des Iran, mit Ayatollah Ali Chamenei.
Einen Monat später trifft man sich wieder. Kharrazi hat offenbar gute Nachrichten: er habe das Papier in mehreren, mehrstündigen Gesprächen sowohl mit dem damaligen Präsidenten Chatami als auch mit Ayatollah Chamenei diskutiert. Beide hätten die meisten Punkte akzeptiert. Der Entwurf sollte die Grundlage für bilaterale Gespräche mit den Amerikanern sein. Und die könnten schon bald beginnen, signalisierten die Iraner.
Auch Rice soll das Papier gekannt haben
Am 4. Mai 2003 wird das "Schweizer Memo" ans US-Außenministerium gefaxt, macht von dort aus schnell die Runde, erreicht auch den CIA-Nahostexperten Flynt Leverett. Er macht sich für das Papier stark, sorgt dafür, dass es auch Außenminister Colin Powell erreicht. Leverett, der zwei Jahre lang als Nahost-Direktor im Nationalen Sicherheitsrat arbeitete, ist überzeugt, dass es auch auf dem Schreibtisch der damaligen Nationalen Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice landete.
Und was wurde draus? Nichts.
Außenminister Colin Powell konnte - oder wollte - sich bei Bush nicht durchsetzen. "Ich konnte das Dokument im Weißen Haus nicht verkaufen", soll er gesagt haben. Und Präsident Bush? Der hatte den Iran ja zum Bestandteil seiner "Achse des Bösen" erklärt - und zwar auf Anraten von Condoleezza Rice, wie das Magazin "Newsweek" berichtet.
Rechtfertigung des Säbelrasselns
Doch in diesen Tagen taucht das "Schweizer Memo" wieder auf. Wird auf hochkarätigen Konferenzen diskutiert, und auf einmal muss sich sogar Condoleezza Rice von Abgeordneten des Kongresses fragen lassen, was sie vom Angebot aus Teheran wusste. Warum reagierte man nicht? "Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so etwas jemals gesehen habe", verteidigte sie sich schwach. "Das Angebot wurde ihr sicher vorgelegt", sagt der ehemalige Nahost- Direktor Flynt Leverett. "Alles Andere wäre absolut undenkbar. Der Vorschlag war ernst, er wurde von den höchsten Stellen im Iran befürwortet, es war der konkrete Plan für eine mögliche Annäherung. Nein, wir wissen nicht, ob Gespräche zum Erfolg geführt hätten. Wir wissen auch nicht, ob die iranische Führung wirklich zu Kompromissen bereit gewesen wäre. Doch wir haben es erst gar nicht versucht."
Und so ist allein die Existenz des Papiers hochnotpeinlich für die US-Regierung. Will sie doch der Welt gerade beweisen, dass man mit dem Iran eigentlich gar nicht verhandeln kann. Immer lauter rasseln die Säbel, jeden Tag wird über iranische Schandtaten im Irak berichtet. Über Terrorkommandos der Al-Quds Brigaden etwa, die im Irak aktiv sind, angeblich mit Unterstützung der iranischen Regierung. Über den Einsatz besonderer, panzerknackender Sprengsätze, so genannter EPT, aus iranischer Produktion, denen schon 170 US-Soldaten zum Opfer gefallen seien. US-Truppen im Irak sind angewiesen, auch gegen Iraner vorzugehen und iranische Agenten zu töten. Dem "heimlichen Krieg gegen den Iran" widmet das Magazin Newsweek seine Titelgeschichte, und das konservative Wall Street Journal kommentiert: "Wir dürfen nicht zulassen, dass Teheran Unterstützung dabei leistet, wenn unsere Soldaten im Irak getötet werden. Dies ist als feindlicher Akt zu betrachten." Präsident Bush gab am Mittwoch sogar eine Pressekonferenz zum Thema: "Ich werde etwas dagegen unternehmen", sagte er.
Papier für die Nachwelt
"So legt die Bush-Regierung den Grundstein für die politische Legitimation eventueller militärischer Handlungen", sagt ein ehemaliger hochrangiger CIA-Offizier. " Und ich kann nur hoffen, dass ich Unrecht habe."
Es sind nur zwei unscheinbare Seiten Papier, sie werden in den staatlichen Archiven abgelegt. Und so wird auch das "Schweizer Memo" eines Tages Zeugnis geben von der unrühmlichen Geschichte des George W. Bush, 43. Präsident der Vereinigten Staaten.