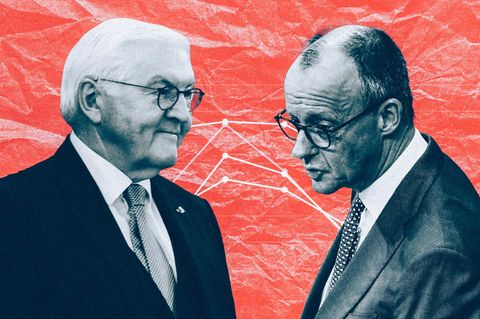So viel Einmütigkeit bestand selten zwischen der linken "Taz" und der wirtschaftsliberalen "Financial Times Deutschland" (FTD): Die Zeitung aus Berlin titelte über einem Bild von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "Das Mädchen der Atomlobby". Das Hamburger Blatt lieferte die Schlagzeile "Milliardengeschenke für die Atomlobby". Der schwarz-gelbe Atomkompromiss, den die Bundeskanzlerin als "Revolution" preist, wirft ein Schlaglicht auf die sagenhafte Macht der Stromkonzerne Eon, RWE, EnBW und Vattenfall.
Die vier AKW-Betreiber kontrollieren nicht nur 80 Prozent des Strommarktes in Deutschland, sie bestimmen auch mit über die Regulierung ihres Geschäfts. So sagt Edda Müller, Vorsitzende von Transparency International, im Gespräch mit stern.de: "Seit Jahrzehnten diktieren wenige Konzerne der Politik, was sie im Bereich Stromversorgung zu tun hat." Eine Einschätzung, mit der sie nicht allein steht.
Laut des Energiekonzepts, das Merkel und Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) nun präsentierten, könnten einige Atomkraftwerke noch bis ins Jahr 2050 am Netz bleiben. Dadurch winken den Stromkonzernen Milliardengewinne: Nach Berechnungen des Freiburger Öko-Instituts bis zum Jahr 2016 sollen es mindestens 31,1 Milliarden Euro sein. Im Gegenzug müssen die Stromkonzerne aber deutlich weniger zahlen als ursprünglich vorgesehen. Die sogenannte Brennelementesteuer wird auf sechs Jahre begrenzt und fällt mit jährlich 1,9 Milliarden Euro niedriger aus als geplant. Auch die Forderung von Umweltminister Röttgen nach höheren Sicherheitsstandards war scheinbar nicht durchsetzbar. Das Energiekonzept macht diese teuren Nachbesserungen "möglich", aber nicht verpflichtend.
Enge Verflechtung mit der Politik
Dass die Bundesregierung so wenige ihrer eigenen Forderungen durchsetzen konnte, können sich Beobachter nur mit der massiven Lobbyarbeit der mächtigen Stromkonzerne erklären. So auch der Lobby-kritische SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow: "Eine reine Sachentscheidung war das jedenfalls nicht. Was die Bundesregierung gemacht hat, ist schon ein Kotau." Doch wie kommt es, dass die Atomlobby ihre Ziele scheinbar kompromisslos durchsetzen kann? Heidi Klein, Vorstand der Lobbyismus-kritischen Organisation "LobbyControl" berichtet, die Stromkonzerne seien "eine der Branchen, die am stärksten mit der Politik verflochten ist. Und zwar von der Spitzenpolitik bis hinunter in die regionale Ebene".
Auch Edda Müller von Transparency International verweist auf diese persönlichen Bande zwischen Politik und Stromwirtschaft: "Es gibt zig Beispiele von Politikern und Spitzenbeamten, die nach ihrer politischen Karriere zu den Stromkonzernen gewechselt sind. Das betrifft die gesamte politische Klasse." Und nicht nur CDU- und FDP-Politiker pflegen enge Beziehungen zu Stromkonzernen, der ehemalige SPD-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement engagiert sich ebenso für den Stromriesen RWE, wie auch der ehemalige Außenminister Joschka Fischer von den Grünen, der für das Unternehmen als Berater tätig ist.
Besonders eng sind die Verflechtungen zwischen Atomlobby und Politik dort, wo es viele Atomkraftwerke gibt, wie etwa in Baden-Württemberg: Unionsfraktionschef Volker Kauder, Abgeordneter des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen, möchte die AKW am liebsten unbegrenzt laufen lassen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus lieferte sich in den vergangenen Wochen ein heftiges Gefecht mit seinem Parteikollegen Norbert Röttgen - er wollte dem Bundesumweltminister deutlich längere Laufzeiten abringen, als dieser geplant hatte.
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Den Stromkonzernen sind viele Mittel recht, um ihre Ziele durchzusetzen.
Politische Druckmittel
Es sind aber nicht nur die persönlichen Beziehungen, die bis hinein in die Spitze der Parteien reichen, mit denen die Stromkonzerne ihre Ziele durchsetzen. Auch politischer Druck gehört zum Waffenarsenal der Atomlobby: Die jüngste Anzeigenkampagne für eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke löste eine heftige Debatte aus. Heidi Klein von LobbyControl spricht von einer "ziemlichen Drohkulisse". Es wurde mit Investitionsstopps gedroht und vor dem Niedergang des Wirtschaftsstandorts Deutschland gewarnt, sollten die AKW-Laufzeiten nicht verlängert werden. Schließlich, so argumentiert zum Beispiel RWE, könne man ohne Atomkraftwerke keine dauerhaft günstige Stromversorgung in Deutschland gewährleisten.
Wenn Politiker gegen die Stromkonzerne arbeiten, müssen sie mitunter um ihre Karrieren fürchten, wie SPD-Politiker Bülow sagt. "Die Abgeordneten hängen zum Beispiel nicht nur von den Spendengeldern der Konzerne ab. Auch in den Wahlkreisen wird massiv Druck ausgeübt, wenn einer Politik gegen die Interessen der Stromkonzerne betreibt."
Atomfreundliche Bundesregierung
Zur Geschichte des Atomkompromisses gehört auch, dass die Atomlobby bei der Bundesregierung offene Türen eingerennt. Sascha Müller-Kraenner, Europarepräsentant von "Nature Conservancy", meint, "dass diesmal die vier Energiekonzerne ihr Anliegen besonders erfolgreich vortragen konnten. Mit der FDP sitzen auch Regierungsvertreter mit besonders offenen Ohren in Berlin - mit Wirtschaftsminister Rainer Brüderle als verlängerter Werkbank der Energiewirtschaft."
Auch Heidi Klein von LobbyControl wundert sich, wieso die Bundesregierung plötzlich mit einem fertigen Energiekonzept hervorprescht, obwohl die Energiestudie, die angeblich die Entscheidungsgrundlage bildete, erst wenige Tage vorlag. "Es scheint, als ob das Energiekonzept schon lange so feststand. Die Politik ist hier also nicht einfach ein Opfer der Lobbyisten. Das sieht eher nach einem abgekarteten Spiel aus", so Klein. Diese Einschätzung teilt auch ein ehemaliger Spitzenpolitiker der CDU. Im Hintergrundgespräch mit stern.de schätzt er die Lobbyarbeit der vergangenen Wochen als wenig erfolgreich ein. "Die Anzeigenkampagne hat eher Sympathien gekostet." Demnach ist die Bundesregierung in weiten Teilen tatsächlich überzeugt von ihrem Energiekonzept.
Das Oligopol wird zementiert
Selbst wenn man die AKW-Laufzeitverlängerung für richtig hält, handelt sich die Bundesregierung mit ihrem Einknicken vor den Wünschen der Stromkonzerne ein großes Problem ein: Laut Koalitionsvertrag will Schwarz-Gelb den Strommarkt in Deutschland liberalisieren. Denn im Zeitalter der erneuerbaren Energien wird die Stromversorgung dezentral stattfinden - ob mit Windkraftanlagen in der Nordsee, Solarstrom aus Spanien oder mittels Biogasanlagen auf dem Land. Der Strommarkt der Zukunft braucht viele neue Stromanbieter und ein flexibles Versorgungsnetzwerk - europaweit.
Würden die Kernkraftwerke zeitnah vom Netz gehen, gäbe es Bedarf nach Alternativen und entsprechenden Stromleitungen. Neue Anbieter würden auf den Markt strömen und die Alleinherrschaft der großen Vier brechen. Doch das haben letztere gemeinsam mit der Bundesregierung verhindert. Denn mit der Laufzeitverlängerung gibt es eher zu viel Strom und daher keinen Markt für neue, innovative Stromanbieter. Die überalteten Netzstrukturen bleiben bestehen, ebenso die Alleinherrschaft von Eon, RWE, EnBW und Vattenfall.
Der dringend nötige Strukturwandel und die große Chance für kleine und mittelständische Unternehmen, in den Strommarkt einzusteigen, ist vertan. Oder wie es Edda Müller formuliert: "Das Zustandekommen des Energiekonzepts ist ein Negativbeispiel für politische Kultur und eine Niederlage für den Primat der Politik." So wird die Atomlobby auch weiterhin die Bundesrepublik Deutschland mitregieren - ungebremst und ungebeten.