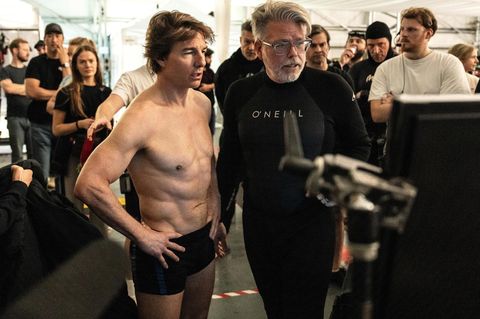Die Weltklimakonferenz in Bonn berät ab Montag über die Ausgestaltung das Kyoto-Abkommens, in dem sich die Industrieländer zu einer deutlichen Reduktion der Treibhausgase verpflichten. Eine Übereinkunft gilt als fraglich, nachdem die USA, der weltgrößte Schadstoffproduzent, eine Umsetzung des Abkommens Ende März abgelehnt hatten.
Es folgt eine Chronik der politischen Ereignisse seit dem ersten Weltgipfeltreffen in Rio de Janeiro 1992:
- 1992: Auf dem Weltgipfeltreffen in Rio de Janeiro verpflichten sich Staats- und Regierungschefs zu verstärkten Anstrengungen gegen Umweltverschmutzung und Armut. Hauptergebnis ist ein Vertrag zur Reduzierung der Treibhausgase, wie Kohlendioxid (Klimarahmenkonvention). Sie gelten als Hauptursache für die globale Erwärmung, die nachhaltige Klimaveränderungen, unter anderem durch das Ansteigen des Meeresspiegels, verursachen könnte. Die Industrienationen erklären sich bereit, die Emissionen freiwillig auf das Niveau des Vergleichsjahres 1990 zu senken.
Die US-Raumfahrtbehörde NASA berichtet, dass das Ozonloch über der Antarktis 1992 um 15 Prozent gewachsen sei. Das Ozonloch wurde 1985 entdeckt und geht auf eine Verminderung der Ozonschicht zurück. Als Ursache dafür gilt der verstärkte Ausstoß von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW).
- 1993: US-Präsident Bill Clinton kündigt einen ehrgeizigen Plan an, die Treibhausgase bis zum Jahr 2000 auf das Niveau von 1990 zu senken.
- 1994: Die Umweltorganisation Greenpeace warnt in einem Bericht vor zunehmenden Umweltkatastrophen durch die Klimaerwärmung.
- 1996: Die Umweltminister der führenden Industrienationen fordern auf einer Konferenz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris ein größeres weltweites Engagement gegen die Klimaerwärmung.
Ein Antrag zur Reduktion der Emissionen aus fossilen Brennstoffen, wie Erdöl und Kohle, wird in den Abschlussbericht der UNO-Klimakonferenz in Genf übernommen.
- 1997: Im japanischen Kyoto kommt der weltweit erste Vertrag zur Reduktion von Treibhausgasen zu Stande. Das Kyoto-Abkommen verpflichtet die Industrienationen, ihre Schadstoff-Emissionen bis spätestens 2012 auf ein Niveau von 5,2 Prozent unter dem Stand von 1990 zu verringern.
- 1998: In Buenos Aires kommen Vertreter von rund 170 Ländern zu einer UNO-Klimakonferenz zusammen, um die Umsetzung der Emissionsreduzierung zu diskutieren.
- 1999: Ein Treffen von Umweltministern aus 173 Ländern in Bonn endet ohne Ergebnisse (5. Weltklimakonferenz). Umstritten ist vor allem, wie Staaten bestraft werden sollen, die die Reduktionsziele nicht einhalten. Der Verkauf der so genannten Emissionsrechte von Ländern mit geringem Schadstoffausstoß an emissionsreiche Industrieländer ist ebenfalls umstritten.
- 9. April 2000: Auch die G8-Umweltminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten und Russlands kommen in den strittigen Fragen zu keinem Ergebnis.
- 25. November 2000: Die 6. Weltklimakonferenz in Den Haag endet in einem Streit zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA über die Emissionsverminderung. Man vertagt die weiteren Verhandlungen auf die Konferenz in Bonn.
- 28. März 2001: Der neue, republikanische US-Präsident George W. Bush lehnt wenige Wochen nach seinem Amtsantritt den Vertrag von Kyoto ab. Eine Ratifikation könne die US-Wirtschaft belasten.
- Juli 2001: Während sich die EU nun für eine Umsetzung des Abkommens auch ohne die USA einsetzt, wollen Australien und Japan keinen Alleingang ohne die USA. Die japanische Umweltministerin Yoriko Kawaguchi schlägt daher vor, eine endgültige Lösung erst im Oktober bei der 7. Weltklimakonferenz in Marrakesch in Marokko anzustreben.