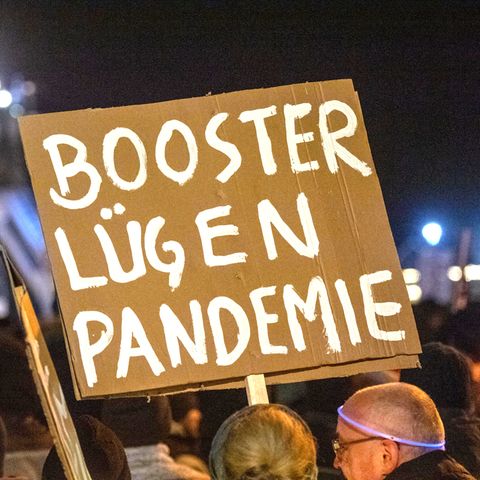Anfang Januar, so hieß es zunächst, werde sich der Bundestag mit der möglichen Einführung einer Impfpflicht befassen. Doch der Zeitplan hinkt hinterher. Offenbar dauert es länger, die verschiedenen geplanten Gesetzentwürfe vorzubereiten. Unmittelbar verbunden mit der Diskussion um eine Impfpflicht ist jedoch die Frage, wie ein solches Vorhaben überhaupt kontrolliert werden kann. Als mögliches Instrument gilt dabei die Erstellung eines nationalen Impfregisters. Doch wie bei der Impfpflicht gibt es auch in dieser Frage eine kontroverse Diskussion. Wir fassen den Stand der Debatte zusammen.
Warum ist ein Impfregister sinnvoll?
Wie jedes Register oder jede Datenbank hat auch ein Impfregister den zentralen Vorteil, Menschen bzw. Daten unter bestimmten Kriterien zusammenzufassen, zu gliedern, sie in Gruppen einzuordnen etc.. Der Bund oder die Krankenkassen könnten die Versicherten auf Impftermine hinweisen, sie über neue Verordnungen auf dem Laufenden halten oder mit anderen wichtigen Informationen zur Impfung versorgen. Genauso könnten Ordnungs- oder Gesundheitsämter den Impffortschritt kontrollieren und eingreifen, falls eine Impfung nicht erfolgt ist.
Neu ist die Idee eines Impfregisters nicht. Laut "Wirtschaftswoche" hat das Robert-Koch-Institut (RKI) bereits 2016 im Auftrag der Gesundheitsministerkonferenz eine Nutzen- und Aufwandsanalyse durchgeführt. Damals habe sich der Mehrwert eines solchen Registers allerdings nicht abbilden lassen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte.
"Come Impf And Find Out": 150 Marken ändern ihre Slogans für Impfkampagne – das sind die 20 besten
Wie wird der Impfstatus derzeit kontrolliert?
Die Tage nach Weihnachten und Neujahr haben erneut das Dilemma der Corona-Zahlen zutage gefördert: Sie sind zu manchen Zeitpunkten nicht belastbar. Oft hat es den Anschein, als irre die Bundesregierung im Blindflug durch die Pandemie. Für die Covid-19-Impfungen werden derzeit die Daten von den Impfzentren und Arztpraxen erhoben und vom RKI aufbereitet, so dass die entsprechenden Impfquoten bundesweit und regional bekannt sind. Zuletzt hatte es jedoch immer wieder Diskrepanzen zwischen der vom RKI offiziell angegebenen Impfquote und den Ergebnissen von Umfragen in der Bevölkerung gegeben. Die Teilnahme an weiteren Schutzimpfungen kann derzeit lediglich durch pseudonymisierte, ambulante Abrechnungsdaten der gesetzlich Krankenversicherten bestimmt werden, die meist mit einer Zeitverzögerung von rund sechs Monaten vorliegen.
Welche Vorbilder gibt es im Ausland?
Nationale Impfregister gibt es unter anderem in den skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden und Finnland. In Österreich ist ein solches Vorhaben auf dem Weg. Dort wurden die rechtlichen Vorgaben allerdings bereits 2012 beschlossen. Seit Herbst 2020 gibt es einen elektronischen Impfpass, der mit dem Impfregister verknüpft ist. Geplant ist, dass künftig alle drei Monate Daten des Melderegisters mit den Angaben im Impfregister abgeglichen werden sollen. Wer am Stichtag keine Ausnahmeregelung vorlegt, erhält ein Schreiben mit einem Terminvorschlag zum Impfen. Wer die Impfung verweigert, dem drohen Geldstrafen bis zu 3600 Euro. Eingesehen werden dürfen die Daten von Ärztinnen und Ärzten, Apotheken, Hebammen, Krankenhäusern und dem öffentlichen Gesundheitsdienst.
Wie vielfältig sich ein solches Register nutzen lässt, zeigt sich in Dänemark und Schweden. Dort hat jeder Einwohner eine Identifikationsnummer, die es Behörden oder Wissenschaftlern ermöglicht, Daten zwischen dem Impfregister und einer elektronischen Krankenakte abzugleichen. "Diese Impfregister sind zentral organisiert. Sie sind zu einem großen Teil digital organisiert und sie erlauben, Nebenwirkungen und Wirksamkeit zu erforschen", sagt Katharina Paul, Forscherin vom Institut für Soziologie der Universität Wien, die sich seit Jahren mit der Bedeutung von Impfregistern beschäftigt. Die Datensätze seien von enormer Wichtigkeit für die öffentliche Gesundheit und für die Forschung. "Denn wir können mit Impfregister auch beobachten: Wer lässt sich impfen, wer nicht? Warum ist das so? Wo sind auch Impflücken, die es zu schließen gilt?"
Wie läuft die Debatte in Deutschland?
Kontrovers – ähnlich wie bei der Diskussion über die Einführung einer Impfpflicht. Als Befürworter eines Impfregisters hat sich vor Weihnachten der Deutsche Ethikrat positioniert, genauso wie zuvor schon der Deutsche Städte und Gemeindebund und der Hausärzteverband. Widerstand kommt von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Ihr Präsident, Andreas Gassen, sagte: "Der Aufbau eines nationalen Impfregisters würde Monate, vielleicht auch Jahre dauern, damit wäre uns im Moment nicht geholfen."
Gerade in der Politik ist das Thema umstritten, wie sich exemplarisch in der Regierungspartei SPD zeigt. Befürworter eines Impfregisters wie etwa die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas betonen die Notwendigkeit von exakten Zahlen. Gegner, wie etwa Generalsekretär Kevin Kühnert, fürchten Probleme mit dem Datenschutz. "Auch wenn es auf die Daten der Corona-Impfung beschränkt ist, sehe ich die grundlegende Gefahr, dass mit einem solchen Schritt die Tür für den Zugriff auf weitere Daten geöffnet ist", so Kühnert.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich in der Frage noch nicht festgelegt. Sein Haus lässt die Idee derzeit prüfen. Lauterbach gab allerdings schon seiner Befürchtung Ausdruck, dass das Register ein "Riesen-Bürokratiemonster" werden könnte.
Gibt es konkrete Vorschläge für die Umsetzung?
Am detailliertesten hat sich in der Frage der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes geäußert. "Wenn man über eine Impfpflicht nachdenkt, kommt man um ein zentrales Register nicht herum, das wäre sinnvoll“, sagte der Bundesvorsitzende Ulrich Weigeldt in der "FAZ". Die Speicherung sei nötig, um verlässliche statistische Daten zum Impffortschritt, zur Verträglichkeit, zu möglichen Durchbrüchen und Ähnlichem zu führen, und zwar nach Altersgruppen, Geschlecht, Vorerkrankungen und weiteren Kriterien. Weigeldt schlägt vor, die elektronischen Impfzertifikate, die Ärzte und Apotheker ausstellen, zum Aufbau eines landesweiten Registers zu nutzen. Die dazu nötige Hard- und Software müsse von verlässlichen staatlichen Einrichtungen in Auftrag gegeben und kontrolliert werden, etwa vom Paul-Ehrlich-Institut.

Was sagt der Datenschutz?
Allerdings bleibt fraglich, wie schnell ein solches Impfregister in Deutschland überhaupt aufgebaut werden kann. Schließlich hinkt das Land bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen weit hinterher, wie sich beim Reizthema elektronische Patientenakte oder auch bei Entwicklung und Einführung der Coronawarn-App gezeigt hat.
Immerhin: Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, sieht die Einführung als machbar an. "Datenschutzrechtlich unmöglich ist ein nationales Impfregister nicht", sagte Kelber der "Funke Mediengruppe". Die Politik müsse allerdings "dringend zuerst ganz konkret die Ziele benennen, die sie erreichen will, damit man beurteilen kann, ob dafür ein zentrales Impfregister notwendig ist oder andere Maßnahmen ausreichen oder sogar besser geeignet sind."
Sein Kollege Stefan Brink, Datenschutzbeauftragter aus Baden-Württemberg, ist deutlich zurückhaltender. "Vorsicht bei nationalen Registern und Finger weg von der Zweckentfremdung von Daten", sagte Brink im "Spiegel". "Den Impfstatus ohne Zustimmung der Betroffenen zentral erfassen und auf dieser Basis womöglich Bußgelder verhängen zu wollen, ist eine Vollzugsfantasie, die einen negativen Effekt auf die Impfkampagne haben kann", so Brink.
Welche Alternativen gibt es zu einem Impfregister?
Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich in einem Interview mit der FAZ eher skeptisch über ein nationales Impfregister geäußert. Im Falle einer Corona-Impfpflicht setzt er nach eigenen Angaben lieber auf stichprobenartige Kontrollen und Bußgelder bei Verstößen. Ähnlich habe dies auch bei der Einführung der 3G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln geklappt.
Der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftrage Peter Schaar schreibt in einem Beitrag für den Blog der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz, dass sich der Aufbau eines bundesweiten Impfregisters angesichts unvermeidlicher Vorlaufzeiten seiner Meinung nach kurzfristig kaum realisieren lasse. Auch in seinen Augen wäre eine Stichprobenkontrolle stattdessen ein gangbarer Weg. Der Gesetzgeber könnte etwa eine Mitführpflicht eines Covid-19-Zertifikats (Impf- oder Genesenenzertifikat oder Nachweis der Befreiung von der Impfpflicht) vorsehen. Die datenschutzfreundliche technische Infrastruktur für den Impfnachweis und dessen Kontrolle sei mit entsprechenden Apps bzw. der Apotheken-Immunkarte bereits vorhanden, so Schaar.
Quellen: FAZ, Wirtschaftswoche, Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz e.V., Deutschlandfunk