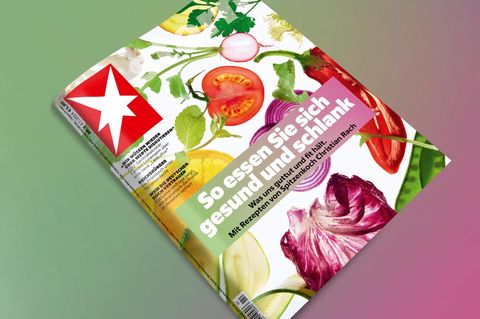Der Tisch muss viel aushalten. Wolfgang Schäubles Zeigefinger fährt runter wie ein Beil. Wieder und wieder. Jeden Satz begleitet ein Schlag auf die Kante. "Politik braucht Führung." Tack! "Politik ist nicht dazu da, den Meinungsumfragen zu folgen." Tack! "Politik heißt Vorangehen. Mit Vorbild. Mit Überzeugung. Mit Entschlusskraft." Tacktack! Jeder Satz ist ein Bekenntnis. Welch ein Kontrast zum Regieren der Angela Merkel. Da redet einer, der nichts fürchtet. Ein Treiber, der seiner Partei Kontur verleiht, der sich mit Scientology anlegt. Während die Kanzlerin Konflikte mit der SPD scheut, während sie die CDU, wie vorige Woche auf dem Parteitag in Hannover, allmählich nach links verschiebt, gibt Schäuble den verunsicherten Konservativen Halt und Orientierung. Der letzte Hardliner.
Der Innenminister sitzt in seinem Büro in Moabit, 13. Stock, ganz oben. Tagsüber hat er einen grandiosen Blick auf die Hauptstadt: die Spree, den Reichstag, die Hochhäuser am Potsdamer Platz. Jetzt herrscht draußen schwarzdunkle Nacht, eine heftige Bö drückt gegen die Scheiben, und drinnen verteidigt sich einer, der stürmischen Gegenwind kennt - und ihn gern in Kauf nimmt. Schäuble ist die Reizfigur im Kabinett Merkel. Seine Mahnungen vor dem Terror und seine Rufe nach schärferen Gesetzen haben ihn zum Buhmann der Großen Koalition werden lassen. SPD-Fraktionschef Peter Struck schimpfte ihn einen "Amokläufer", SPD-Ex-Generalsekretär Klaus Uwe Benneter erklärte ihn für "verrückt". Seither hat sich ein Bild von Wolfgang Schäuble festgesetzt: ein Dr. Seltsam, der kein Maß und kein Augenmaß mehr kenne im Kampf gegen den Terrorismus. Schäuble schüttelt den Kopf. Unsinn sei das, ein Zerrbild, ihm gehe es wie dem Schriftsteller Daniel Kehlmann, der habe gerade erst beschrieben, wie man durch Klischees, Gerüchte und Halbwahrheiten die Kontrolle verliert über das, was die Menschen über einen wissen und denken. Und Sie haben keine Fehler gemacht?
Der Mann wird nicht klein beigeben
Seine Stimme wird härter. Manchmal faucht er leise. Seine Augen werden kleiner, die Falten im Gesicht schärfer, wieder traktiert der Finger die Tischkante. "Ich verteidige die Freiheitsordnung des Grundgesetzes. Dazu gehört auch die Meinungsfreiheit." Tack! "Denkverbote entsprechen nicht dem Grundgesetz und nicht der politischen Verantwortung." Tack! "Wenn die Welt sich ändert, müssen Politiker darüber nachdenken, was das bedeutet." Tacktack! Demokratie beruhe auf Kommunikation, nicht auf Geschäften in Hinterzimmern. Deshalb müsse ein kritischer Diskurs geführt werden. "Dazu braucht man Mut und so viel Rückgrat, dass man sich nicht von den Tugendwächtern der Political Correctness davon abhalten lässt, seine Meinung zu sagen. So!" Das So! klingt nach. Wie ein riesiges Ausrufezeichen. Der Mann wird nicht klein beigeben. Schäuble, 65, will sich durchsetzen. Auch wenn es nicht danach aussieht. Onlinedurchsuchung, Fahndung mit Mautdaten oder Einsatz der Bundeswehr im Inneren - überall hat sich ihm die SPD in den Weg geworfen. "Alle Züge stehen still", heißt es gereizt in seinem Ministerium.
Dabei hatte alles gut angefangen. "Der Einstieg war sehr angenehm mit ihm. Ein erfreulicher Kontrast zu Otto Schily", schwärmt der SPD-Innenpolitiker Dieter Wiefelspütz. "Wir dachten plötzlich alle, mein Gott, es geht auch anders." Schäuble erkämpfte gegen seine eigenen Leute ein neues, deutlich liberaleres Bleiberecht für Ausländer. "Das", sagt Wiefelspütz, "werde ich ihm nie vergessen." Doch dann kam der 29. März 2007. Die Rechts- und Innenpolitiker der Koalition reden über neue Sicherheitsgesetze. Vertraulich, mit allseits erklärtem Willen, die Ideen wohlwollend zu prüfen. Vier Tage später steht alles im "Spiegel", einige Sozialdemokraten, die nicht zur Runde gehörten, attackieren Schäuble - und der hält dagegen. Er hofft, die SPD-Experten würden ihm zur Seite springen. Stattdessen bläst die SPD-Spitze zum Angriff. Seither ist das Klima vergiftet. Und Schäuble erscheint wie ein Verfassungsminister im Furor, der nicht einzelne Regeln, sondern am liebsten das ganze Grundgesetz ändern würde. An diesem Bild hat er selbst am meisten gemalt. Er überrollte das Publikum so mit Warnungen und Forderungen, dass am Ende keiner mehr wusste, was aus seiner Feder stammte - und was, wie die Onlinedurchsuchung oder das Luftsicherheitsgesetz, zum Erbe der rot-grünen Regierung gehörte. Und er verwies früh auf den umstrittenen Kölner Staatsrechtler Otto Depenheuer und heizte so selbst die Debatte auf mit Begriffen wie "Ausnahmezustand", "Feindstrafrecht" und "Ernstfall in der Normallage".
Denken ist sein größtes Vergnügen
Schäuble in der Regierungs-Challenger, hoch über den Alpen. Sein israelischer Kollege hat ihn eingeladen. Zeit zum Nachdenken. Ein Auge schließt sich, das andere nimmt sein Ziel ins Visier. So wie andere auf Tontauben schießen. Kimme und Korn. Denken ist sein größtes Vergnügen. Schon früher war es wichtig, seit dem Attentat ist es das Wichtigste, was ihm geblieben ist. "Das Völkerrecht passt nicht mehr. Das ist völlig unstreitig. Kein ernst zu nehmender Mensch bestreitet das noch", sagt er. Auf Selbstmordattentate und asymmetrische Kriegsführung von Terroristen habe die Rechtsordnung bis jetzt keine zufriedenstellende Antwort. "Das ist die neue Realität." Schäuble hat sich für eine glasklare Antwort entschieden: Die Rechtsordnung muss geändert werden. Mögen alle anderen das nicht erkennen oder für falsch halten - für ihn ist es die Lösung. Man möchte ihm ja trauen, aber Zweifel bleiben. Warum denkt er so? Aus Angst? Angst vor einem Anschlag? Angst vor dem Vorwurf, nicht alles versucht zu haben? Schäuble schaut aus dem Kabinenfenster. "Nein, nein. Ich habe alles sorgfältig durchdacht. Ich behaupte nicht, dass ich immer recht habe. Aber ich bin mir in wichtigen Teilen meiner Sache doch sehr sicher." Nein. Er schüttelt den Kopf. "Ich habe keine Angst." Innenminister sein bedeute "große Verantwortung". Die hat er gespürt, als im Sommer drei BKA-Beamte in Afghanistan getötet wurden. Er hat die Angehörigen persönlich angerufen. "Das ist kein Spaß mehr."
Seine harte Haltung - ist das tatsächlich Klugheit? Besessenheit? Oder am Ende vor allem Besserwisserei? Wohl alles zugleich. Vor allem ist es seine Art, Politik zu machen. Dieser Wolfgang Schäuble, seit 1972 im Bundestag, seit 1981 in wichtigen Ämtern, seit 1990 im Rollstuhl, mag manches nicht mehr können; für fast alles braucht er Hilfe. Aber er kann denken. Sein scharfer Verstand ist sein Trumpf, seine Leidenschaft und seine Waffe. Über ihn holt er sich sein Selbstvertrauen, das ist sein Leben. Kaum ein wichtiges Buch, das er nicht gelesen hat, kaum eine wissenschaftliche Debatte, die er nicht verfolgt. Kaum ein aktuelles Theaterstück, das er verpasst. Er diskutiert im Deutschlandradio Kultur über die neueste "Wallenstein"- Aufführung und mit dem aus Russland stammenden Schriftsteller Wladimir Kaminer über Integration und Heimat. Früher hat es für ihn zum Ausgleich auch noch den Sport gegeben. Fußball, Tennis, immer leidenschaftlich, manchmal verbissen. Nach dem Attentat 1990 fing er an, auf betonierten Wegen mit dem Handbike Kilometer zu fressen. Heute treibt ihn dazu vor allem die Sorge um seine Gesundheit. "Bei dem Wetter anderthalb Stunden durch den Wald - das ist kein Vergnügen. Ich mach es aus Vernunft. Ich esse halt gern und trinke gern meinen Wein."
Verwegenheit. Mut. Risiko
Sein Vergnügen - das ist der geistige Wettstreit, das Schärfen der Argumente. An der Wand in seinem Büro hängt ein Ölbild von Jörg Immendorff. Sein Lieblingsbild. Titel: Verwegenheit stiften. Verwegenheit. Mut. Risiko. Immer an der Grenze, auch an der Grenze zum Scheitern. "Mich beschäftigen die großen Themen. Deshalb schreibe ich gelegentlich Bücher. Steuerreform, EU-Verfassung oder die Frage: Scheitert der Westen?" Drunter macht er es nicht mehr. Schäuble will Avantgarde sein. Immer. Er lässt die erste Ökosteuer entwickeln, entwirft eine radikale Steuerreform, liefert den Plan für eine EU-Verfassung und ein Kerneuropa. Ein Schäuble-Vertrauter beschreibt das so: "Er ist am Anfang einer Debatte nicht festgelegt, er lässt sich beraten. Aber wenn er mal eine Entscheidung getroffen hat, marschiert er, kämpft, wackelt keinen Zentimeter." Kein Wunder, dass Schäuble viel Sympathie hegt für den Franzosen Nicolas Sarkozy - und viel Verachtung für den frühen Schröder oder den späten Stoiber, die sich statt von Überzeugungen von Stimmungen haben leiten lassen. Seine Selbstbeschreibung ist reines Selbstbewusstsein: "Ich habe eine hinreichend gute Meinung von mir selber, was mich nicht immer angenehm macht gegenüber anderen." Nicht immer angenehm. So kann man das auch sagen.
So würde das wohl auch die Kanzlerin ausdrücken. Schäuble ist für Angela Merkel ein besonderer Fall. Einer, dessen Intellekt sie schätzt und dessen Entschlossenheit sie abschreckt. Erst neulich waren sie wieder länger abendessen. Sie nutzt seinen Sachverstand, aber fürchtet seine Hartnäckigkeit und seinen Willen, für eine Sache gegen erbitterten Widerstand zu kämpfen. Sie weiß: Er spaltet ihre Koalition und die Bevölkerung wie kein Zweiter. Sie weiß aber auch, dass sie ihn dringend braucht, weil er der CDU die so wichtige Kompetenz für innere Sicherheit garantiert. Das Verhältnis ist ständig unter Spannung - und wird es bleiben. In der CDU ist er der Letzte, den sie kontrollieren könnte. Deshalb wollte Merkel ihn nicht noch mal an der Fraktionsspitze. So ist der Mann, der Kanzler und Bundespräsident werden wollte, am Ende dort gelandet, wo er vor 16 Jahren schon einmal war: im Bundesinnenministerium. Eigentlich eine Nummer zu klein - das ist seine politische Tragik. Schäuble zu Besuch in Yad Vashem, Israels Holocaust-Gedenkstätte. Eine Historikerin führt ihn lange durch die Ausstellung. Die beiden reden viel. Sie berührt ihn mit der Geschichte ihrer Eltern, die beide Ghetto und Konzentrationslager überlebt haben.
"Wir müssen die Freiheit verteidigen"
Der Rundgang endet an einer schwarzen Metalltür. Dahinter blendet das gleißende Mittagslicht von Jerusalem einen Wolfgang Schäuble, der gerührt ist und in sich zusammengesunken. Dankbar reicht er der Führerin die Hand, schaut unsicher blinzelnd in ihre Augen und sagt, dass ihn die Tour sehr bewegt habe. Ein anderer Schäuble, kleiner, weicher. Aber nur für einen Augenblick. Kaum ist die Frau weg, stemmt er sich hoch im Rollstuhl, rüttelt sich, schüttelt ab, was Gefühl sein könnte. Wenige Meter entfernt warten Mikrofone. "Wir müssen die Freiheit verteidigen", sagt Schäuble, wieder Minister. "Deshalb braucht die Polizei klare neue rechtliche Grundlagen. Nur so kann die Freiheit wirklich verteidigt werden." Schäuble bleibt Schäuble. Er kann nicht anders, findet nicht raus aus einem Kampf, in den er sich auch selbst hineingedreht hat. Und das umso mehr, seitdem er sich mit einem duelliert, den er öffentlich nicht angreifen darf: den CDU-nahen Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio. Karlsruhe, ein Abend im November. Der Tisch ist fein gedeckt. Zur Vorspeise gibt’s Fisch, danach Perlhuhnbrust. Die Mitglieder des Bundeskabinetts sind zu Gast bei den Verfassungsrichtern. Das Treffen soll dem Meinungsaustausch dienen. Doch einer wartet darauf vergeblich: Wolfgang Schäuble. Udo Di Fabio sitzt ihm schräg gegenüber, man redet über alles Mögliche, nur zur Sicherheitsdebatte sagt Di Fabio kein Wort. Schäuble könnte explodieren. Er mag Drückeberger nicht. Er muss sich sehr beherrschen.
Denn am Abend zuvor ist Di Fabio mutiger gewesen. Bei einem Vortrag in Berlin hat er - in deren Abwesenheit - Schäuble und dem Staatsrechtler Depenheuer scharf widersprochen: "Die intellektuelle Lust am antizipierten Ausnahmezustand ist kein guter Ratgeber." Unter dem Titel "Sicherheit und Freiheit" attackiert der Richter den Minister: "Wer mehr Sicherheit in Freiheit will, sollte den Pragmatismus mehr lieben als das intellektuelle Spiel mit dem Grenzfall." Sätze wie Ohrfeigen. Sätze, die Schäuble zur Weißglut treiben. Weil ihm da einer widerspricht, noch dazu kein Linker, sondern ein Liberal-Konservativer. Und weil Di Fabio es sich aus seiner Sicht zu einfach macht. Unverschämt einfach. Ein Richter richtet. Hinterher. Ein Innenminister muss im Notfall entscheiden. Sofort. Der Grenzfall ist Last, nicht Lust. Auch für Schäuble. Lautet sein Motto viel Feind, viel Ehr? In seinem Büro antwortet Schäuble schmunzelnd. "Ich suche das nicht. Aber ich fürchte es auch nicht. Ich bin in hohem Maße unabhängig und mit mir sehr im Reinen." Ruhig soll das klingen. Es ist Abend geworden. Feierabend. Schäuble drängelt. Seine Frau Ingeborg wartet unten. Sie habe geahnt, dass es knapp werden würde. Sie soll nicht recht behalten. Er will nicht zu spät kommen. Was haben Sie denn noch vor? "Ach, wir gehen ins Kino." Was schauen Sie an? "Ein neuer Film: ‚Abbitte‘." Stille. Schäuble denkt nach. Dann muss er lachen. Abbitte! Als ob es jemand bestellt hätte.