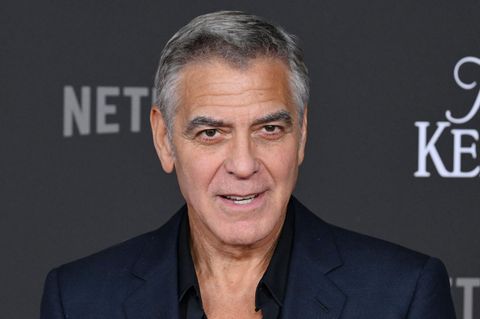Wie ein Fluch kam der Königssohn aus England über das mächtigste Reich des späten Mittelalters und zwang Frankreichs Ritterschaft und dessen König in die Knie. Eduard Plantagenet war 15, als er das erste Mal französischen Boden betrat. Zehn Jahre später ist er ein Mythos, »die Blume der Ritterschaft«
Obwohl der Schwarze Prinz mit seiner prachtvollen Rüstung, die den ganzen Körper schützte, das Idealbild des mittelalterlichen Ritters verkörperte, läutete er mit seiner Art der Kriegsführung das Ende des Rittertums ein. Denn der Sohn des englischen Königs Edward III. stützte sich in seinen Schlachten auf leichte, bewegliche Fußtruppen. Seine stärkste Waffe waren Bogenschützen, die mit ihren Pfeilen aus der Distanz die geharnischten Krieger hoch zu Ross vernichteten. Besonders deutlich wurde das in der Schlacht von Poitiers, als er die große Übermacht der Franzosen ohne große eigene Verluste bezwang. Das Rittertum, das auf dem überkommenen Ideal vom Zweikampf Mann gegen Mann beharrte, erholte sich nie mehr von dieser Niederlage. Als kurz darauf auch noch die Pulverwaffen aufkamen, verschwand der stolze Held in der schimmernden Rüstung endgültig aus der Geschichte.
Es war ein böses Funkeln im Universum. Wer Augen hatte, die Zeichen zu sehen, sah es mit Schrecken: Der Himmel hatte sich verschworen. In der Nacht des 20. März 1345 standen Saturn, Jupiter und Mars im Winkel von 40 Grad zum Aquarius. Das konnte nur Unglück bedeuten.
Angst und Entsetzen befiel die Menschen. Büßer tanzten heulend durch die Straßen, geißelten sich aufs Blut. Der Papst exkommunizierte die Planeten. Aber der Himmel kannte kein Erbarmen, schickte nichts als Plagen. Ein Erdbeben erschütterte halb Europa. Mauern, Häuser und Türme stürzten ein. Der Himmel schickte eine große Kälte, die Ernten vernichtete und Gletscher wachsen ließ. Und er sandte den Schwarzen Prinzen.
Wie ein Fluch kam er über das mächtigste Reich des Mittelalters, zog eine breite Blutspur durch dessen Geschichte und zwang die Großmacht Frankreich, dessen Ritterschaft und König in die Knie. Als 15-Jähriger betritt Eduard Plantagenet 1346 französischen Boden. Zehn Jahre später ist er ein Held, ein Mythos, die »Blume der Ritterschaft«.
Schwarz glänzt die Rüstung, die ihm seinen Namen gab, silberne Straußenfedern zieren seinen Helm. Der Prinz ist muskulös, erfahren in allen Kampfsportarten seiner Zeit, stark und tapfer. Mit 16 Jahren schlägt er in Crécy seine erste große Schlacht, und sein Vater, der König von England, sieht ihm gelassen dabei zu. Auf den Schultern des Schwarzen Prinzen ruht die Hoffnung Englands.
Geschichte wird von Siegern geschrieben, der Schwarze Prinz ist ein solcher Sieger. Sein Handwerk ist der Krieg. Sein Lebenswerk Terror. Er ist ein genialer Stratege, brutal und zupackend, ein Beutegreifer und skrupelloser Geiselnehmer.
Seine Zeit ist geprägt von einer gottgewollten Ordnung, die dem König, dem Adel und den Herrschenden alles erlaubt und den Untertanen nichts. Gewalt ist legitim, Brutalität Stärke, Verschwendung ein Zeichen der Herrlichkeit. Was heute nur in Gruselfilmen gezeigt wird, gehört im Spätmittelalter zum Alltag: das blutige Entertainment öffentlich-rechtlicher Grausamkeit - Handabhacken, Ohrabschneiden, Kopfabschlagen; Menschen werden lebendig gehäutet, verbrannt, in vier Teile gerissen; Kinder und Schwangere werden gefoltert, Leichenteile öffentlich zur Schau gestellt.
Die Kinderstube des Schwarzen Prinzen, der englische Hof, gilt als Hölle des Hasses. Heimliche Morde und öffentliche Justizverbrechen ebnen die Wege zur Macht. König Eduard III., der Vater des Prinzen, ist alles andere als ein friedlicher Herrscher. Mit 15 Jahren hat er den Thron bestiegen, ein hoch gewachsener Haudegen mit langen blonden Haaren, aufbrausend, leichtsinnig und rachsüchtig, ein Wüstling, der nichts dabei findet, die Frau eines Getreuen, den er in den Krieg geschickt hat, brutal zu vergewaltigen.
Dieser Mann hält sich, aufgrund alter Familienansprüche, für den legitimen König von Frankreich. Ein schmaler Streifen Aquitaniens bei Bordeaux gehört ohnehin zu England. Jetzt will er den Rest, die Krone. Sein Sohn Eduard, der Schwarze Prinz, soll ihm helfen, diesen Anspruch mit Gewalt durchzusetzen. Es ist, als hätten zwei Füchse beschlossen, einen Bären zu jagen, ein Akt des Größenwahns.
Frankreich hat fünf Mal so viele Einwohner wie England. Französisch ist die Sprache des europäischen Adels, im Königreich Neapel ebenso wie in Sizilien oder am englischen Hof. Vermutlich ist Edward III. nicht einmal der englischen Sprache mächtig. Selbst am Hof des Papstes wird Französisch gesprochen. Gottes Stellvertreter verlegt seinen ersten Wohnsitz nach Frankreich. Ab 1346 residiert er in Avignon.
Wer sich mit Frankreich anlegt, braucht sich um die Zahl der Gegner keine Illusionen zu machen. Sie werden immer in der Übermacht sein. So sehen sich die Engländer denn auch bei Crécy einem stolzen Ritterheer gegenüber, mit Tausenden gepanzerten, schwer bewaffneten Reitern, prächtigen Pferden und wehenden Bannern.
Frankreichs Ritter sind kampferprobt, haben in vielen Turnieren gelernt, ihre Kräfte zu messen. Turniere sind der Formel-1-Zirkus des Mittelalters, eine spannende und ruinöse Inszenierung des Kampfes als schönes Schauspiel, bei dem es Tote und Verletzte gibt.
Der Schaukampf ist in seiner Pracht, seinen Farben, seinen umständlichen Vorbereitungen und Ritualen eine Demonstration des ritterlichen Ideals, das der niederländische Historiker Johan Huizinga »zur Schönheit erhobenen Hochmut« nennt. Hochmut kommt vor dem Fall. Ritterliche Kampftechniken zielen ins Leere, wenn der Gegner die Spielregeln ändert.
Die englischen Ritter kämpfen nicht zu Pferd. Sie steigen ab, lassen den Bogenschützen den Vortritt. Und die zielen auf die Pferde, versetzen das herandonnernde, zahlenmäßig weit überlegene französische Ritterheer mit ihrem Pfeilhagel in Unordnung. Mit Spießen und langen Messern macht sich das Fußvolk wie mit Dosenöffnern über die gestürzten Ritter her. Am Ende liegen 4000 Franzosen tot auf dem Schlachtfeld.
Die Schlacht von Crécy bedeutet nicht nur eine Niederlage für ein prächtiges Ritterheer, sondern auch den Niedergang des Rittertums und seiner veralteten, formalisierten und überaus unpraktischen Kampftechnik. Nicht Schlachtross, Lanze und Schwert, sondern der Langbogen des Fußvolks wird sich als wirkungsvollste Waffe des Jahrhunderts erweisen.
Nach der Schlacht ziehen die Engländer nach Calais und belagern es ein Jahr lang. Die Bürger der eingeschlossenen Stadt ergeben sich, nachdem sie in ihrer Verzweiflung schon Mäuse und Ratten verzehrt haben. Viel hat der Sieg nicht gebracht. Ein Waffenstillstand wird geschlossen. Der Krieg hat das Land verwüstet und erschöpft. Aber er ist nur der Vorbote des Schreckens, der Europa nun heimsuchen sollte.
Der Himmel schickt die apokalyptischen Reiter, Krieg, Hunger und Pest. Der Schwarze Tod fordert Opfer über Opfer, entvölkert ganze Landstriche. Auf der Suche nach den Schuldigen fallen in vielen Städten die Christen über die Juden her. Sie bringen Tausende von ihnen um.
Die Pest bleibt. Der Tod hält reiche Ernte, vor allem in Frankreich. Um 1340 zählte die lateinische Christenheit noch rund 65 Millionen Menschen, am Ende des Jahrhunderts waren es 25 Millionen weniger. Die Kirche ist die Haupterbin des Schwarzen Todes. Unermessliche Reichtümer fallen ihr zu. Die Produktion verlangsamte sich, Waren wurden knapp, Preise schossen in die Höhe.
Da flammt der Krieg wieder auf, ein Krieg, der insgesamt 116 Jahre dauern sollte und als Hundertjähriger Krieg in die Geschichte eingehen wird. Zwei englische Armeen überfallen Frankreich, eine im Norden und eine im Süden: Der Schwarze Prinz stürmt mit 1000 Rittern, Knappen und anderen Waffenträgern, 2000 Bogenschützen und walisischem Fußvolk tief ins Land. Er ist nun 24 Jahre alt. Die Franzosen fürchten seine Grausamkeit, nennen ihn aber auch den »stolzesten Mann, den je ein Weib gebar«. Der zieht eine Spur der Verwüstung hinter sich her, die »Blume der Ritterschaft« erweist sich als Leitwolf einer geharnischten Räuberbande, die Häuser, Dörfer und Felder verwüstet und verbrennt. Schwer beladen mit Beute zieht der Heerhaufen sich ins Winterquartier nach Bordeaux zurück.
Um die englische Landplage endlich loszuwerden, lässt Johann der Gute, König von Frankreich, drastisch die Steuern erhöhen. Ein Feldzug ist teuer. Bezahlen müssen ihn immer die Ärmsten. Der Tagessatz für einen Ritter kostet so viel wie der Sold für vier Bogenschützen oder die Miete für einen Ochsenkarren für 20 Tage. Dafür muss ein Bauer zwei Jahre lang schuften.
Das Mittelalter hat eigene Vorstellungen von Steuergerechtigkeit. Adel und Kirche sind von der Steuer befreit. Reiche Bürger müssen vier, der Mittelstand fünf und die Armen zehn Prozent ihres Einkommens abgeben. Die Hälfte der Bauern lebt am Rand des Existenzminimums. Nur jeder Fünfte kann sich einen eigenen Pflug leisten.
Der Adel genießt das Leben. Man legt viel Wert auf feine Kleidung. Die Damen rasieren die Stirn, um intelligenter und begehrenswerter auszusehen, die Herren tragen lange, spitze Schuhe, kurze Hemdjacken über hautengen Strumpfhosen, die das Gemächte modellieren. Pelzkragen kommen in Mode. Praktisch sind sie auch: Sie sollen verhindern, dass Läuse vom gesalbten Haupthaar auf den Rücken rutschen.
Der Sommer geht ins Land. Das Heer des Schwarzen Prinzen ist auf 8000 Mann angewachsen und zieht nach Norden. Die Männer sind erschöpft, der Tross ist wieder schwer mit Beute beladen. Er zieht schon Richtung Poitiers. Ein mächtiges Heer ist ihm auf den Fersen, das größte, das Frankreich in diesem Jahrhundert aufgeboten hat. An seiner Spitze reitet König Johann mit zwei Marschällen Frankreichs und vier seiner Söhne, gefolgt von Herzögen, Grafen, Bannerherren. »Noch nie sah man dergleichen Adel in Waffen«, schreibt ein englischer Chronist.
Ein französischer Vortrupp dringt tief ins Heer des Schwarzen Prinzen ein, erobert fast sein Banner. Er ist gezwungen, ein Nachtlager aufzuschlagen, will am nächsten Tag den Rückzug fortsetzen, aber die Franzosen verstellen ihm den Weg.
Er zieht sich auf eine bewaldete Anhöhe zurück, am Fuß sind sumpfige Wiesen. Bis zuletzt versucht er durch Verhandlungen, der Schlacht mit dem übermächtigen Gegner zu entgehen. Er bietet die Freilassung aller Gefangenen gegen freien Abzug, sieben Jahre Waffenstillstand. Aber die Franzosen verlangen zu viel: Niemals wird er sich in Gefangenschaft begeben.
Am 19. September 1356 kommt es zur Schlacht. Die Pfeile der englischen Bogenschützen verdunkeln den Himmel. Frankreichs König wirft sich ins Getümmel, mit zwanzigfacher Kraft, denn jeder seiner Leibwächter trägt wie er eine schwarze Rüstung und einen weißen Umhang.
Sieben Stunden dauert die Schlacht von Poitiers. Cool wartet der Prinz mit seiner Reserve auf dem Hügel. Er behält den Überblick. Endlich stürmt er mit seinen Getreuen zu Pferd ins Zentrum des Gemetzels. Frankreichs König kämpft inmitten seiner Garde. Seine Streitaxt fliegt. Er blutet aus zwei Wunden im Gesicht, hat im Gefecht den Helm verloren. Das rettet ihm das Leben. Er wird erkannt und ergibt sich.
Ein schwarzer Tag für Frankreich. Tausende liegen auf den Schlachtfeld, Frankreichs König gefangen, dazu ein Erzbischof, 13 Grafen, fünf Vicomtes, 21 Barone und Bannerherren und 2000 Ritter. Zwar werden die meisten der Gefangenen auf Ehrenwort entlassen, aber die Lösegeldsummen, die sie aufzubringen haben, stürzen sie in den Ruin.
Der Schwarze Prinz bringt Frankreichs König und dessen 14-jährigen Sohn nach England. Ein Triumphzug, den England nie vergisst. Johann der Gute reitet neben dem Schwarzen Prinzen durch die Straßen von London. Mädchen in goldenen Käfigen werfen gold- und silberverzierte Blumen auf die Helden. Der gefangene König trägt Schwarz, ist wie ein Diakon gekleidet.
Frankreich ist ohne Führung. Die göttliche Ordnung ist zerstört. Verarmte Ritter ziehen in Banden durchs Land. Franzosen, Engländer, Söldner und Briganten sammeln sich in Guerilla-Armeen, die auf eigene Rechnung Krieg führen, gegen jeden, der ihren Weg kreuzt, gegen Dörfer und Klöster, Burgen und Städte. Bauern werden ausgeplündert, misshandelt, verjagt oder ermordet, ihre Hütten von umherziehenden Marodeuren und Rittern abgebrannt. Die Vertriebenen werden zu Vagabunden.
Frankreichs König muss in den Jahren seiner Gefangenschaft nicht auf königlichen Prunk verzichten. Er handelt mit Wein und Pferden, leistet sich einen Astrologen und einen »Sängerkönig« mit Orchester. Doch die Lösegeldsumme ist selbst für den König einer Supermacht immens: Vier Millionen Goldécus. 40 Geiseln des Hochadels sollen die Zahlung garantieren. Für seine Freilassung opfert Johann sein halbes Königreich.
Der Dauphin, sein ältester Sohn, verweigert die Zustimmung. Edward III. rüstet zu neuem Krieg. 1100 Schiffe bringen sein Heer nach Frankreich. Aber dieser Feldzug bleibt ohne Ergebnis. Das Land ist schon verwüstet, kann keine Armee mehr ernähren. Und befestigte Städte kann Edward nicht erobern.
Ein neuer Waffenstillstand fällt günstiger aus. Die Lösegeldsumme wird auf drei Millionen herabgesetzt. Frankreich muss nur noch auf ein Drittel seines Staatsgebietes verzichten. Der König ist frei und lässt 40 Geiseln zurück, bis er das restliche Lösegeld aufgetrieben hat.
Jeder muss zahlen, vor allem die Juden. In seiner Verzweiflung verkauft Johann seine elfjährige Tochter für 600000 Goldflorin an die berüchtigte Mailänder Familie Visconti, die für ihren neunjährigen Sohn auf Brautschau war. Johann der Gute, König von Frankreich, ist am Ende seines Lateins, als eine der Geiseln, sein eigener Sohn, flieht. Weil Frankreichs König ein Ehrenmann ist, kehrt er nach London zurück, um sich erneut in Gefangenschaft zu begeben. Dort stirbt er, 45 Jahre alt, an einem »unbekannten Leiden«.
Der Thronfolger, Karl V., ist alles andere als ein edler Ritter: blass, dünn, schwächlich, ein König, den alle unterschätzen. Er macht einen hässlichen, plattnasigen Bretonen zum Hauptmann seiner Truppen: Bertrand Du Guesclin, einen erfahrenen Guerilla-Kämpfer, »ein Wildschwein in Eisen«.
Der Schwarze Prinz begibt sich endlich auf Brautschau. Für ein Königshaus sind Heiraten strategische Entscheidungen. Sie haben die Bedeutung von Nichtangriffspakten mit anderen Mächten. Heiratspolitik ist Bündnispolitik und soll den Reichtum mehren. Im günstigen Fall führt eine Eheschließung über die Erbfolge zur Fusion.
Auf der Heiratspolitik Edwards III. von England ruht bisher kein Segen. Seine älteste Tochter Isabella wollte er, als sie 13 war, mit dem 14-jährigen Ludwig von Flandern verheiraten. Aber der Bräutigam floh. Eduards Tochter Johanna stirbt auf dem Weg zu ihrem zukünftigen Ehemann Peter von Kastilien an der Pest. Nun kommt alles auf den Thronfolger an, auf Eduard, den Schwarzen Prinzen.
Die mittelalterliche Gesellschaft ist jung. Etwa die Hälfte der Menschen ist unter 21. Mit 15 gilt ein Jüngling als erwachsen, mit 14 heiraten die jungen Frauen, mit 30 gelten sie als alt. Die Frau, die der Schwarze Prinz heiraten will, ist 32 Jahre alt, Mutter von sechs Kindern und Witwe. Sie bringt keinen mächtigen Bündnispartner gegen Frankreich in die Ehe, kein Königreich, das Englands Größe mehren könnte, kein reiches Erbe. Es bleibt alles in der Familie.
Der König schäumt. Johanna, die Auserwählte des Schwarzen Prinzen, ist dessen Tante. Er kennt sie von Kindheit an. Sein Urgroßvater war ihr Großvater. Ihr Vater, der Graf von Kent, war wegen einer Verschwörung gegen Edward III. hingerichtet worden. Sie wuchs am englischen Königshof auf, gilt bald als schönste Lady im Königreich und als amouröseste. Mit zwölf hatte sie heimlich einen Grafen Holland geheiratet, wenig später, der Gatte war auf Reisen, wurde sie einem Montague angetraut. Sieben Jahre brauchte der Betrogene, bis er das Geld für die Beschwerde beim Papst beieinander hatte. Die zweite Ehe wurde annulliert. Johanna zog mit dem ersten Mann zusammen.
1361 heiratet der Schwarze Prinz die Witwe seiner Wahl. Ein Jahr später wird er zum Herrscher von Aquitanien. Er lässt sich nur noch von Rittern in goldenen Sporen bedienen. Bei der Bevölkerung ist er verhasst, denn er füllt die leeren Kassen seiner prachtvollen Hofhaltung durch immer neue Steuern. Ständig ist er in Kämpfe mit der französischen Guerilla verstrickt. Zweimal hat er seinen Widersacher Du Guesclin schon festgenommen. Als der ihn verhöhnt, er habe wohl Angst, ihn freizulassen, lässt er ihn laufen, gegen Zahlung von 100 000 Franken.
Aquitanien gehört zwar zu England, aber Lehnsherr des Schwarzen Prinzen ist der König von Frankreich. Als sich die Beschwerden über das Regime des Engländers häufen, zitiert er den Prinzen 1369 nach Paris. Der weigert sich, zu kommen. Neuer Krieg bricht aus, der letzte des Schwarzen Prinzen. Der starke Mann ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Er ist an der Ruhr erkrankt, leidet an Wassersucht. Die Glieder sind geschwollen, er kann kein Pferd mehr besteigen. Der Stolz Englands ist ans Bett gefesselt, regiert übellaunig und in maßloser Wut. Von der Liege aus dirigiert er die Eroberung der Stadt Limoges, die er grausam dafür bestraft, dass sie im ewig dauernden Krieg die Seiten gewechselt hat. Er richtet ein Massaker unter der Bevölkerung an, lässt Frauen und Kinder töten.
Krank kehrt er nach London zurück. Sechs Jahre lang führt er das Leben eines hilflosen Invaliden. Sein Vater, inzwischen 60 Jahre alt und zunehmend senil, hält an der Krone fest und ist munter genug, sich einer neuen Mätresse zuzuwenden. Der Schwarze Prinz fühlt die Kräfte schwinden. Er lässt sich nach London tragen, um die Thronrechte seines neunjährigen Sohnes Richard zu sichern.
Am 8. Juni 1376 stirbt Eduard Plantagenet, der Schwarze Prinz, im Alter von 45 Jahren. Er hat, auf seine Weise, die Welt verändert. Der Krieg, den er so glänzend begann, wird ihn noch um 77 Jahre überdauern. Am Ende wird England seine Besitzungen in Frankreich verlieren. Dann ist die Zeit der Ritter längst vorbei, können auch Pfeil und Bogen keine Schlacht mehr wenden. Die Macht des Schwertadels geht an die Fürsten. Der Reichtum wächst den Städten zu, später den Handelsmächten. Nicht der Glaube an Gott und nicht der Glaube an die Vernunft regiert die Welt, sondern das Geld. Die Methoden haben sich geändert. Aber es geht immer noch um Beute.
Emanuel Eckardt
© Copyright STERN