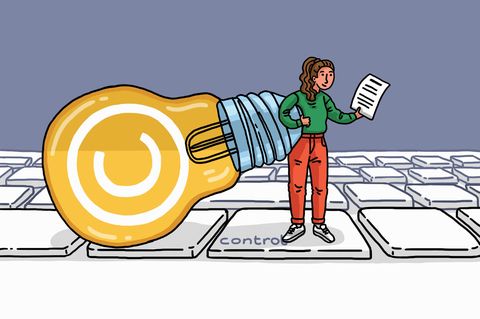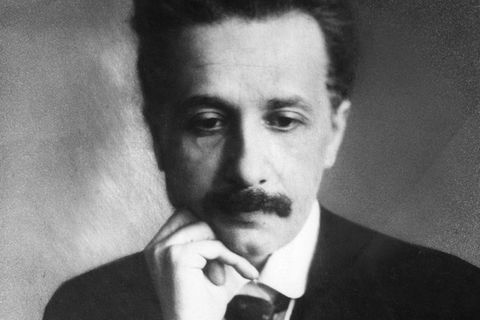Warum müssen wir niedliche Tiere knuddeln oder gar leicht kneifen?
Ob bei herzigen Kätzchen, tapsigen Hundewelpen oder menschlichen Babys: Die meisten Menschen überkommt beim ihrem Anblick ein unbändiges Knuddel-Verlagen. Einige kneifen Babys vor lauter Überwältigung in die speckige Wange oder knabbern gar an ihnen herum. Glücklicherweise verblassen die Erinnerungen an das Gezwicke im Erwachsenenalter. Große Augen und kleiner runder Kopf lösen bei uns den Beschützerinstinkt aus. Es sind Schlüsselreize tief verwurzelt in unserer DNA. Den Drang zum beherzten Zupacken nennen Wissenschaftler „Niedlichkeitsaggression“. Sie gehört zu den „dimorphen“ also widersprüchlichen Emotionen wie Weinen vor Glück oder Lachen vor Nervosität. Verhaltensforscher vermuten dahinter eine Art Schutzfunktion, einen automatischen Gefühlsdämpfer, der helfen soll, einen klaren Kopf zu bewahren und sich nicht von einer Emotion vollständig beherrschen zu lassen.
Ob bei herzigen Kätzchen, tapsigen Hundewelpen oder menschlichen Babys: Die meisten Menschen überkommt beim ihrem Anblick ein unbändiges Knuddel-Verlagen. Einige kneifen Babys vor lauter Überwältigung in die speckige Wange oder knabbern gar an ihnen herum. Glücklicherweise verblassen die Erinnerungen an das Gezwicke im Erwachsenenalter. Große Augen und kleiner runder Kopf lösen bei uns den Beschützerinstinkt aus. Es sind Schlüsselreize tief verwurzelt in unserer DNA. Den Drang zum beherzten Zupacken nennen Wissenschaftler „Niedlichkeitsaggression“. Sie gehört zu den „dimorphen“ also widersprüchlichen Emotionen wie Weinen vor Glück oder Lachen vor Nervosität. Verhaltensforscher vermuten dahinter eine Art Schutzfunktion, einen automatischen Gefühlsdämpfer, der helfen soll, einen klaren Kopf zu bewahren und sich nicht von einer Emotion vollständig beherrschen zu lassen.
© Getty Images